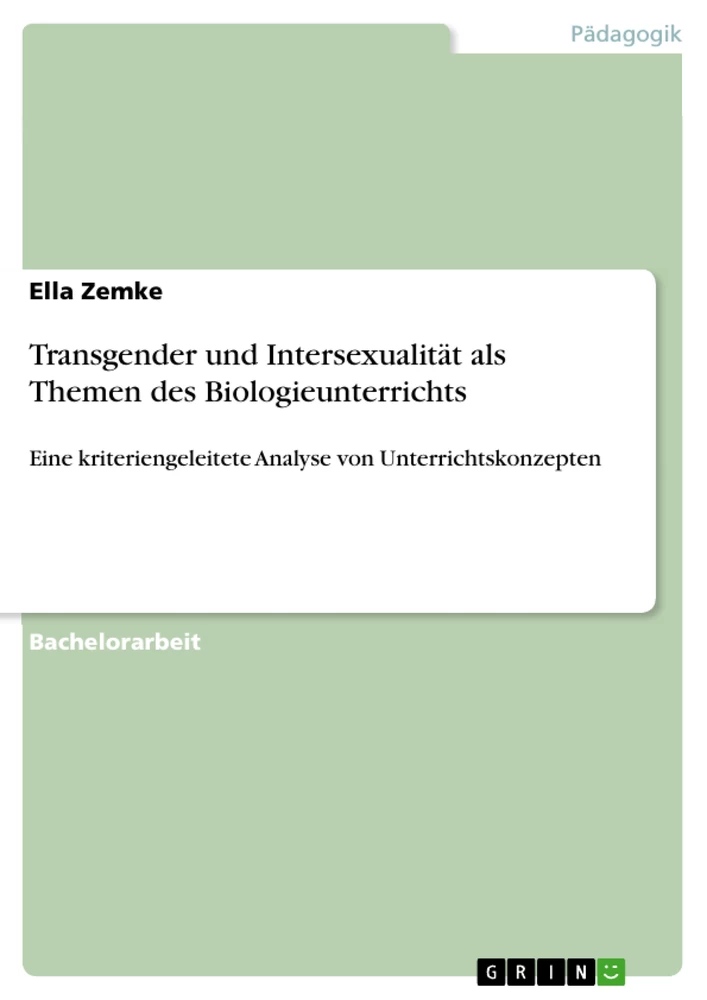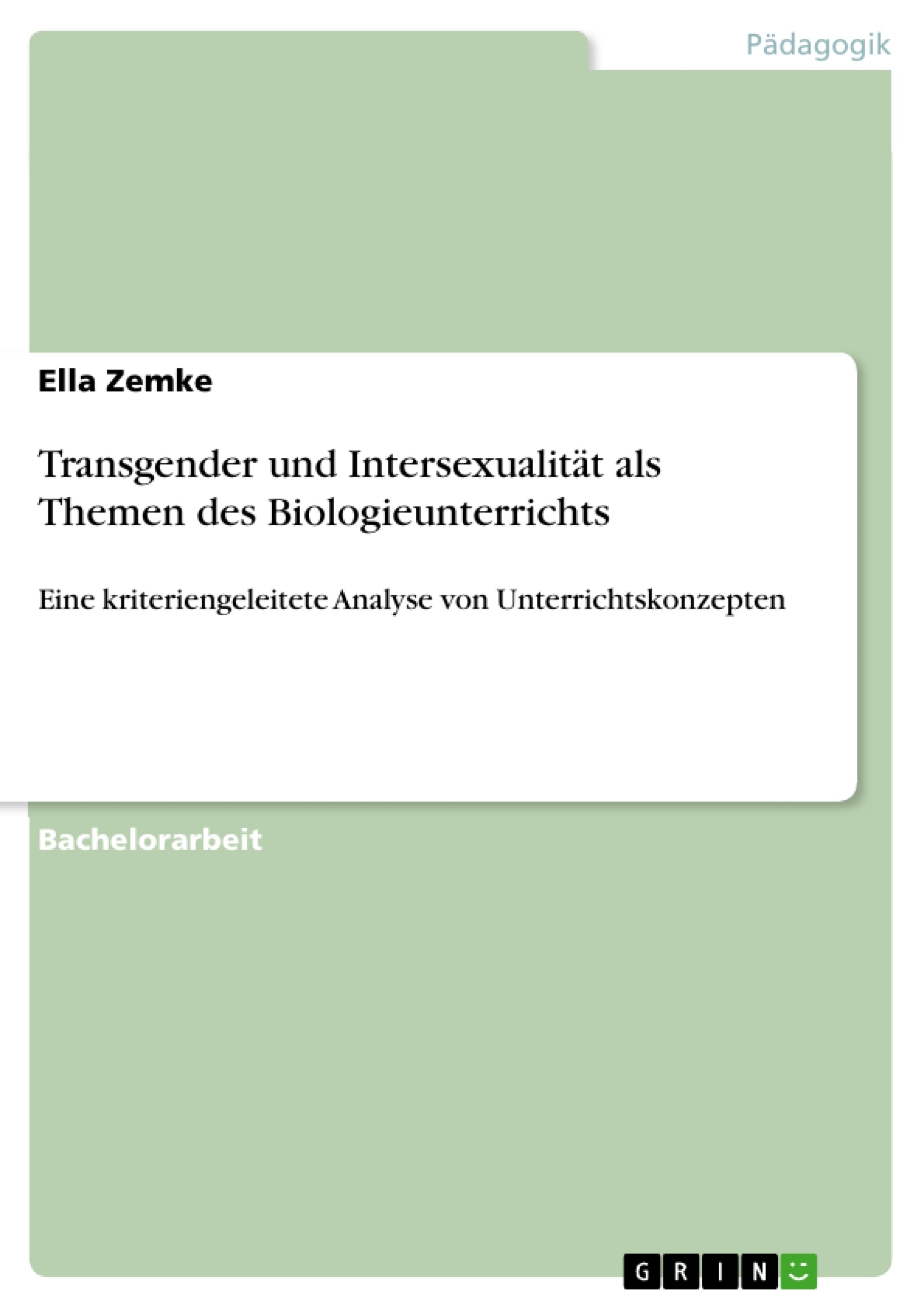Die Arbeit beschäftigte sich, basierend auf der Queer Theory und den Gender Studies, mit der Frage, inwiefern Unterrichtskonzepte vielfältigkeitsorientiert sind, sodass sie jedes Individuum, losgelöst von geschlechtlichen Vorschreibungen, miteinbeziehen und respektieren. Die Analyse bezog sich auf Konzepte der Sekundarstufe I in NRW. Untersucht wurden wissenschaftliche Arbeiten zur Sexualerziehung, die Richtlinien zur Sexualerziehung und der Kernlehrplan für Nordrhein-Westfalen sowie gängige Lehrbücher aus dem Jahr 2017. Als Hauptkriterium der Analyse wurde eine queere Grundeinstellung ausgewählt, um die Anpassung an die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse messen zu können. Eine Miteinbeziehung von Inter*sexualität und Trans*gender bedingt eine Loslösung von der vorherrschenden Vorstellung von Geschlecht, vor allem für jene Individuen, welche sich in der Gesellschaft außerhalb einer Geschlechtergrenze positionieren, in welcher einzig Mann* und Frau* existieren und gelten. In wissenschaftlichen Arbeiten wird die aktuelle Problematik wiederholt benannt, jedoch durch die mindere Behandlung von Trans*gender und Inter*sexualität auch produziert. Selbiges gilt für Richtlinien und den Kernlehrplan. Hier wird auf eine Individualentwicklung besonderen Wert gelegt, jedoch nur im Sinne einer Entwicklung hin zu einem Mann* oder einer Frau*. Auf benannte vielfältige Individuen wird kein Bezug genommen.
Die Untersuchung der Lehrbücher zeigte auf, dass sich isoliert eine Entkopplung von biologischem und psychischem Geschlecht verzeichnen lässt. Ferner findet eine Auseinandersetzung mit benannten Themen einzig durch eine Benennung, welche partiell diskriminierend und negativ besetzt ist, statt. In einem weiteren Schulbuch finden weder vielfältige Geschlechtsidentitäten, weder noch vielfältige sexuelle Orientierungen Beachtung.
Demnach herrschen für Individuen, welche Trans*gender oder inter*sexuell sind, fortwährend diskriminierende Grundbedingungen und Einstellungen, aus welchen praktischer Schulunterricht hervorgeht. Die Konstruktion von Lösungsansätzen gestaltete sich vielseitig, wie zum Beispiel durch den Vorschlag eines Begriff-Inventars, welcher eine neutrale Benennung von Personen ermöglicht, wodurch jedes Subjekt Beachtung in Unterrichtskonzepten finden kann. Im Verlauf der Untersuchung war festzustellen, dass die Gesellschaft sich in einer Umbruchsphase befindet, welcher es vor allem bei dieser Thematik an Sensibilisierung bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Soziales Konstrukt der Heteronormativität
- Gender Studies
- Queer Theory
- Definition von Inter*sexualität und Trans*gender
- Sexualerziehung
- Forschungsstand und Hinführung zur Pädagogik
- Analyse vorherrschender Unterrichtskonzepte NRW's der Sekundarstufe I
- Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
- Vielfältigkeit der Queer Theory als Basiskonzept des Schulwesens und als Kriterium der Untersuchung
- Untersuchung wissenschaftlicher Arbeiten
- Untersuchung der Richtlinien der Sexualerziehung in NRW
- Untersuchung des Kernlehrplans NRW
- Untersuchung der Sexualerziehung in Lehrbüchern
- Lösungsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ausgehend von der Queer Theory und den Gender Studies, die Vielfaltsorientierung von Unterrichtskonzepten der Sekundarstufe I in NRW im Hinblick auf die Einbeziehung von Inter*sexualität und Trans*gender. Ziel ist die Analyse, inwieweit diese Konzepte geschlechtliche Zuschreibungen überwinden und alle Individuen respektieren.
- Analyse der Repräsentation von Inter*sexualität und Trans*gender in Unterrichtsmaterialien.
- Bewertung der Übereinstimmung von Unterrichtskonzepten mit den Prinzipien der Queer Theory.
- Identifizierung von heteronormativen Strukturen in den untersuchten Konzepten.
- Entwicklung von Lösungsansätzen für eine inklusive Sexualerziehung.
- Bewertung des aktuellen Forschungsstandes und der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Abstract: Die Arbeit analysiert die Vielfaltsorientierung von Unterrichtskonzepten zur Sexualerziehung in NRW bezüglich Inter*sexualität und Trans*gender anhand der Queer Theory und Gender Studies. Es wird untersucht, ob diese Konzepte frei von geschlechtlichen Vorurteilen sind und alle Individuen einbeziehen. Die Analyse umfasst wissenschaftliche Arbeiten, Richtlinien, Lehrpläne und Lehrbücher. Ein zentrales Kriterium ist eine queere Grundeinstellung, um die Anpassung an aktuelle gesellschaftliche Diskurse zu messen. Die Ergebnisse zeigen Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis auf.
Einleitung: Die Einleitung verdeutlicht die Diskriminierung von Trans* und Inter*personen in der Gesellschaft und im Rechtssystem. Sie beleuchtet den Widerspruch zwischen gesetzlichen Verbesserungen und der anhaltenden Diskriminierung, die durch Beispiele aus Medienberichten über homophobe Äußerungen von öffentlichen Personen belegt wird. Die Verankerung von Heteronormativität in gesellschaftlichen Strukturen, wie z.B. in Schulbüchern und der Wissenschaft, wird kritisiert. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer weltoffenen Erziehung, die bereits im Kindesalter beginnt und im Schulumfeld einen großen Einfluss hat. Der Fokus liegt auf der Bedeutung einer inklusiven Sexualerziehung im Biologieunterricht der Sekundarstufe I.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es werden die Konzepte der Heteronormativität, Gender Studies und Queer Theory erläutert, sowie Inter*sexualität und Trans*gender definiert. Der Begriff der Sexualerziehung wird im Kontext der Arbeit präzisiert. Ein kurzer Überblick über vorherige Arbeiten zur Sexualerziehung zeigt bestehende Meinungsverschiedenheiten auf und begründet die Notwendigkeit der aktuellen Untersuchung.
Forschungsstand und Hinführung zur Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zum Thema und führt in die pädagogischen Aspekte ein. Es zeigt auf, wie wenig die Themen Trans*gender und Inter*sexualität bisher in der Forschung und Praxis der Sexualerziehung berücksichtigt wurden. Die Arbeit betont die Bedeutung einer ganzheitlichen Veränderung, die sowohl die Prämissen als auch das praktische Handeln betrifft.
Analyse vorherrschender Unterrichtskonzepte NRW's der Sekundarstufe I: Die Analyse der Unterrichtskonzepte in NRW untersucht den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule im Kontext der Queer Theory. Es werden wissenschaftliche Arbeiten, Richtlinien zur Sexualerziehung, der Kernlehrplan und Lehrbücher auf ihre queere Grundeinstellung hin analysiert. Die Untersuchung zeigt Defizite in der Berücksichtigung von Inter*sexualität und Trans*gender auf und schlägt Lösungsansätze vor, z.B. die Entwicklung eines neutralen Begriffsinventars für die Benennung von Personen.
Schlüsselwörter
Inter*sexualität, Trans*gender, Queer Theory, Gender Studies, Sexualerziehung, Heteronormativität, Inklusion, Unterrichtskonzepte, NRW, Sekundarstufe I, Bildungsstandards, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Unterrichtskonzepten zur Sexualerziehung in NRW
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Vielfaltsorientierung von Unterrichtskonzepten der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (NRW) im Hinblick auf die Einbeziehung von Inter* und Trans*Personen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, inwieweit diese Konzepte geschlechtliche Zuschreibungen überwinden und alle Individuen respektieren.
Welche Theorien bilden die Grundlage der Analyse?
Die Analyse basiert auf der Queer Theory und den Gender Studies. Diese Theorien liefern den theoretischen Rahmen, um die Unterrichtskonzepte auf ihre Inklusivität und die Berücksichtigung von Diversität zu untersuchen.
Welche Materialien wurden analysiert?
Die Analyse umfasst wissenschaftliche Arbeiten, Richtlinien zur Sexualerziehung in NRW, den Kernlehrplan NRW und Lehrbücher der Sekundarstufe I. Es wurde untersucht, wie Inter*sexualität und Trans*gender in diesen Materialien repräsentiert werden und ob heteronormative Strukturen vorhanden sind.
Welche konkreten Fragen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Repräsentation von Inter* und Trans*Personen in Unterrichtsmaterialien, die Übereinstimmung von Unterrichtskonzepten mit den Prinzipien der Queer Theory, heteronormative Strukturen in den Konzepten, sowie Lösungsansätze für eine inklusive Sexualerziehung und den aktuellen Forschungsstand und die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen Diskrepanzen zwischen der Theorie (z.B. Queer Theory und Inklusion) und der Praxis der Sexualerziehung in NRW auf. Es wurden Defizite in der Berücksichtigung von Inter* und Trans*Personen in den untersuchten Materialien festgestellt.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt unter anderem die Entwicklung eines neutralen Begriffsinventars für die Benennung von Personen vor, um eine inklusive und diskriminierungsfreie Sprache in der Sexualerziehung zu fördern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Abstract, eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund, eine Darstellung des Forschungsstandes und eine Hinführung zur Pädagogik, eine Analyse vorherrschender Unterrichtskonzepte in NRW, und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inter*sexualität, Trans*gender, Queer Theory, Gender Studies, Sexualerziehung, Heteronormativität, Inklusion, Unterrichtskonzepte, NRW, Sekundarstufe I, Bildungsstandards, Diskriminierung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende, Pädagogen, Bildungspolitiker, Forscher im Bereich der Gender Studies und Queer Theory, sowie alle, die sich für eine inklusive und diskriminierungsfreie Sexualerziehung einsetzen.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Link zur Arbeit einfügen].
- Arbeit zitieren
- Ella Zemke (Autor:in), 2018, Transgender und Intersexualität als Themen des Biologieunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448263