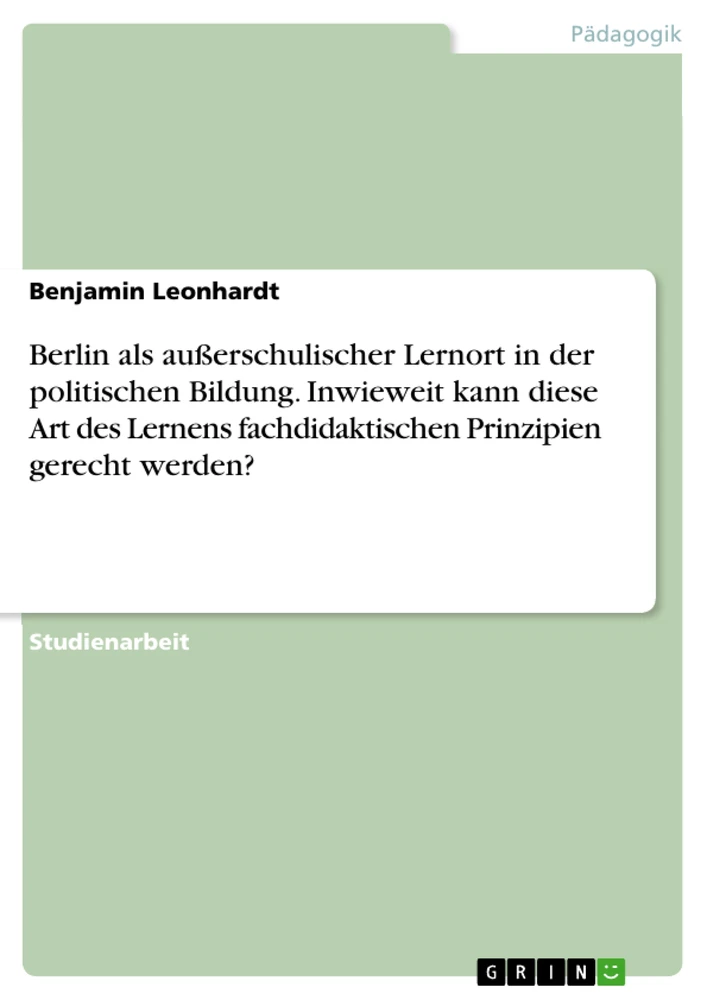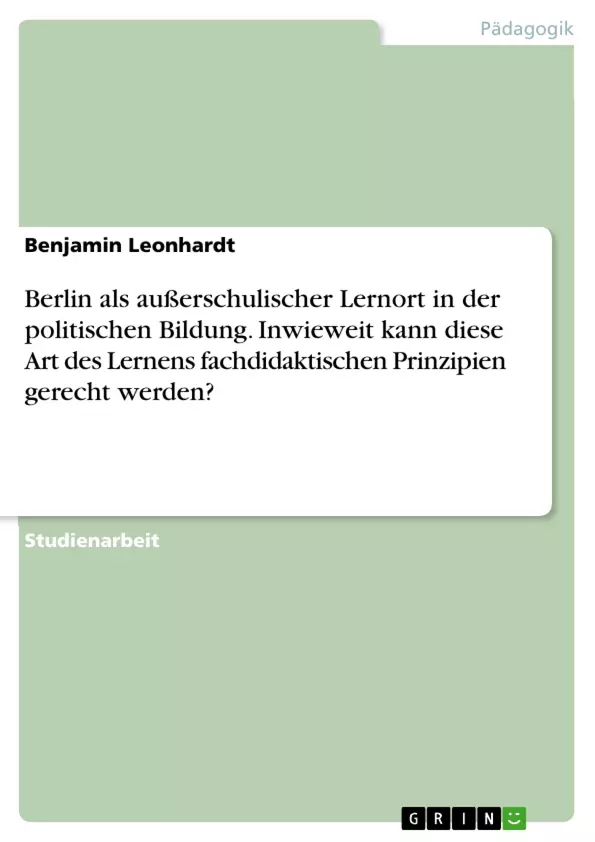Der Bundespräsident a.D. Richard von Weizäcker beschreibt die deutsche Hauptstadt in seiner Ansprache zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt am 29. Juni 1990 in der Nikolaikirche mit den folgenden Worten: „Zu den Zierden Deutschlands gehören seine Städte. Unter ihnen ist Berlin weder die älteste noch die schönste. Unerreicht aber ist seine Lebendigkeit. Stets hat es die Chancen zu materieller und geistiger Blüte ebenso entschlossen genutzt, wie es seine Vitalität gerade in Zeiten schwerster Belastung bewiesen hat.“
Berlin stellt somit kulturell, historisch sowie politisch eine hoch interessante und spannende Stadt dar, die einen Besuch mehr als Wert. Mit rund 31 Millionen Übernachtungen im Jahr 2016 ist Berlin die meistbesuchte deutsche Stadt überhaupt. Neben vielen Touristen, welche dort ihren Urlaub verbringen, wird die Stadt auch als Ziel für Exkursionen von Schulklassen genutzt. Aus unterschiedlichen Beweggründen kann sich eine Fahrt nach Berlin mit verschiedenen Unterrichtsfächern (z.B. Sozialkunde, Geschichte oder Deutsch) sehr lohnen, zum Wissenserwerb von jungen Menschen beitragen und in den Unterricht integriert werden. Aus Sicht der politischen Bildung sind sicherlich der Bundestag, das Kanzleramt und andere wichtige Zentren der Macht zu nennen, welche in den Fokus einer solchen Exkursion rücken können. Neben diesen politischen Themen bietet Berlin auch aufgrund seiner besonderen Geschichte viele Anknüpfungspunkte für den Sozialkundeunterricht. Auf diese Lebendigkeit und Vitalität bezieht sich wohl auch Richard von Weizäcker in seinem Zitat.
In meiner Arbeit soll es darum gehen, herauszufinden, inwieweit Berlin als außerschulischer Lernort zum Wissenszuwachs von Jugendlichen beitragen kann. Dabei wird es darum gehen, ob diese Lernform in Berlin den gängigen fachdidaktischen Prinzipien und somit einem modernen Politikunterricht gerecht werden kann. Dabei wird darauf eingegangen, welche Prinzipien hierbei einen besonderen Stellenwert einnehmen und welche nur bedingt erfüllt werden können. Konkret werde ich dies anhand von Expertengesprächen, welche im Rahmen einer Berlinexkursion im Sommer 2018 geführt wurden, analysieren und bewerten. Des Weiteren geht es mir darum zu erörtern welche Chancen und Risiken solche Gespräche im Allgemeinen mit sich bringen und was von Lehrkräften dabei zu beachten ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Theorie des außerschulischen Lernens
- 2.1 Möglichkeiten und Chancen außerschulischer Lernorte für den modernen Politikunterricht
- 2.2 Kritik an der außerschulischen Bildung
- 3. Die didaktischen Prinzipien im Überblick
- 3.1 Bedeutung, Nutzen und Anwendung fachdidaktischer Prinzipien
- 3.2 Die wichtigsten fachdidaktischen Prinzipien zusammengefasst
- 4. Unterrichtsmethoden in der politischen Bildung
- 4.1 Die handlungsorientierten Methoden im Politikunterricht
- 4.2 Was ist eine Expertenbefragung
- 5. Kritische Analyse exemplarischer Expertengespräche
- 5.1 Eine Diskussion mit einem Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion
- 5.2 Ein Besuch in der russischen Botschaft
- 5.3 Austausch mit Vertretern der Rüstungslobby (BDSV)
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Berlin als außerschulischer Lernort zum Wissenszuwachs von Jugendlichen im Politikunterricht beiträgt und ob diese Lernform gängigen fachdidaktischen Prinzipien gerecht wird. Die Analyse basiert auf Expertengesprächen, die im Rahmen einer Exkursion geführt wurden.
- Außerschulisches Lernen und seine Theorie
- Fachdidaktische Prinzipien im Politikunterricht
- Methoden der Expertenbefragung
- Analyse von Expertengesprächen in Berlin
- Chancen und Risiken außerschulischer Lernorte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Beitrag Berlins als außerschulischer Lernort zum Wissenszuwachs von Jugendlichen im Politikunterricht und der Übereinstimmung mit fachdidaktischen Prinzipien. Sie beschreibt den Ansatz der Arbeit, der auf der Analyse von Expertengesprächen während einer Exkursion beruht, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Die Theorie des außerschulischen Lernens: Dieses Kapitel definiert außerschulisches Lernen und beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Begriff. Es werden die Möglichkeiten und Chancen außerschulischer Lernorte im Politikunterricht, insbesondere die Vorteile des direkten Kontakts mit Lerngegenständen und die aktive Beteiligung der Lernenden, herausgestellt. Gleichzeitig werden kritische Aspekte und mögliche Risiken angesprochen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung. Die unterschiedlichen Kategorien außerschulischer Lernorte, wie von Messmer beschrieben (Orte originaler Begegnung vs. künstliche Lernorte), werden erläutert.
3. Die didaktischen Prinzipien im Überblick: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung, den Nutzen und die Anwendung fachdidaktischer Prinzipien im Politikunterricht. Es fasst die wichtigsten Prinzipien zusammen, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage für die Analyse der Expertengespräche dienen. Die Kapitel beschreiben die Kriterien, an denen die Wirksamkeit des außerschulischen Lernens in Berlin gemessen wird.
4. Unterrichtsmethoden in der politischen Bildung: Das Kapitel widmet sich den Unterrichtsmethoden in der politischen Bildung, mit besonderem Fokus auf handlungsorientierte Methoden. Es erläutert die Methode der Expertenbefragung und ihre Besonderheiten, um das Verständnis für den methodischen Ansatz der empirischen Untersuchung zu liefern. Die Kapitel bereiten den Leser auf die darauffolgende Analyse der Expertengespräche vor.
5. Kritische Analyse exemplarischer Expertengespräche: In diesem Kapitel werden die Expertengespräche mit einem AfD-Bundestagsabgeordneten, Vertretern der Rüstungslobby und dem Pressebeauftragten der russischen Botschaft analysiert. Die Analyse bewertet die jeweiligen Chancen und Risiken der Gespräche für den Wissenserwerb der Jugendlichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Anwendung der im vorherigen Kapitel beschriebenen fachdidaktischen Prinzipien und der Untersuchung, welche Prinzipien besonders gefördert wurden und welche weniger berücksichtigt wurden. Die Analyse sucht nach Überschneidungen in den Prinzipien und ob sich Prinzipien identifizieren lassen, die durch diese Lernform besonders effektiv vermittelt werden können.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, Politische Bildung, Berlin, Expertengespräche, Fachdidaktische Prinzipien, Politikunterricht, Wissenszuwachs, Methodenanalyse, AfD, Rüstungslobby, Russland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Außerschulisches Lernen im Politikunterricht in Berlin
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Beitrag Berlins als außerschulischen Lernorts zum Wissenszuwachs von Jugendlichen im Politikunterricht. Der Fokus liegt darauf, ob diese Lernform gängigen fachdidaktischen Prinzipien entspricht. Die Analyse basiert auf Expertengesprächen, die im Rahmen einer Exkursion geführt wurden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorie des außerschulischen Lernens, fachdidaktische Prinzipien im Politikunterricht, Methoden der Expertenbefragung, die Analyse von Expertengesprächen in Berlin (mit Vertretern der AfD, der Rüstungslobby und der russischen Botschaft) sowie die Chancen und Risiken außerschulischer Lernorte.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die zentrale Methode ist die Analyse von Expertengesprächen, die während einer Exkursion in Berlin geführt wurden. Diese Gespräche werden im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit fachdidaktischen Prinzipien untersucht.
Welche Experten wurden befragt?
Expertengespräche fanden mit einem Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion, Vertretern der Rüstungslobby (BDSV) und einem Vertreter der russischen Botschaft statt.
Welche fachdidaktischen Prinzipien spielen eine Rolle?
Die Arbeit beschreibt und wendet wichtige fachdidaktische Prinzipien im Politikunterricht an, um die Wirksamkeit des außerschulischen Lernens in Berlin zu beurteilen. Die konkreten Prinzipien werden im Kapitel 3 detailliert erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorie des außerschulischen Lernens, Didaktische Prinzipien, Unterrichtsmethoden, Analyse exemplarischer Expertengespräche und Fazit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen die Chancen und Risiken von Expertengesprächen als außerschulische Lernmethode auf. Die Analyse bewertet, inwieweit die Gespräche den fachdidaktischen Prinzipien entsprechen und welche Prinzipien besonders gefördert oder weniger berücksichtigt wurden. Die Arbeit untersucht auch, ob sich bestimmte Prinzipien durch diese Lernform besonders effektiv vermitteln lassen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet den Beitrag Berlins als außerschulischen Lernorts für den Politikunterricht. Es wird eine Einschätzung der Effektivität dieser Lernform im Hinblick auf den Wissenszuwachs und die Anwendung fachdidaktischer Prinzipien gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Außerschulisches Lernen, Politische Bildung, Berlin, Expertengespräche, Fachdidaktische Prinzipien, Politikunterricht, Wissenszuwachs, Methodenanalyse, AfD, Rüstungslobby, Russland.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Leonhardt (Autor:in), 2018, Berlin als außerschulischer Lernort in der politischen Bildung. Inwieweit kann diese Art des Lernens fachdidaktischen Prinzipien gerecht werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448289