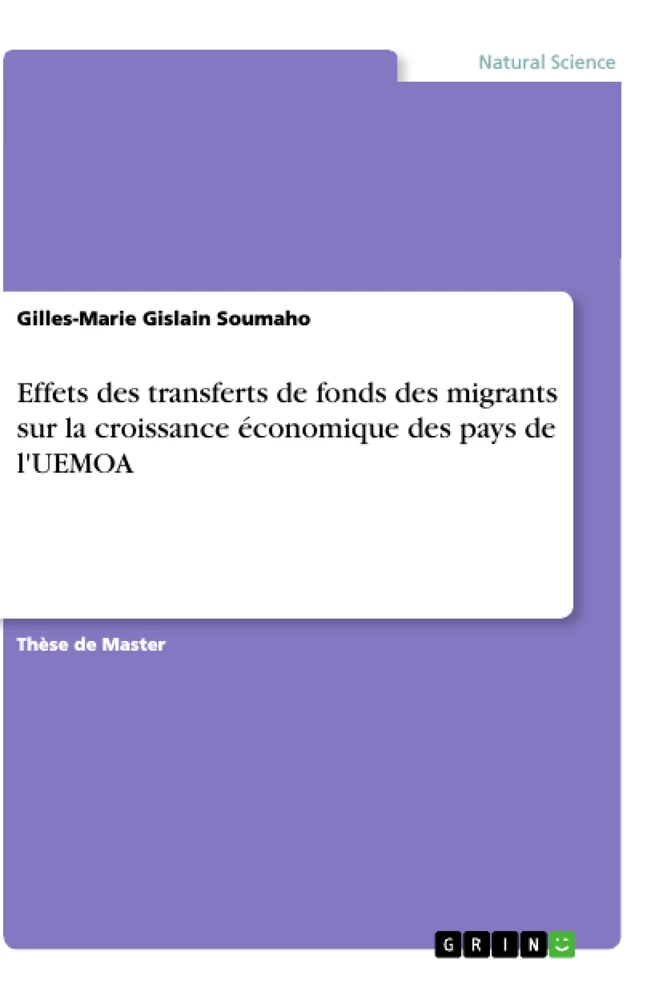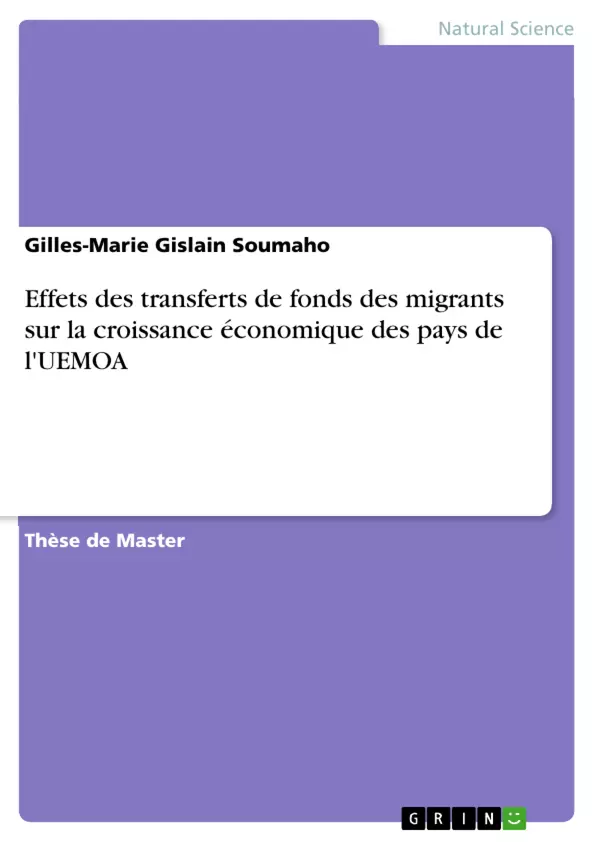Dans ce mémoire, nous avons évalué l’impact des transferts de fonds issus dela migration sur la croissance économique à partir d’un panel des pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), et le rôle de la main d’œuvre étrangère dans la croissance des pays de l’UEMOA, sur la période 2000-2015. Nous avons utilisés un modèle à effets fixes, en utilisant l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires. Nos résultats montrent d’une part que les transferts de fonds ont un impact significatif positif sur la croissance économique. Toutefois, cet impact est moindre, soit une augmentation de 1,8% du niveau de croissance lorsque les transferts de fonds augmentent de 10%. D’autre part, la part de travailleurs étrangers dans la population active impacte négativement la croissance économique des pays concernés. Au vue de ces résultats nous suggérons, dans le but d’améliorer l’impact des transferts, que ces fonds soient investis dans des secteurs productifs. En effet le faible niveau de croissance induit est peut-être dû au fait que les transferts de fonds sont consacrés majoritairement à la consommation exclusive. Les transferts de fonds peuvent continuer de croître, sans investissement dans les secteurs productifs, ils ne pourront pas avoir un impact signifiant sur la croissance économique.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction générale
- Revue de littérature
- Les différentes causes de la migration
- Causes et impact des transferts de fonds
- Approche microéconomique
- Approche macroéconomique
- Travaux empiriques
- Méthodologie
- Modèle de croissance de Solow
- Spécification du modèle
- Données et Variables du modèle
- Résultats et Discussions
- Provenance géographique des transferts de fonds reçus
- Utilisation des transferts de fonds reçus
- Analyse descriptive des variables
- Résultats économétriques
- Tests de spécification
- Analyse économique des résultats de l’estimation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Papier analysiert die Auswirkungen von Überweisungen auf das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Währungsunion Westafrikas. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung der Beziehung zwischen Überweisungen und Wirtschaftswachstum sowie auf der Rolle der ausländischen Arbeitskräfte im Wirtschaftswachstum der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA).
- Bewertung des Einflusses von Überweisungen auf das Wirtschaftswachstum.
- Analyse der Bedeutung der ausländischen Arbeitskräfte in der UEMOA.
- Ermittlung der Auswirkungen von Überweisungen auf die Wirtschaftswachstumspotenziale der Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion.
- Identifizierung der Schlüsselfaktoren, die die Beziehung zwischen Überweisungen und Wirtschaftswachstum beeinflussen.
- Bewertung der politischen Implikationen der Ergebnisse für die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums in der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Literaturübersicht. Es beleuchtet die verschiedenen Ursachen für die Migration, das theoretische Verhältnis zwischen Überweisungen und Wirtschaftswachstum sowie einige empirische Studien zum Einfluss von Überweisungen auf das Wirtschaftswachstum.
- Kapitel 2 stellt die Methodik vor, die den verwendeten Modellansatz sowie die verschiedenen Variablen erläutert. Außerdem werden die theoretischen Grundlagen unseres Modellansatzes diskutiert.
- Kapitel 3 widmet sich der Präsentation und Diskussion der Ergebnisse der Analyse. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden im letzten Teil des Kapitels dargestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Migration, Überweisungen, Wirtschaftswachstum, Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), Ökonometrie, Panel-Datenanalyse, Kapitalbildung, Handelsoffenheit, ausländische Arbeitskräfte und Politikimplikationen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben Überweisungen von Migranten auf das Wirtschaftswachstum in der UEMOA?
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten positiven Einfluss, wobei eine Steigerung der Überweisungen um 10 % zu einem Wachstum von etwa 1,8 % führt.
Wie wirken sich ausländische Arbeitskräfte auf die Wirtschaft der UEMOA-Länder aus?
Die Studie stellt fest, dass der Anteil ausländischer Arbeitnehmer an der Erwerbsbevölkerung einen negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in den untersuchten Ländern hat.
Warum ist der Wachstumseffekt der Überweisungen relativ gering?
Ein Hauptgrund könnte sein, dass die Gelder überwiegend für den Konsum verwendet werden, anstatt in produktive Sektoren investiert zu werden.
Welcher Zeitraum wurde in dieser Untersuchung analysiert?
Die ökonometrische Analyse basiert auf Panel-Daten der Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA) aus dem Zeitraum 2000 bis 2015.
Welche methodischen Ansätze wurden für die Studie verwendet?
Es wurde ein Modell mit festen Effekten (Fixed Effects) unter Verwendung der Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares) angewandt.
Welche politischen Empfehlungen gibt die Arbeit?
Es wird empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Überweisungen verstärkt in produktive Investitionen zu lenken, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.
- Citar trabajo
- Gilles-Marie Gislain Soumaho (Autor), 2018, Effets des transferts de fonds des migrants sur la croissance économique des pays de l'UEMOA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448449