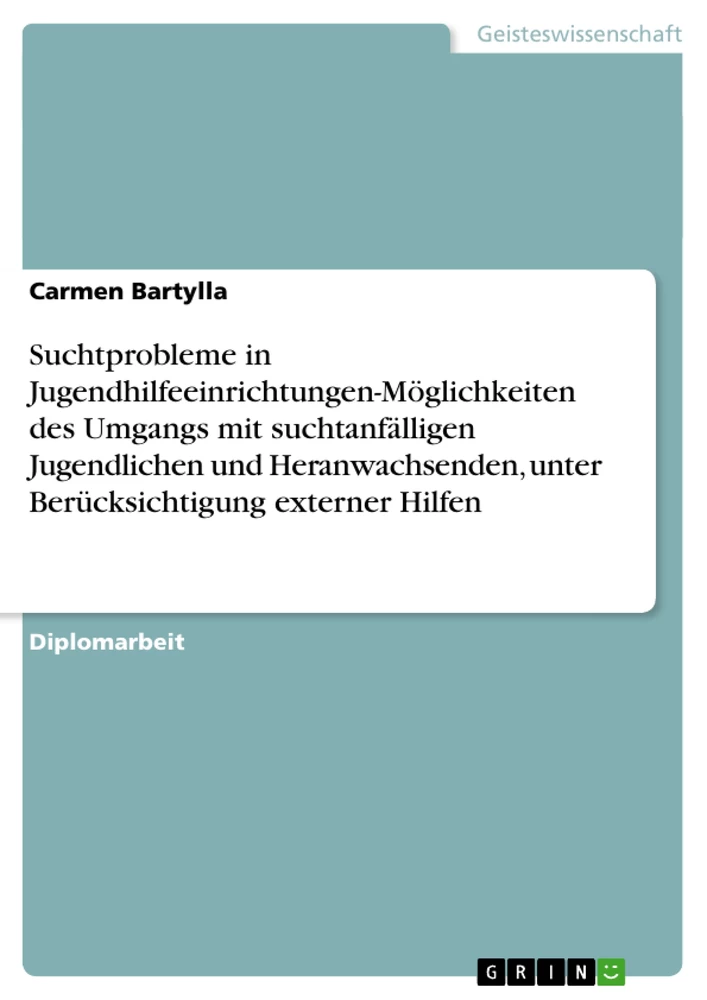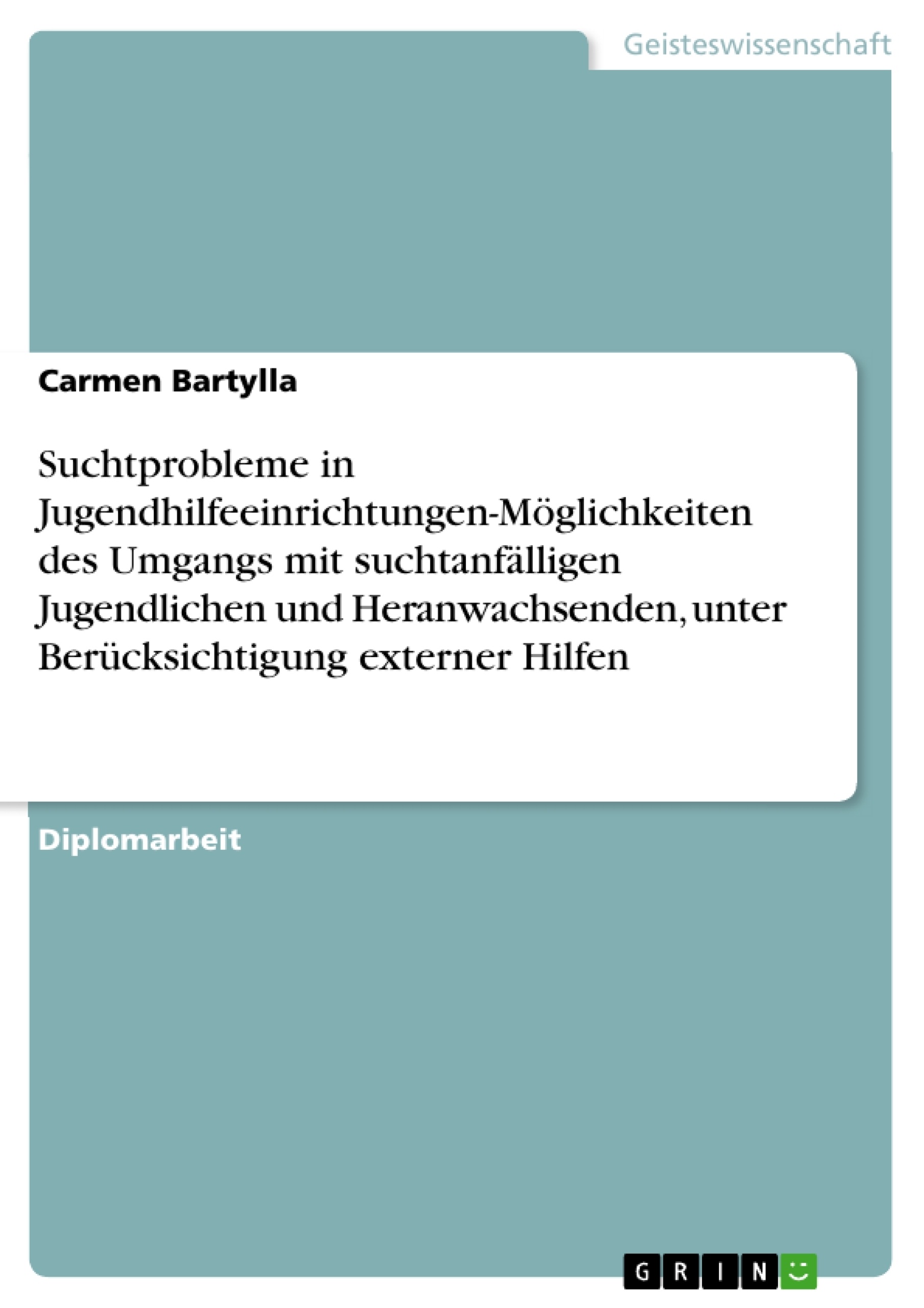In Deutschland nutzten im Jahr 2001 24,8 Millionen Menschen das Internet. Das sind 38,8 Prozent der Deutsch sprechenden Bevölkerung ab 14 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr nutzen damit 36 % mehr Menschen das Internet.
Zu dieser großen Zahl von Nutzern gehören auch Kinder und Jugendliche, da besonders junge Menschen dem Internet aufgeschlossen und neugierig begegnen und die vielfältigen Möglichkeiten, die in ihm geboten werden für sich nutzen möchten. Es gibt Internetseiten zu vielen ihrer Interessen, sei es Schule, Hobbys, Spiele oder andere aktuelle Neuigkeiten. Über Kinderportale können die Kinder Informationen zu speziell ausgewählten Themen finden und erste Versuche mit Chat und E-Mail durchführen.
Doch wie bei den traditionellen Medien, wie Buch, Fernsehen und Video, gibt es auch im Internet Inhalte, vor denen Kinder und Jugendliche geschützt werden müssen. Inhalte, von denen die Eltern nicht möchten, das sie die Kinder in die Hand bekommen, aber auch solche, die als jugendgefährdend und sogar verfassungsfeindlich eingestuft werden. Längst ist bekannt, dass das liberale Internet auch Anbietern unseriöser Inhalte eine Platt-form bietet; dass bei der Suche nach pornographischem Material eine Vielzahl von Webseiten gefunden werden, bei denen man, teilweise kostenlos, pornographische Bilder und Filme herunterladen kann. Die gezielte Suche nach verfassungsfeindlichem Material, wie Kinderpornographie oder rechtsextremistischen Inhalten, gestaltet sich da schon schwieriger, aber hat man einmal eine solches Angebot gefunden, ist es relativ einfach, über angegebene Links weitere Internetseiten dieser Art zu finden.
In dieser Arbeit sollen einige Mechanismen zum Jugendschutz im Internet vorgestellt und auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Dazu werde ich zunächst im zweiten Kapitel einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Internet und über seinen groben Aufbau geben. In diesem Zusammenhang soll die Kontrollproblematik beschrieben werden, die sich durch den technischen Aufbau des Internet ergibt, sowie ihre Relevanz für den Jugendschutz. Nach diesem kurzen Überblick wende ich mich den staatlichen Jugendschutzbestimmungen, also den gesetzlichen Grundlagen des Jugendmedienschutzes, in Deutschland zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begründung der Themenwahl
- Zielsetzungen und Fragestellungen
- Methodik des Vorgehens
- Begriffsbestimmung
- Definition
- Abgrenzung Sucht – süchtiges Verhalten
- Abgrenzung Konsum – Missbrauch – Abhängigkeit
- Überblick über stoffgebundene Süchte
- legale Drogen
- illegale Drogen
- Lebensphase Jugend
- Psychologische Kriterien zur Abgrenzung der Lebensphase Jugend
- Soziologische Kriterien zur Abgrenzung der Lebensphase Jugend
- Risikoverhalten im Jugendalter
- Erklärungsansätze für die Entstehung von Sucht
- Die Suchttheorien
- Biologische Suchttheorien
- Nichtbiologische Suchttheorien
- Lern- und Verhaltenstheorien
- Psychodynamische Theorien
- Multifaktorielles Modell der Suchtentstehung (Suchtdreieck)
- Die Droge
- Das Individuum
- Das lebensweltliche Umfeld
- Der Bereich Familie
- Die Bedeutung von Peers
- Der Bereich Schule
- Verhaltenstherapie orientiert an Lern- und Verhaltenstheorien
- Begriffsbestimmung
- Allgemeine Verhaltens- und Problemanalyse nach dem SORC(K)-Schema
- Verhaltens- und Problemanalyse am Beispiel des Alkoholismus
- Suchtprobleme in Jugendhilfeeinrichtungen
- Rechtliche Aspekte in der Jugendhilfe
- Strafbares Verhalten des pädagogischen Personals
- Drogenscreening
- Strafverfahren
- Zum Bewältigungsverhalten im L.
- Anlage des Fragebogens
- Auswahl der Probanden
- Aufbereitung und Auswertung des Fragebogens
- Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- Bewertung der Ergebnisse vor dem theoretischen Hintergrund
- Möglichkeiten suchtpräventiver Tätigkeiten in den Jugendhilfeeinrichtungen
- Begriffsbestimmung
- Grundsätze der Suchtprävention
- Ansatzpunkte für Prävention orientiert am multifaktoriellen Modell der Suchtentstehung
- Hilfen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
- Suchtprävention über die Förderung von Lebenskompetenzen
- Suchtspiele als präventive Methode
- Möglichkeiten intervenierender Tätigkeiten in den Jugendhilfeeinrichtungen
- Interventionsmethoden auf verhaltenstherapeutischer Basis
- Aufbau von Lebenskompetenzen
- Selbstkontrolle bei Jugendlichen und Heranwachsenden
- Umsetzung eines Belohnungssystems
- Klientenzentrierte Gesprächsführung als Interventionsmethode
- Einbindung der Methoden am Beispiel des Rauchens
- Kooperation der einzelnen Hilfesysteme
- Kooperation Jugendhilfeeinrichtung Ù Drogenhilfe
- Die Suchtkrankenhilfe
- Zur Rolle beider Hilfesysteme
- „Tandem“ als Kooperationsprinzip
- Kooperation Jugendhilfeeinrichtung Ù Jugendamt
- Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
- Hilfeplanung
- Kooperation Jugendhilfeeinrichtung Ù Schule
- Der Lehrer als Vorbild
- Schulische Methoden zum Aufbau von Lebenskompetenzen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Möglichkeiten des Umgangs mit suchtanfälligen Jugendlichen und Heranwachsenden in Jugendhilfeeinrichtungen, unter Berücksichtigung externer Hilfen. Das Hauptziel ist es, den Zusammenhang zwischen Lebenskompetenzen und dem Umgang mit legalen und illegalen Drogen aufzuzeigen und präventive sowie intervenierende Konzepte im Kontext der Jugendhilfe zu entwickeln.
- Zusammenhang zwischen Lebenskompetenzen und Drogenkonsum
- Präventive Maßnahmen in der Jugendhilfe
- Intervenierende Maßnahmen bei bestehendem Konsum
- Relevanz externer Hilfesysteme
- Rechtliche Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit begründet die Themenwahl mit dem steigenden Bedarf an Suchtberatung im Landkreis Kamenz und fokussiert auf stoffgebundene Süchte in Jugendhilfeeinrichtungen. Sie formuliert Forschungsfragen zum Einfluss der Jugendhilfe auf Suchtmittelkonsum, zur Förderung von Lebenskompetenzen und zur Nutzung externer Hilfen. Die Methodik umfasst die Definition von Suchtbegriffen, die Analyse der Jugendphase und die Erörterung von Suchttheorien, gefolgt von der Vorstellung von präventiven und intervenierenden Konzepten.
Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von Sucht und süchtigem Verhalten, grenzt diese von Konsum und Missbrauch ab und beschreibt die Kriterien der Abhängigkeit nach WHO. Es folgt ein Überblick über legale (Nikotin, Alkohol) und illegale Drogen (Cannabis, Amphetamine/Ecstasy, Kokain, Schnüffelstoffe), inklusive Wirkung und Risiken.
Lebensphase Jugend: Die Lebensphase Jugend wird anhand psychologischer und soziologischer Kriterien analysiert. Psychologisch betrachtet, wird die Adoleszenz durch die Pubertät, die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und den Identitätsaufbau geprägt. Soziologisch wird der fließende Übergang vom Kind zum Erwachsenen und die Herausforderungen der Statuspassage beleuchtet. Risikoverhalten im Jugendalter wird als Folge unzureichender Bewältigungskompetenzen und sozialer Ressourcen beschrieben.
Erklärungsansätze für die Entstehung von Sucht: Verschiedene Suchttheorien werden vorgestellt, darunter biologische Ansätze (Belohnungssystem) und nichtbiologische Ansätze, wie Lern- und Verhaltenstheorien (klassisches und operantes Konditionieren) sowie psychodynamische Theorien (Störungen der Persönlichkeitsentwicklung). Das multifaktorielle Modell der Suchtentstehung (Suchtdreieck) integriert biologische, individuelle und soziale Faktoren.
Verhaltenstherapie orientiert an Lern- und Verhaltenstheorien: Dieses Kapitel erläutert die Grundlagen der Verhaltenstherapie, die auf dem Prinzip des Lernens basiert. Die Verhaltens- und Problemanalyse nach dem SORC(K)-Schema wird detailliert beschrieben, um problematisches Verhalten zu analysieren und Interventionsmöglichkeiten abzuleiten, am Beispiel des Alkoholismus veranschaulicht.
Suchtprobleme in Jugendhilfeeinrichtungen: Der Abschnitt beleuchtet rechtliche Aspekte des Umgangs mit Sucht in der Jugendhilfe, insbesondere strafbare Handlungen des pädagogischen Personals, Drogenscreening und Strafverfahren im Kontext des Betäubungsmittelgesetzes. Eine empirische Untersuchung des Bewältigungsverhaltens in zwei Jugendhilfeeinrichtungen wird vorgestellt und interpretiert, wobei die Ergebnisse hinsichtlich personaler und sozialer Ressourcen sowie Copingstrategien diskutiert werden.
Möglichkeiten suchtpräventiver Tätigkeiten in den Jugendhilfeeinrichtungen: Dieses Kapitel definiert Suchtprävention (primär, sekundär, tertiär) und beschreibt Grundsätze zeitgemäßer Suchtprävention, die auf dem multifaktoriellen Modell basiert. Ansatzpunkte für Prävention werden in Bezug auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und die Förderung von Lebenskompetenzen (Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz) erörtert. Suchtspiele werden als präventive Methode vorgestellt.
Möglichkeiten intervenierender Tätigkeiten in den Jugendhilfeeinrichtungen: Der Abschnitt beschreibt Interventionsmethoden auf verhaltenstherapeutischer Basis, darunter der Aufbau von Lebenskompetenzen durch Gruppenstunden, Rollenspiele und Projekttage, Selbstkontrolle durch Verhaltensverträge und die Umsetzung eines Belohnungssystems mit Wertmarken. Die klientenzentrierte Gesprächsführung wird als Kommunikationsmethode vorgestellt und am Beispiel des Rauchens angewendet.
Kooperation der einzelnen Hilfesysteme: Das Kapitel behandelt die Kooperation zwischen Jugendhilfeeinrichtungen und Drogenhilfe, wobei die Tandemstruktur als effizientes Modell vorgestellt wird. Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Jugendamt im Kontext des KJHG und die Hilfeplanung werden erläutert. Die Zusammenarbeit mit Schulen, die Vorbildfunktion von Lehrern und schulische Methoden zur Lebenskompetenzförderung werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Sucht, Jugendhilfe, Drogenprävention, Interventionsmethoden, Verhaltenstherapie, Lebenskompetenzen, multifaktorielles Modell, SORC(K)-Schema, Kooperation, Hilfeplanung, Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelgesetz, Copingstrategien, Selbstkontrolle, Wertmarken, klientenzentrierte Gesprächsführung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Suchtprävention und -intervention in der Jugendhilfe
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht den Umgang mit suchtanfälligen Jugendlichen und Heranwachsenden in Jugendhilfeeinrichtungen. Sie fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Lebenskompetenzen und dem Konsum legaler und illegaler Drogen und entwickelt präventive sowie intervenierende Konzepte im Kontext der Jugendhilfe unter Berücksichtigung externer Hilfen.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Jugendhilfe auf den Suchtmittelkonsum, die Förderung von Lebenskompetenzen und die Nutzung externer Hilfesysteme. Sie beleuchtet auch die rechtlichen Rahmenbedingungen im Umgang mit Sucht in der Jugendhilfe.
Welche Suchttheorien werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl biologische Suchttheorien (z.B. Belohnungssystem) als auch nichtbiologische Ansätze wie Lern- und Verhaltenstheorien (klassisches und operantes Konditionieren) und psychodynamische Theorien (Störungen der Persönlichkeitsentwicklung). Das multifaktorielle Modell der Suchtentstehung (Suchtdreieck) wird als integrativer Ansatz vorgestellt.
Welche Methoden der Prävention werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt Grundsätze zeitgemäßer Suchtprävention, die auf dem multifaktoriellen Modell basieren. Ansatzpunkte für Prävention werden in Bezug auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und die Förderung von Lebenskompetenzen (Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz) erörtert. Suchtspiele werden als präventive Methode vorgestellt.
Welche Interventionsmethoden werden vorgestellt?
Es werden Interventionsmethoden auf verhaltenstherapeutischer Basis beschrieben, wie der Aufbau von Lebenskompetenzen, Selbstkontrolle durch Verhaltensverträge und Belohnungssysteme. Die klientenzentrierte Gesprächsführung wird als Kommunikationsmethode vorgestellt und am Beispiel des Rauchens angewendet.
Welche Rolle spielen externe Hilfesysteme?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Kooperation zwischen Jugendhilfeeinrichtungen und anderen Hilfesystemen wie Drogenhilfe, Jugendamt und Schulen. Die Tandemstruktur zwischen Jugendhilfe und Drogenhilfe wird als effizientes Modell vorgestellt. Die Hilfeplanung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) wird ebenfalls erläutert.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet rechtliche Aspekte des Umgangs mit Sucht in der Jugendhilfe, einschließlich strafbarer Handlungen des pädagogischen Personals, Drogenscreening und Strafverfahren im Kontext des Betäubungsmittelgesetzes.
Welche empirischen Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung des Bewältigungsverhaltens in zwei Jugendhilfeeinrichtungen. Es wird ein Fragebogen eingesetzt, dessen Anlage, Auswahl der Probanden, Aufbereitung und Auswertung detailliert beschrieben werden. Die Ergebnisse werden dargestellt und vor dem theoretischen Hintergrund interpretiert.
Welche Definitionen von Sucht werden verwendet?
Die Arbeit liefert präzise Definitionen von Sucht und süchtigem Verhalten und grenzt diese von Konsum und Missbrauch ab. Die Kriterien der Abhängigkeit nach WHO werden berücksichtigt.
Wie wird die Lebensphase Jugend definiert?
Die Lebensphase Jugend wird anhand psychologischer (Pubertät, Entwicklungsaufgaben, Identitätsfindung) und soziologischer Kriterien (Übergang vom Kind zum Erwachsenen, Statuspassage) analysiert. Risikoverhalten im Jugendalter wird als Folge unzureichender Bewältigungskompetenzen und sozialer Ressourcen beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Schlüsselbegriffe sind Sucht, Jugendhilfe, Drogenprävention, Interventionsmethoden, Verhaltenstherapie, Lebenskompetenzen, multifaktorielles Modell, SORC(K)-Schema, Kooperation, Hilfeplanung, Jugendstrafrecht, Betäubungsmittelgesetz, Copingstrategien, Selbstkontrolle, Wertmarken und klientenzentrierte Gesprächsführung.
- Quote paper
- Carmen Bartylla (Author), 2005, Suchtprobleme in Jugendhilfeeinrichtungen-Möglichkeiten des Umgangs mit suchtanfälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, unter Berücksichtigung externer Hilfen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44853