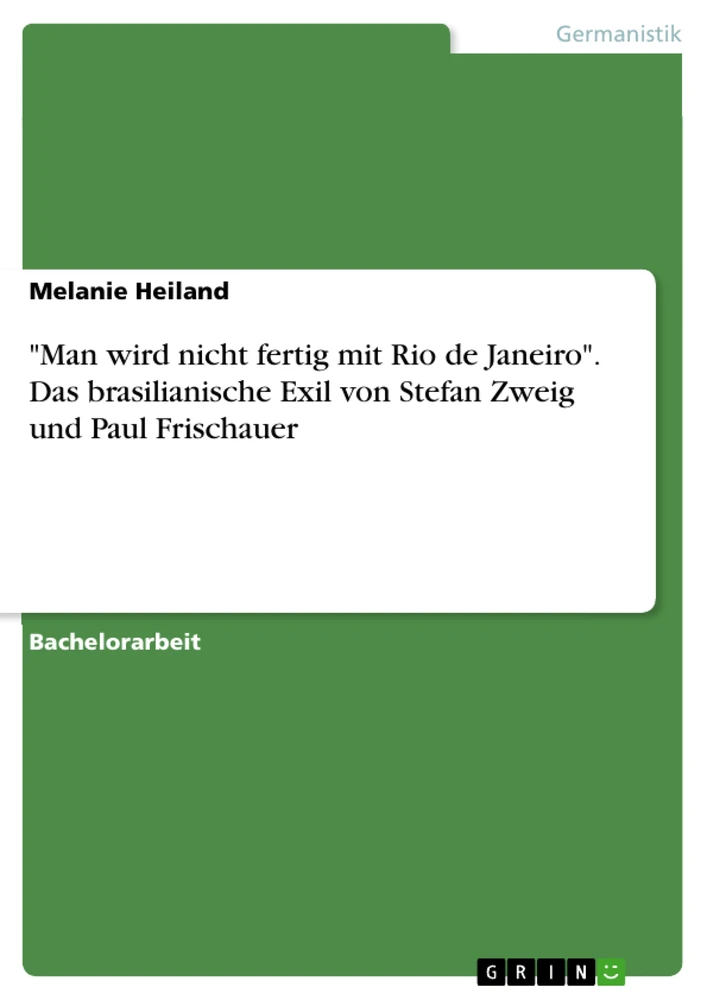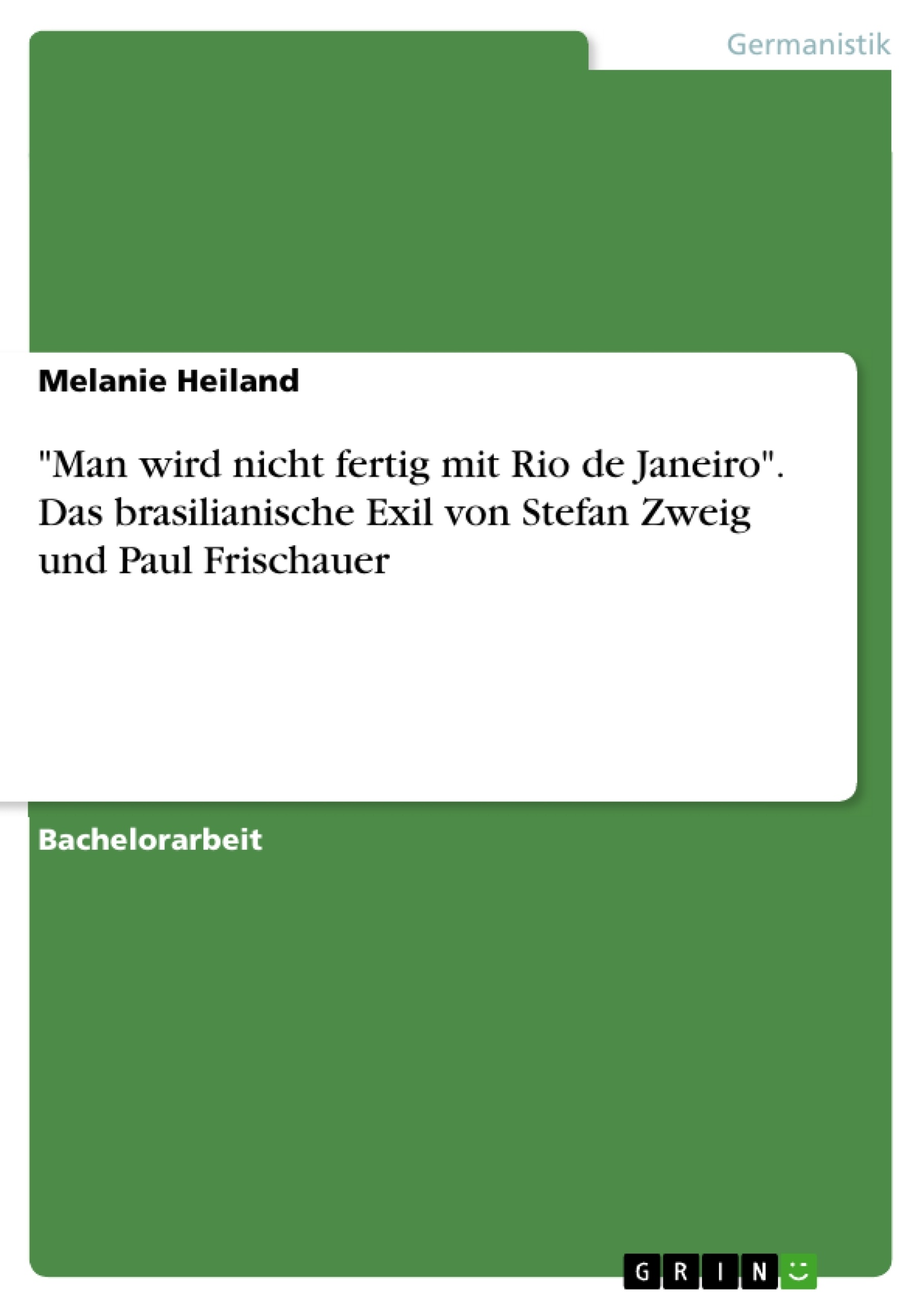Inhalt dieser Arbeit ist das Exil der deutschsprachigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien zwischen 1933 und 1945, das im Hinblick auf seine Bedeutung in politischer und kultureller Hinsicht und vor allem seinen Einfluss auf die deutschsprachige Literatur analysiert werden soll. Dabei werde ich mich im Speziellen auf die Autoren Stefan Zweig und Paul Frischauer konzentrieren, deren Leben und schriftstellerische Tätigkeit stark durch das jeweilige brasilianische Exil geprägt wurden. Alle beide stellen Schlüsselfiguren im Exil der deutschsprachigen Künstler und Künstlerinnen in Brasilien während der Zeit des Nationalsozialismus dar, und sowohl die Biographien als auch die Werke dieser Schriftsteller bieten dementsprechend einige interessante Anhaltspunkte für die Untersuchung dieses Gegenstands.
Um ein besseres Verständnis der politischen und kulturellen Umstände und Zusammenhänge, die Brasilien als Exilland zu dem gemacht haben, was es war, zu gewährleisten, werde ich zunächst einen Überblick über die allgemeine Exilsituation in Lateinamerika im Zeitraum zwischen 1933 und 1945 geben. Ein weiterer Punkt stellt die spezielle politische Lage in Brasilien sowie die Situation der deutschsprachigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen im brasilianischen Exil dar.
Im Anschluss soll am Beispiel der bereits genannten Autoren Stefan Zweig und Paul Frischauer untersucht werden, wie sich die Exilsituation konkret auf das Leben und vor allem das künstlerische Schaffen der Exilanten ausgewirkt hat. Im Vordergrund steht dabei neben der Erörterung der kulturellen, sprachlichen und politischen Bedingungen, unter denen Literatur im brasilianischen Exil entstanden ist, vor allem auch die Frage, inwieweit das Exil die literarische Tätigkeit der Autoren beeinflusst hat und ob bzw. auf welche Weise sich deren Umgebung in diesem Land, das Stefan Zweig in einem seiner wohl berühmtesten Bücher als Land der Zukunft bezeichnet, in den jeweiligen Werken niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Überblick über die Exilsituation in Lateinamerika
- 2.2. Brasilien als Exilland
- 2.2.1. Situation der deutschsprachigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien
- 2.3. Stefan Zweig
- 2.3.1. Biographischer Überblick vor dem brasilianischen Exil
- 2.3.2. Stefan Zweig in Brasilien
- 2.3.3. Schriftstellerische Tätigkeit im brasilianischen Exil
- 2.4. Paul Frischauer
- 2.4.1. Biographische Eckdaten vor und nach dem Exil
- 2.4.2. Paul Frischauer in Brasilien
- 2.4.3. Freundschaft zu Stefan Zweig
- 2.4.4. Schriftstellerische Tätigkeit im Exil: Die Vargas-Biographie
- 2.5. Vergleich: Stefan Zweig und Paul Frischauer – zwei unterschiedliche Persönlichkeiten im Exil
- 3. Resümee
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Exil deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien zwischen 1933 und 1945, insbesondere seinen politischen und kulturellen Einfluss auf die deutschsprachige Literatur. Der Fokus liegt auf Stefan Zweig und Paul Frischauer, deren Leben und Werk stark vom brasilianischen Exil geprägt wurden. Die Arbeit untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten des Exils in Brasilien im Kontext der allgemeinen Exilsituation in Lateinamerika.
- Das deutschsprachige Exil in Lateinamerika im Kontext des NS-Regimes
- Brasilien als Exilland: Politische und kulturelle Bedingungen
- Die Situation deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien
- Der Einfluss des brasilianischen Exils auf das Leben und Werk von Stefan Zweig und Paul Frischauer
- Vergleich der Erfahrungen und literarischen Strategien von Zweig und Frischauer im Exil
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse des Exils deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien (1933-1945), insbesondere den Einfluss auf die deutschsprachige Literatur. Stefan Zweig und Paul Frischauer werden als zentrale Figuren hervorgehoben, deren Biografien und Werke als Grundlage der Untersuchung dienen. Ein Überblick über die Exilsituation in Lateinamerika wird versprochen, um den Kontext zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht, wie sich das Exil auf das literarische Schaffen der Autoren auswirkte und wie sich ihre brasilianische Umgebung in ihren Werken niederschlug.
2.1. Überblick über die Exilsituation in Lateinamerika: Dieses Kapitel bietet einen quantitativen und qualitativen Überblick über die Exilsituation in Lateinamerika zwischen 1933 und 1945. Es zeigt, dass Lateinamerika ein wichtiger Zufluchtsort für deutschsprachige Emigranten war, obwohl es anfänglich nicht die erste Wahl darstellte. Sprachbarrieren, mangelndes Wissen über die lateinamerikanischen Länder und geographische Distanz werden als Gründe genannt. Mexiko und Kuba waren zunächst bevorzugte Ziele, später der "Südgürtel" (Argentinien, Chile, Uruguay, Brasilien). Ab 1938, mit der Expansion des Dritten Reichs und verschärften Einwanderungsbeschränkungen in Europa, erfolgte eine Massenemigration nach Lateinamerika, auch in weniger attraktive Länder.
2.2. Brasilien als Exilland: Das Kapitel beleuchtet die spezifischen Bedingungen des brasilianischen Exils, insbesondere für deutschsprachige Schriftsteller. Es wird die schwierige berufliche Eingliederung der Emigranten thematisiert, besonders im künstlerischen und geisteswissenschaftlichen Bereich aufgrund von Sprachbarrieren und mangelnder Nachfrage. Kulturelle Unterschiede erschwerten die Integration. Die Gründung eines deutschsprachigen Verlags scheiterte, und die Veröffentlichung deutschsprachiger Werke war sehr begrenzt. Politische Gründe werden als Hauptursache für diese Situation angeführt.
Schlüsselwörter
Exilliteratur, Brasilien, Stefan Zweig, Paul Frischauer, Lateinamerika, Nationalsozialismus, deutschsprachiges Exil, politische Emigration, kulturelle Integration, Schriftstellerisches Schaffen, Vargas-Biographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Deutschsprachiges Exil in Brasilien (1933-1945)
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Exil deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien zwischen 1933 und 1945, insbesondere seinen politischen und kulturellen Einfluss auf die deutschsprachige Literatur. Der Schwerpunkt liegt auf den Biografien und Werken von Stefan Zweig und Paul Frischauer.
Welche Autoren stehen im Mittelpunkt der Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Lebensläufe und das literarische Schaffen von Stefan Zweig und Paul Frischauer im brasilianischen Exil. Ihre Erfahrungen und literarischen Strategien werden verglichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Hauptteil mit verschiedenen Unterkapiteln (Überblick über die Exilsituation in Lateinamerika, Brasilien als Exilland, Stefan Zweig im Exil, Paul Frischauer im Exil, Vergleich Zweig/Frischauer), ein Resümee und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Kapitelstruktur.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil untersucht die Exilsituation in Lateinamerika im Allgemeinen, die spezifischen Bedingungen des brasilianischen Exils für deutschsprachige Schriftsteller (einschließlich der Schwierigkeiten der beruflichen und kulturellen Integration), die Biografien von Stefan Zweig und Paul Frischauer vor und während ihres brasilianischen Exils, ihre literarische Tätigkeit im Exil und einen Vergleich ihrer Erfahrungen und literarischen Strategien.
Welche Herausforderungen stellten sich deutschsprachigen Schriftstellern im brasilianischen Exil?
Deutschsprachige Schriftsteller im brasilianischen Exil sahen sich mit Sprachbarrieren, mangelnder Nachfrage nach deutschsprachigen Werken, Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung und kulturellen Unterschieden konfrontiert. Die Gründung eines deutschsprachigen Verlags scheiterte, und die Veröffentlichung deutschsprachiger Werke war sehr begrenzt. Politische Gründe werden als Hauptursache für diese Situation angeführt.
Welche Rolle spielte Brasilien als Exilland?
Brasilien war zwar nicht das erste Wahlziel für viele deutschsprachige Emigranten, wurde aber im Laufe der Zeit, besonders ab 1938, mit zunehmender Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland zu einem wichtigen Zufluchtsort. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen politischen und kulturellen Bedingungen des brasilianischen Exils und deren Einfluss auf die Emigranten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Exil deutschsprachiger Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Brasilien zu analysieren und dessen Einfluss auf deren Leben und Werk aufzuzeigen. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die das brasilianische Exil bot, im Kontext der allgemeinen Exilsituation in Lateinamerika.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Exilliteratur, Brasilien, Stefan Zweig, Paul Frischauer, Lateinamerika, Nationalsozialismus, deutschsprachiges Exil, politische Emigration, kulturelle Integration, Schriftstellerisches Schaffen, Vargas-Biographie.
- Quote paper
- Melanie Heiland (Author), 2012, "Man wird nicht fertig mit Rio de Janeiro". Das brasilianische Exil von Stefan Zweig und Paul Frischauer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448715