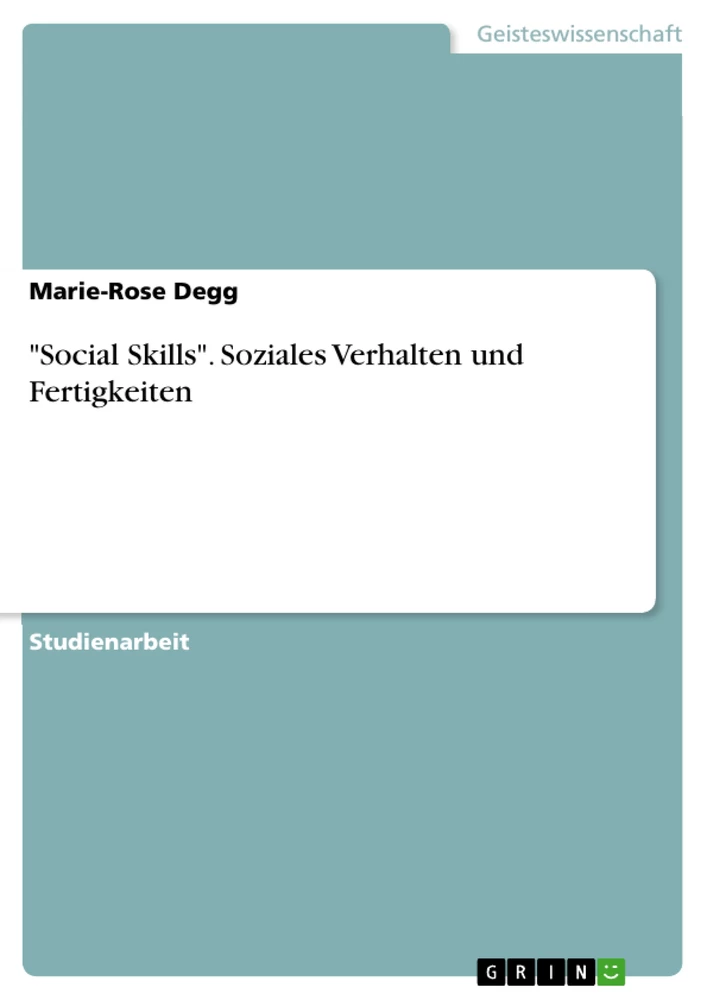Social skills sind Strategien, um alltägliche Aufgaben zu meistern und werden für die kompetente Performanz in akademischen, personellen, beruflichen und gemeinschaftlichen Kontexten benötigt. Je nach Setting sind andere social skills gefragt. Beispielsweise müssen sich Kinder beim Essen auswärts anders verhalten, als wenn sie zu Hause essen.
Nach Hupp, LeBlanc, Jewell, & Warnes (2009) hängen social skills mit akademischem Erfolg, psychologischer Anpassung, Coping-Fähigkeiten und Erwerbstätigkeit zusammen. Kinder, die keine ausreichenden social skills haben, geraten schon in der Schule in Gefahr sozial aufzufallen und hinter den anderen Kindern zurückzubleiben. Defizite in social skills und maladaptives soziales Verhalten sind diagnostische Kriterien für viele Störungen im DSM-IV. Deshalb ist es wichtig social skills frühzeitig zu trainieren, damit dieser Entwicklung entgegengearbeitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziales Verhalten und social skills
- Assessment von social skills
- Social skills-Training
- Social skills und Schule
- Freundschaft
- Peer-Interaktionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht soziales Verhalten und soziale Fertigkeiten (social skills) bei Kindern. Ziel ist es, Definitionen, Assessments und Trainingsmethoden zu beleuchten und deren Anwendung im schulischen Kontext zu diskutieren. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze und kritische Punkte der jeweiligen Methoden.
- Definition und Abgrenzung von sozialem Verhalten und social skills
- Methoden zur Erfassung und Beurteilung von social skills
- Unterschiedliche Ansätze im Social-skills-Training
- Bedeutung von social skills im schulischen Kontext
- Der Einfluss von Freundschaft und Peer-Interaktionen auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema soziale Fertigkeiten (social skills) ein und betont deren Bedeutung für den akademischen, persönlichen und beruflichen Erfolg. Sie hebt die Verbindung zwischen unzureichenden social skills und Schwierigkeiten in der Schule hervor und begründet die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen. Der Zusammenhang mit psychischen Störungen wird kurz angeschnitten, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen.
Soziales Verhalten und social skills: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen von sozialen Fertigkeiten und sozialem Verhalten. Es differenziert zwischen adaptiven social skills und maladaptiven Verhaltensweisen (externalisierende und internalisierende Exzesse). Die Unterscheidung zwischen sozialer Kompetenz als allgemeiner Fähigkeit und spezifischen social skills nach McFall wird erläutert. Verschiedene Kategorisierungen von sozialem Verhalten und social skills-Defiziten (nach Cavell und Gresham) werden vorgestellt und bieten unterschiedliche Perspektiven auf das Thema.
Assessment von social skills: Hier werden zwei gegensätzliche Ansätze zur Beurteilung von social skills vorgestellt: der traditionelle Ansatz, der auf Fremdbeurteilungen (Eltern, Lehrer) und Beobachtungen basiert, und der kontextabhängige Ansatz, der die Ziele und Motivationen des Kindes berücksichtigt. Die Stärken und Schwächen beider Methoden werden kritisch diskutiert, wobei die Limitationen des traditionellen Ansatzes, wie der enge Fokus auf beobachtbare Verhaltensweisen und die Gefahr des Übersehens wichtiger Fertigkeiten, hervorgehoben werden.
Social skills-Training: Dieses Kapitel beschreibt zwei Hauptansätze im Social-skills-Training: den molekularen (behavioralen) Ansatz mit Fokus auf die Erlernung spezifischer Verhaltensweisen und den Prozess-Ansatz, der auf der Entwicklung allgemeiner kognitiver Strategien zur Problemlösung basiert. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze werden diskutiert, wobei die Grenzen der Generalisierung beim molekularen Ansatz und der Mangel an konkretem Verhaltens-Training beim Prozess-Ansatz kritisiert werden. Die Notwendigkeit einer Integration beider Ansätze wird betont.
Schlüsselwörter
Soziale Fertigkeiten, Social Skills, Soziales Verhalten, Assessment, Social Skills Training, Schulischer Kontext, Peer-Interaktionen, Freundschaft, adaptives Verhalten, maladaptives Verhalten, kognitive Strategien, behaviorale Ansätze.
Häufig gestellte Fragen zu: Soziales Verhalten und Social Skills bei Kindern
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit sozialem Verhalten und sozialen Fertigkeiten (social skills) bei Kindern. Sie behandelt Definitionen, Assessments, Trainingsmethoden und deren Anwendung im schulischen Kontext. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze und kritische Punkte der jeweiligen Methoden, einschließlich der Bedeutung von Freundschaft und Peer-Interaktionen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Abgrenzung von sozialem Verhalten und social skills; Methoden zur Erfassung und Beurteilung von social skills; verschiedene Ansätze im Social-skills-Training; Bedeutung von social skills im schulischen Kontext; der Einfluss von Freundschaft und Peer-Interaktionen auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet folgende Kapitel: Einleitung, Soziales Verhalten und social skills, Assessment von social skills, Social skills-Training, Social skills und Schule, Freundschaft, Peer-Interaktionen und Fazit.
Wie werden soziale Fertigkeiten definiert und abgegrenzt?
Die Hausarbeit beleuchtet verschiedene Definitionen von sozialen Fertigkeiten und sozialem Verhalten. Sie differenziert zwischen adaptiven social skills und maladaptiven Verhaltensweisen (externalisierende und internalisierende Exzesse) und erläutert die Unterscheidung zwischen sozialer Kompetenz als allgemeiner Fähigkeit und spezifischen social skills nach McFall. Verschiedene Kategorisierungen von sozialem Verhalten und social skills-Defiziten werden vorgestellt.
Welche Methoden zur Beurteilung von Social Skills werden vorgestellt?
Die Hausarbeit beschreibt zwei gegensätzliche Ansätze: den traditionellen Ansatz (Fremdbeurteilungen, Beobachtungen) und den kontextabhängigen Ansatz (Berücksichtigung der Ziele und Motivationen des Kindes). Die Stärken und Schwächen beider Methoden werden kritisch diskutiert, inklusive der Limitationen des traditionellen Ansatzes.
Welche Ansätze im Social-skills-Training werden beschrieben?
Es werden der molekulare (behaviorale) Ansatz (Fokus auf spezifische Verhaltensweisen) und der Prozess-Ansatz (Entwicklung allgemeiner kognitiver Strategien) beschrieben. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze, inklusive der Grenzen der Generalisierung und des Mangels an konkretem Verhaltens-Training, werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer Integration beider Ansätze wird betont.
Welche Bedeutung haben soziale Fertigkeiten im schulischen Kontext?
Die Hausarbeit hebt die Bedeutung von ausreichenden social skills für den akademischen, persönlichen und beruflichen Erfolg hervor. Sie betont den Zusammenhang zwischen unzureichenden social skills und Schwierigkeiten in der Schule und die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen. Der Zusammenhang mit psychischen Störungen wird kurz angeschnitten.
Welchen Einfluss haben Freundschaft und Peer-Interaktionen?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Freundschaft und Peer-Interaktionen auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Dieser Aspekt wird im Kontext der Gesamtentwicklung sozialer Fertigkeiten beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Fertigkeiten, Social Skills, Soziales Verhalten, Assessment, Social Skills Training, Schulischer Kontext, Peer-Interaktionen, Freundschaft, adaptives Verhalten, maladaptives Verhalten, kognitive Strategien, behaviorale Ansätze.
- Quote paper
- Marie-Rose Degg (Author), 2014, "Social Skills". Soziales Verhalten und Fertigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448873