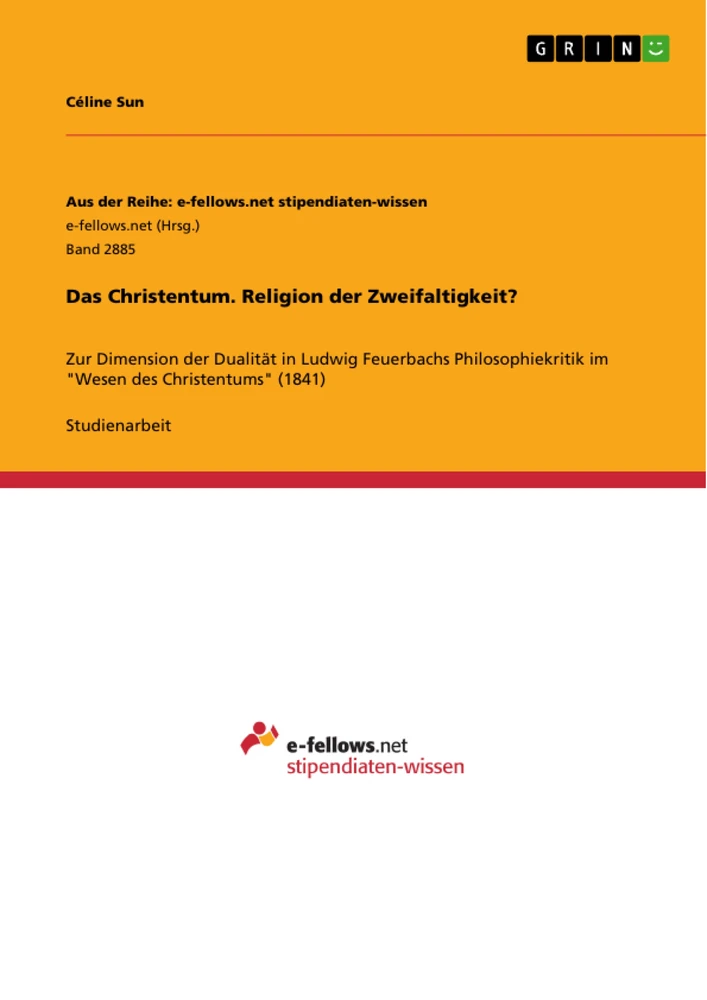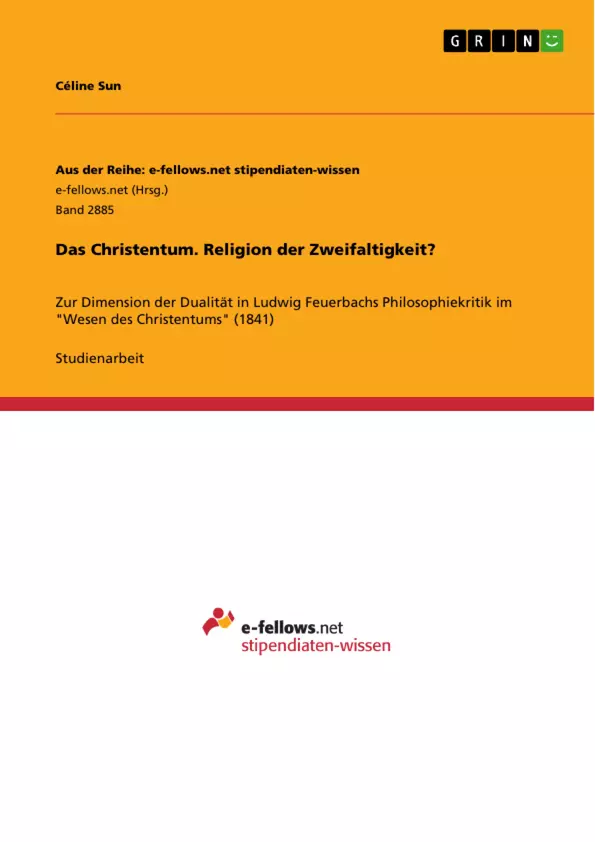Wenn auch der Religionskritik Feuerbachs heutzutage vor allem in der theologischen Gemeinschaft Interesse widerfährt und die größte Bedeutung der rein religionskritischen Dimension des Werkes beigemessen wird, so war Feuerbachs Intention hinter seiner Kritik durchaus vielschichtig und richtet sich nicht nur gegen das Christentum bzw. die christliche Theologie, sondern auch den Idealismus. Das Werk steht zeitlich am Ende einer langen Epoche der deutschen Philosophie, die vom Idealismus dominiert war und mit Hegels spekulativer Philosophie ihren Höhepunkt fand.
Dem Idealismus wirft Feuerbach vor, dass ihre anfängliche Voraussetzungslosigkeit ein Resultat der Abstraktion vom sinnlich-empirischen Menschen ist und ihn als ein selbst nicht-sinnliches und ohne ein sinnliches Gegenüber Existierendes auffasst. Mit der Abstraktion gehe eine Vereinseitigung des Gegenstandes auf eine Bestimmung und die Verselbstständigung ihrer einher. Die Theologie verlege die Hypostasen im weiteren Schritte ins Jenseits. Feuerbach bekämpft jegliche unipolaren Weltbilder, weil sie den Menschen notwendig auf eine Bestimmung vereinseitigen. In Feuerbachs bipolarer Welt sind alle Gegenstände Einheiten gegensätzlicher Bestimmungen. Als Ausdruck menschlichen Wesens muss die Philosophie für Feuerbach in ihrem formalen Prinzip wesentlich dualistisch sein.
Für Feuerbach stellt das Christentum eine besondere Religion dar, der sich insbesondere durch die Bedeutung Jesu Christi auszeichnet. Die Wichtigkeit der zweiten Person manifestiert sich in der idiosynkratischen Zentralität des Dogmas der Trinität im Christentum, aber auch durch ihre unentbehrliche Bedeutung in anderen christlichen Lehren wie die der Schöpfung und der Inkarnation. Somit dient das Christentum durch die charakteristische Zweigeteiltheit des christlichen Gottes als ausgezeichnetes Modell für Feuerbachs Religions- und Philosophiekritik. Anhand der Dogmen verarbeitet Feuerbach durch seine Interpretation der Dimension der Dualität die Vielfältig- und Vielschichtigkeit seiner Kritikpunkte. In ihnen lehnt er sich teilweise an dialektische Gedanken und Strukturen, wie das des Bewusstseinsprozesses, an, lässt aber auch eigene Ansätze im Zusammenhang mit seinem Gattungskonzept und der Berücksichtigung von Gefühl und Sinnlichkeit einfließen. Dies soll im Folgenden dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Einordnung in den philosophischen Kontext.
- II.1 Hegels christlich-spekulative Philosophie.
- II.2 Feuerbachs Verwandlung der Philosophie in Anthropologie..
- II.2.1 Rezeption verschiedener philosophischer Strömungen..
- II.2.2 Das Konzept der Gattung...
- II.2.3 Die Bedeutung der Religion
- II.2.4 Kritik des Christentums ..
- III. Feuerbachs Interpretation der „Zweifaltigkeit“ des christlichen Gottes
- III.1 Die Trinität......
- III.2 Die Schöpfung
- III.3 Gott und Jesus
- III.3.1 Der metaphysische und der persönliche Gott.
- III.3.2 Jesus als Ebenbild Gottes..
- III.4 Die Inkarnation.....
- IV. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Feuerbachs Werk „Das Wesen des Christentums“ zielt darauf ab, die christliche Religion als Spiegelung menschlicher Verhältnisse zu entlarven. Er argumentiert, dass die Vorstellung von Gott dem Menschen nachempfunden ist und die Bestimmungen, die ihm zugeschrieben werden, menschlicher Natur sind. Feuerbach möchte den Menschen seine Selbsterkenntnis zurückgeben und ihn von der Illusion einer transzendenten Gottheit befreien.
- Die Kritik am Idealismus und der spekulativen Philosophie Hegels
- Die Umdeutung der Religion als Anthropologie
- Die Analyse der „Zweifaltigkeit“ des christlichen Gottes
- Die Bedeutung der Gattungsmäßigkeit des Menschen
- Die Kritik des Christentums als Ausdruck der menschlichen Selbstentfremdung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Feuerbachs Werk „Das Wesen des Christentums“ wird vorgestellt und sein philosophischer Ansatz, der sich auf den Menschen als „wahres Ens realissimum“ konzentriert, beschrieben.
Einordnung in den philosophischen Kontext: Die Arbeit setzt sich mit Hegels christlich-spekulativer Philosophie auseinander, wobei die absolute Idee und die Selbstentäußerung des Geistes im Mittelpunkt stehen. Die Kritik der hegelschen Philosophie führt Feuerbach zu seiner eigenen, anthropologischen Position.
Feuerbachs Verwandlung der Philosophie in Anthropologie: Feuerbach argumentiert für eine vom Menschen ausgehende Philosophie, die die sinnlich-empirische Realität des Menschen berücksichtigt. Er kritisiert den Materialismus, den Empirismus und den Idealismus, da sie den Menschen entweder auf seinen Körper reduzieren oder ihn als abstraktes Wesen betrachten.
Feuerbachs Interpretation der „Zweifaltigkeit“ des christlichen Gottes: Dieses Kapitel untersucht Feuerbachs Analyse der Trinität, der Schöpfung und der Beziehung zwischen Gott und Jesus. Er analysiert die metaphysischen und persönlichen Aspekte Gottes und betrachtet Jesus als Ebenbild des menschlichen Wesens.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Buches sind: Anthropologie, Christentum, Idealismus, Feuerbach, Hegel, Religion, Selbstentfremdung, „Zweifaltigkeit“, Gattungsmäßigkeit, Gott, Jesus, Trinität, Schöpfung, Inkarnation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptanliegen von Feuerbachs Religionskritik?
Feuerbach möchte zeigen, dass Religion eine Projektion des menschlichen Wesens ist („Anthropologie“). Er will dem Menschen seine Selbsterkenntnis zurückgeben, indem er Gott als Spiegelung menschlicher Verhältnisse entlarvt.
Warum kritisiert Feuerbach den Idealismus von Hegel?
Er wirft dem Idealismus vor, vom realen, sinnlichen Menschen zu abstrahieren und ihn als rein geistiges Wesen ohne Gegenüber darzustellen, was zu einer einseitigen Weltanschauung führt.
Was bedeutet die „Zweifaltigkeit“ des christlichen Gottes bei Feuerbach?
Feuerbach nutzt die Dualität (z. B. Gott und Jesus, Trinität), um zu zeigen, dass Gott sowohl metaphysische als auch persönliche (menschliche) Aspekte vereint, was seine Kritik an der Selbstentfremdung stützt.
Welche Rolle spielt der Begriff der „Gattung“?
Für Feuerbach ist das Individuum nur als Teil der Gattung Mensch vollständig. In der Religion projiziert der Mensch die Vollkommenheit der Gattung auf ein jenseitiges Wesen.
Wie interpretiert Feuerbach die Menschwerdung Gottes (Inkarnation)?
Die Inkarnation ist für ihn der Beweis, dass Gott eigentlich der Mensch ist, da sich in diesem Dogma das göttliche Wesen als menschlich offenbart.
- Arbeit zitieren
- Céline Sun (Autor:in), 2017, Das Christentum. Religion der Zweifaltigkeit?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448947