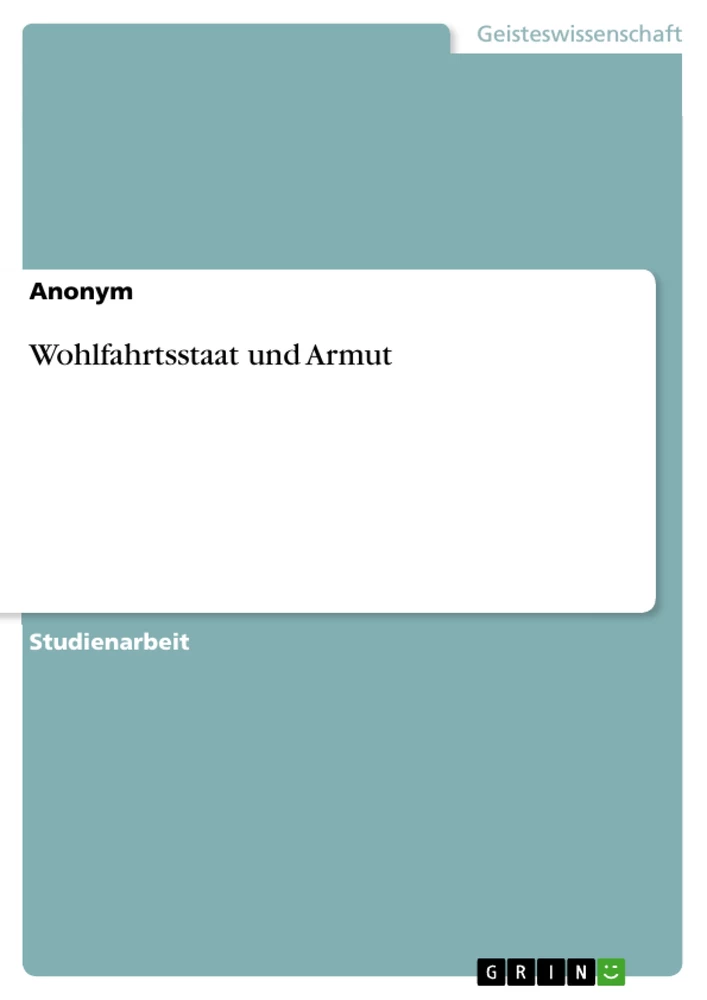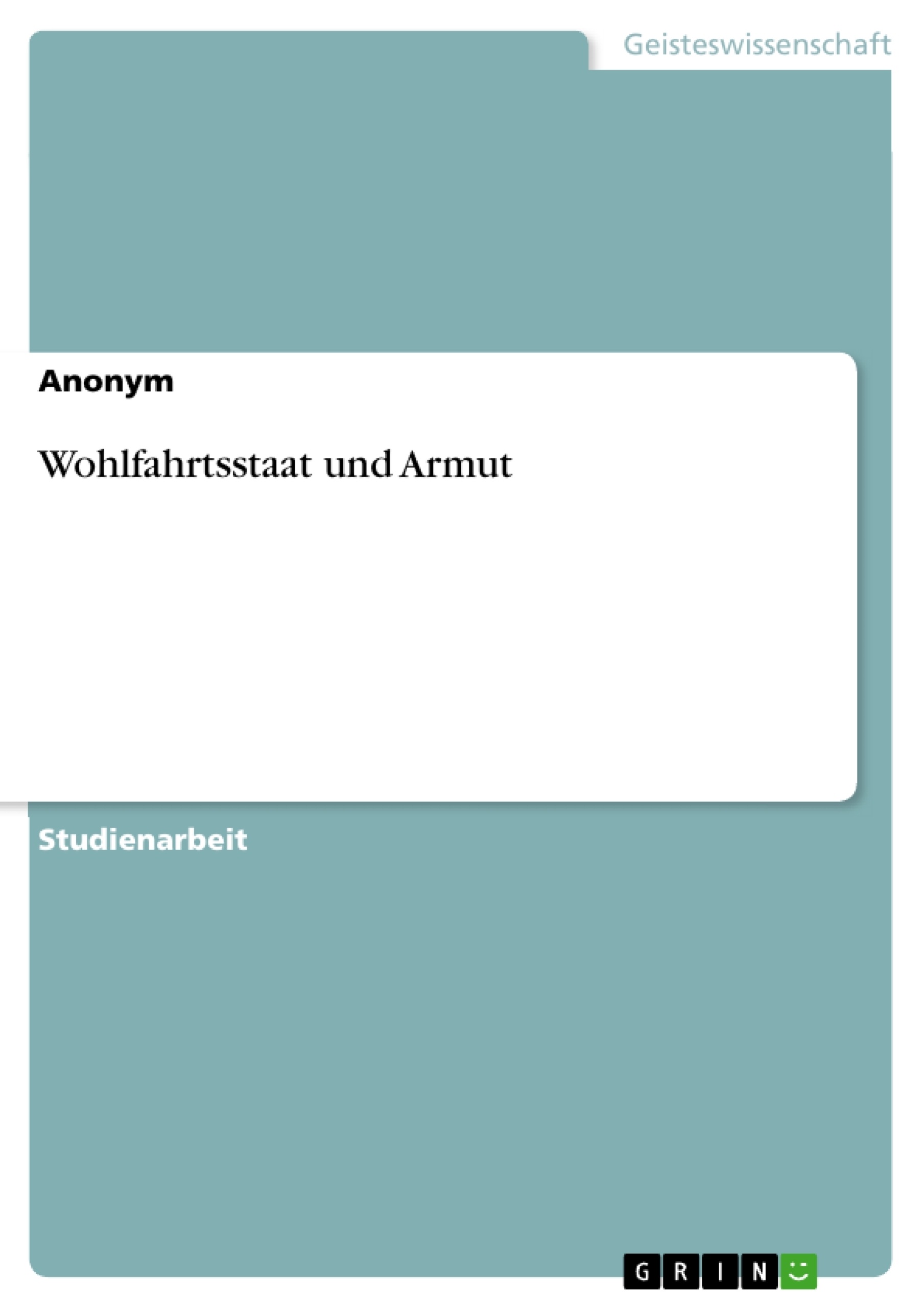Armut ist und bleibt ein zeitlos relevantes Thema, eventuell gewinnt es momentan sogar an Salienz. Denn infolge des demographischen Wandels, ebenso wie nach den Ereignissen der Finanzkrise 2008, rückt Armut und das, was der Wohlfahrtsstaat gegen sie tut, oder auch nicht tut, wieder vermehrt in die öffentliche Debatte. Um jedoch mögliche Auswirkungen von diskutierten Kürzungen oder Umstrukturierungen bestimmter Wohlfahrtsprogramme auf den Anteil der armen Bevölkerung zu verstehen, soll im folgenden Text zunächst gezeigt werden, ob der Wohlfahrtsstaat überhaupt eine armutsreduzierende Wirkung besitzt.
Außerdem soll dargestellt werden, wie es überhaupt zu dem Anteil der armen Bevölkerung eines Landes kommt, denn ohne ein solches Wissen lassen sich die aktuell diskutierten Veränderungen nicht verstehen und bewerten. Zu beidem bietet die wissenschaftliche Literatur eine Vielzahl an Wissen an, dementsprechend kann der folgende Text lediglich einige wenige Punkte in Betracht ziehen und stellt keineswegs einen allumfassenden Überblick dar. Dennoch weist er einige wesentliche Punkte auf, bei denen es sich nicht nur um rein theoretische Hypothesen handelt, sondern um die Ergebnisse aus international empirisch vergleichenden Studien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armutsdefinition und Messmethoden
- Beeinflussung von Vor-/Nachsteurlicher-Armut
- Mittlere/Lange Frist im Gegensatz zur kurzen Frist
- Mögliche Endogenität vorsteuerlicher Armut und die Rolle der Effizienz, sowie Struktur der Ausgaben
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht den Einfluss des Wohlfahrtsstaates auf Armut und beleuchtet, wie Armut in einem Land entsteht. Er untersucht die Armutsreduktion durch den Wohlfahrtsstaat und analysiert die Faktoren, die die Armutsquote beeinflussen. Der Text basiert auf wissenschaftlicher Literatur und empirischen Studien, um ein besseres Verständnis der Problematik zu ermöglichen.
- Armutsdefinition und Messmethoden
- Einfluss des Wohlfahrtsstaates auf Armut
- Faktoren, die die Armutsquote beeinflussen
- Armutsreduktion durch den Wohlfahrtsstaat
- Bedeutung der Armutslücke
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Armut ein und betont dessen Relevanz im Kontext des demographischen Wandels und der Finanzkrise 2008. Der Text will untersuchen, ob der Wohlfahrtsstaat eine armutsreduzierende Wirkung hat und wie die Armutsquote in einem Land zustande kommt.
Armutsdefinition und Messmethoden
Dieser Abschnitt definiert monetäre Armut und differenziert zwischen Markteinkommen und Nettoeinkommen. Es werden verschiedene Methoden zur Berechnung des Haushaltsäquivalenzeinkommens vorgestellt und die Unterschiede zwischen absoluter und relativer Armut erläutert. Die Armutslücke als Messinstrument zur Analyse der Armutstiefe wird ebenfalls besprochen.
Beeinflussung von Vor-/Nachsteurlicher-Armut
Dieses Kapitel analysiert Faktoren, die die Armutsquote bei Markteinkommen beeinflussen, mithilfe einer OLS-Regression. Der Einfluss von Beschäftigung im industriellen Sektor, Arbeitslosigkeit und Lohnkoordination auf die Armutsquote wird untersucht. Zudem werden die armutsreduzierenden Wirkungen des Wohlfahrtsstaates in Bezug auf Faktoren wie linksgerichtete Politik, Vetopunkte, das Ausmaß des Wohlfahrtsstaates und Kinder- und Familienzuwendungen analysiert.
Schlüsselwörter
Monetäre Armut, relative Armut, Markteinkommen, Nettoeinkommen, Haushaltsäquivalenzeinkommen, Armutsgefährdungsschwelle, Armutslücke, Wohlfahrtsstaat, Armutsreduktion, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Lohnkoordination, Linksgerichtete Politik, Vetopunkte, Sozialausgaben, Kinder- und Familienzuwendungen.
Häufig gestellte Fragen
Besitzt der Wohlfahrtsstaat eine armutsreduzierende Wirkung?
Ja, internationale empirische Studien zeigen, dass staatliche Transferleistungen und Steuersysteme die Armutsquote im Vergleich zum reinen Markteinkommen signifikant senken.
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bezieht sich auf das Fehlen grundlegender Überlebensmittel, während relative Armut den Wohlstand im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen der jeweiligen Gesellschaft misst.
Welche Faktoren beeinflussen die Armutsquote bei Markteinkommen?
Wichtige Faktoren sind die Arbeitslosenquote, die Beschäftigung im Industriesektor sowie die Qualität der Lohnkoordination in einem Land.
Was versteht man unter der "Armutslücke"?
Die Armutslücke ist ein Messinstrument, das nicht nur zählt, wie viele Menschen arm sind, sondern auch berechnet, wie weit ihr Einkommen unter der Armutsgrenze liegt (Armutstiefe).
Welchen Einfluss hat Politik auf die Armutsreduktion?
Studien deuten darauf hin, dass Faktoren wie linksgerichtete Politik, das Ausmaß der Sozialausgaben und gezielte Kinder- und Familienzuwendungen die Armut effektiv mindern.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Wohlfahrtsstaat und Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448973