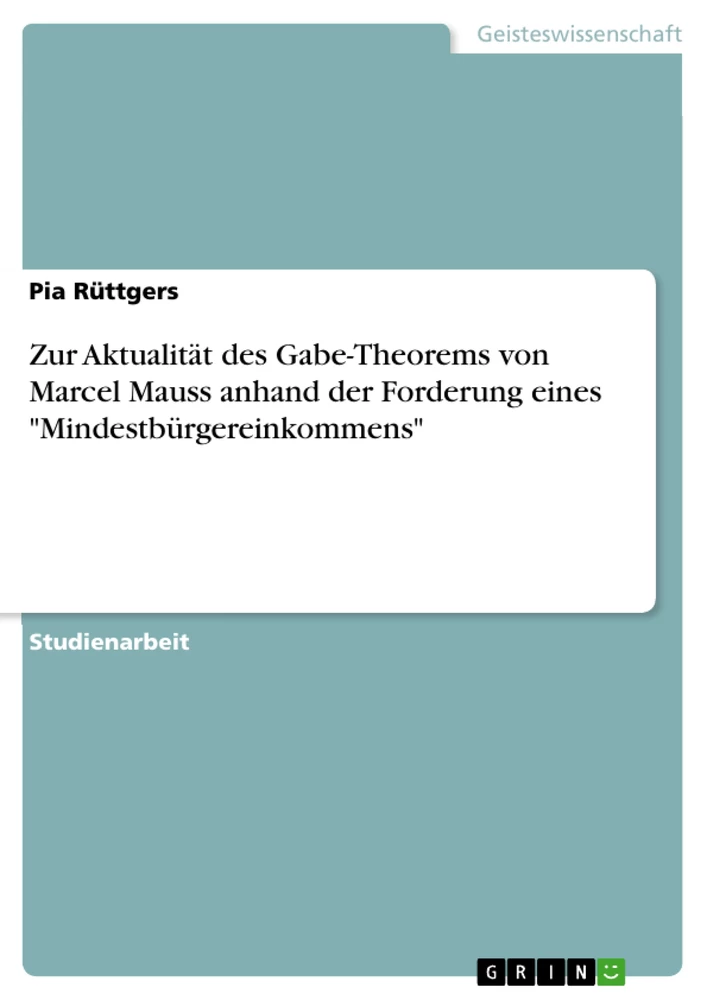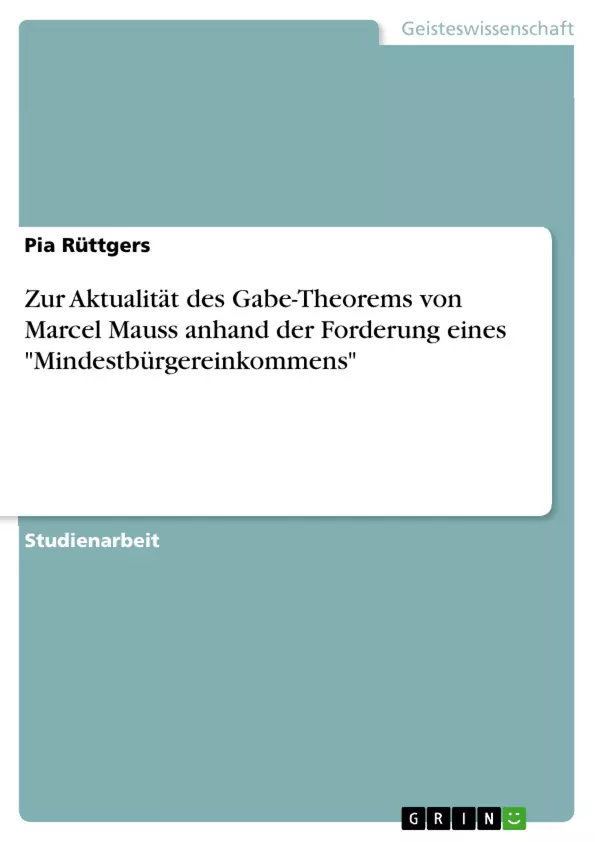Marcel Mauss (1872-1950) als Klassiker der Soziologie aufzufassen erscheint nicht selbstverständlich. Für den Neubegründer der Année Schule (1925) und Durkheim-Neffen gibt es in den soziologischen Einführungen jedenfalls auffallend wenige Platzhalter. Daher darf man überrascht sein über die Vielzahl an Verweisen auf Mauss besonders auch in der gegenwärtigen Soziologie. Offenbar rührt etwas aus seinen Gedanken an die Themen unserer Zeit. Insbesondere das Gabe-Theorem wird in der deutschsprachigen Soziologie seit den 1990er Jahren vermehrt rezipiert.
In dieser Arbeit wird die Aktualität des Gaben-Theorems von Marcel Mauss anhand der Forderung nach einem „bedingungslosen Mindestbürgereinkommen“ dargestellt. Anhand der Argumentation von Caillé werden zentrale Implikationen des Gabe-Theorems strukturiert. Die Gabe in ihrer Funktion für das 'soziale Band' bildet dabei einen inhaltlichen Schwerpunkt. Die anthropologischen Voraussetzungen kommen weiterhin als Querschnittthema zur Geltung. Mauss hat im Rahmen seiner Studien verschiedene Praxen des Schenkens analysiert und in ihrer gesellschaftlichen Funktion gedeutet. Mauss tritt dadurch zugleich als Ethnologe und Soziologe in Erscheinung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gabe-Theorem - Marcel Mauss
- Wissenschaftliche Kontextualisierung
- Grundzüge einer Theorie der Gabe
- Ein Bedingungsloses Mindestbürgereinkommen“ (Alain Caillé) als besondere Gaben-Praxis
- Caillés Gesellschaftsdiagnose und Forderung - ein Überblick
- Mehrdimensionale Annäherung an die bedingte Unbedingtheit über die Gabe-Theorie
- Typisierungen der Gabe
- Die antiutilitaristische Gabe
- Die verpflichtende Gabe
- Die reziproke Gabe
- Die anerkennende Gabe und das soziale Band
- Die diagnostische Gabe
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Aktualität des Gabe-Theorems von Marcel Mauss im Kontext der Forderung nach einem bedingungslosen Mindestbürgereinkommen. Dabei wird anhand der Argumentation von Alain Caillé die Relevanz des Gabe-Theorems für aktuelle soziopolitische Debatten beleuchtet. Die Arbeit analysiert die anthropologischen Voraussetzungen der verschiedenen Perspektiven auf die Gabe und beleuchtet deren Bedeutung für die soziale Integration und das soziale Band.
- Die Aktualität des Gabe-Theorems von Marcel Mauss im Kontext der Forderung nach einem bedingungslosen Mindestbürgereinkommen
- Die anthropologischen Voraussetzungen der verschiedenen Perspektiven auf die Gabe
- Die Relevanz des Gabe-Theorems für aktuelle soziopolitische Debatten
- Die Bedeutung der Gabe für die soziale Integration und das soziale Band
- Die Kritik an der Sichtweise von Alain Caillé anhand einer mehrdimensionalen Konfrontation mit dem Gabe-Theorem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz des Gabe-Theorems von Marcel Mauss für die gegenwärtige Soziologie dar. Im zweiten Kapitel wird das Gabe-Theorem wissenschaftlich kontextualisiert und die zentralen Merkmale der Mauss'schen Perspektive hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert das "bedingungslose Mindestbürgereinkommen" als besondere Form der Gabenpraxis und diskutiert die Gesellschaftsdiagnose und die sozialpolitische Forderung von Alain Caillé. Die Kapitel schließen mit einer Zusammenfassung der Befunde zur Aktualität des Gabe-Theorems.
Schlüsselwörter
Gabe-Theorem, Marcel Mauss, bedingungsloses Mindestbürgereinkommen, Alain Caillé, Anthropologie, soziale Integration, soziales Band, Anerkennung, totale soziale Tatsachen, Praxistheorie, reziproke Gabe, antiutilitaristische Gabe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Gabe-Theorem" von Marcel Mauss?
Es beschreibt das Schenken als "totale soziale Tatsache", die auf dem Dreischritt Geben, Annehmen und Erwidern basiert und das soziale Band zwischen Menschen festigt.
Wie wird das bedingungslose Mindestbürgereinkommen in Bezug auf die Gabe gedeutet?
Nach Alain Caillé kann das Grundeinkommen als eine gesellschaftliche Gabe verstanden werden, die Anerkennung ausdrückt und soziale Integration fördert.
Was bedeutet "antiutilitaristische Gabe"?
Es bezeichnet ein Schenken, das nicht primär auf wirtschaftlichem Nutzen oder Eigennutz basiert, sondern auf der Schaffung und Erhaltung sozialer Beziehungen.
Warum ist Marcel Mauss heute wieder aktuell?
Seine Theorien bieten Erklärungsansätze für moderne gesellschaftliche Probleme wie soziale Kälte, mangelnde Anerkennung und die Krise des Sozialstaats.
Was versteht man unter dem "sozialen Band"?
Das soziale Band bezeichnet die Gesamtheit der Beziehungen und Verpflichtungen, die eine Gesellschaft zusammenhalten und durch Gabenprozesse gestärkt werden.
Welche Rolle spielt die Reziprozität in Mauss' Theorie?
Reziprozität (Gegenseitigkeit) ist das Herzstück; sie erzeugt eine moralische Verpflichtung zur Erwiderung, die dauerhafte soziale Strukturen schafft.
- Arbeit zitieren
- Pia Rüttgers (Autor:in), 2018, Zur Aktualität des Gabe-Theorems von Marcel Mauss anhand der Forderung eines "Mindestbürgereinkommens", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448980