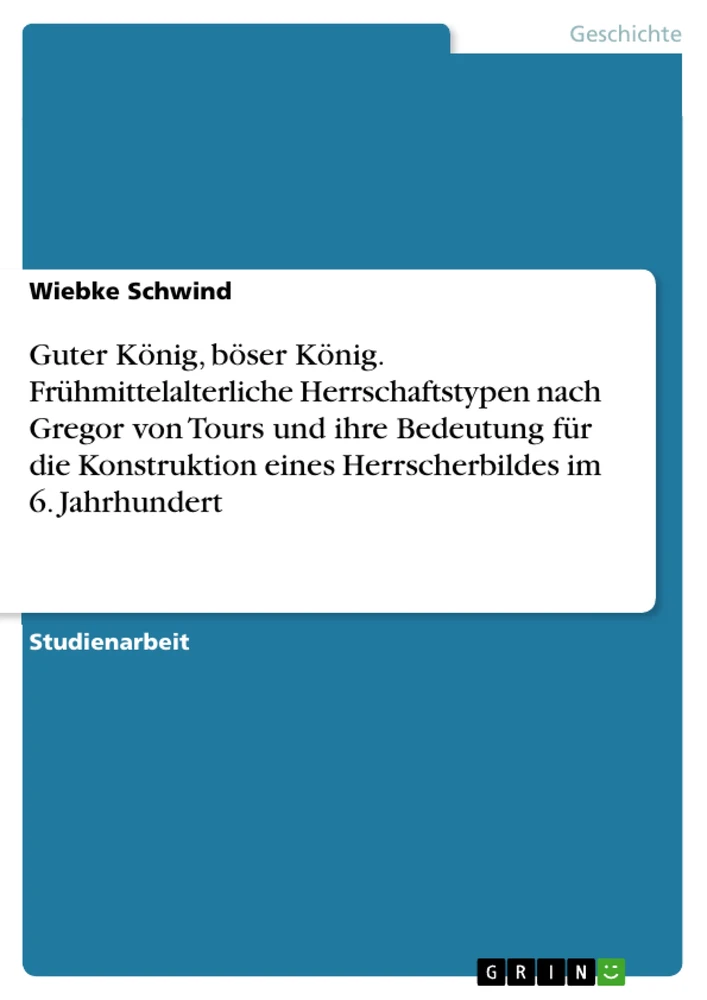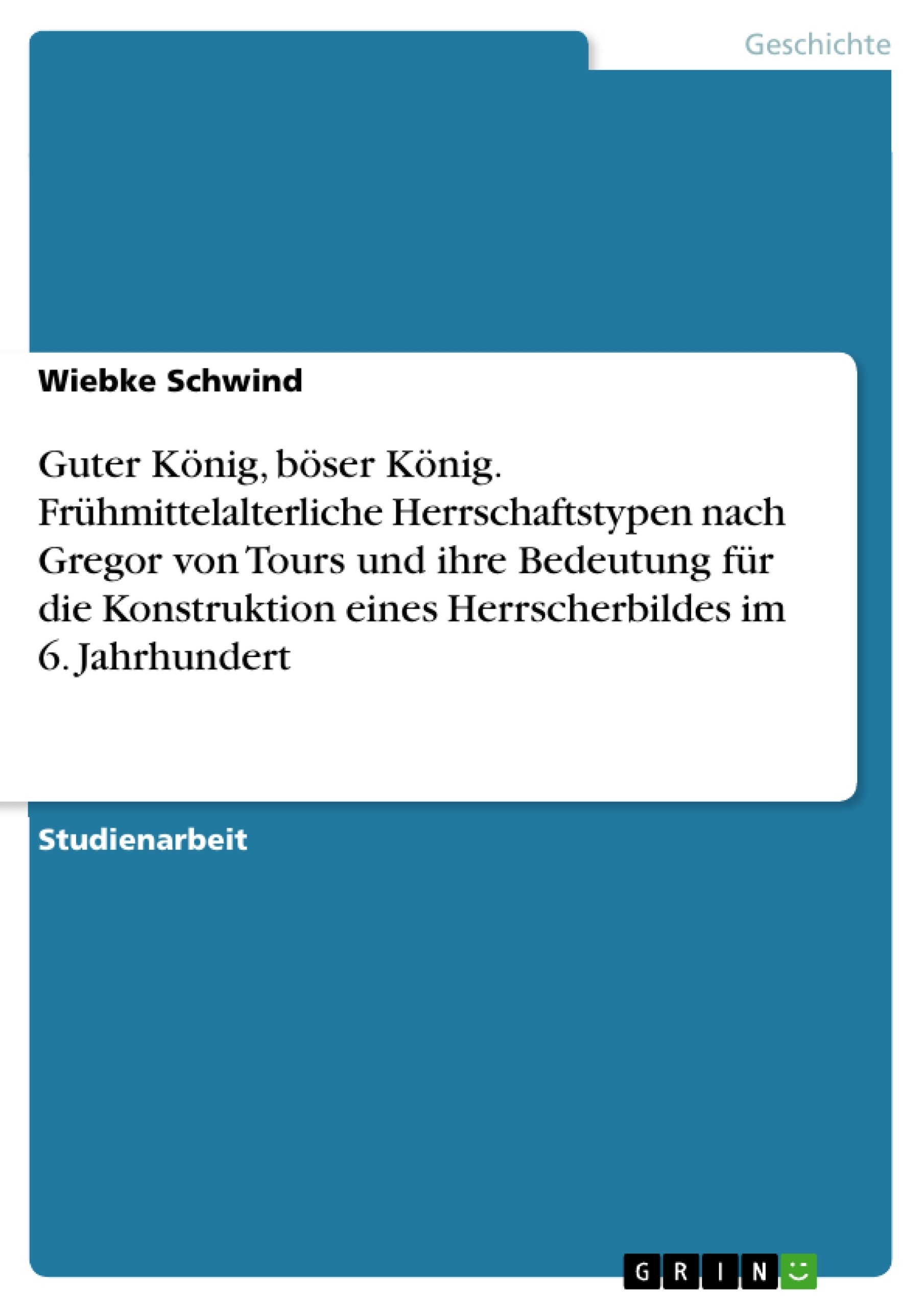„Hast du, o König, deine Lust am Bürgerkriege, so kämpfe den Kampf, […] daß den Geist gelüste wider das Fleisch und die Gebrechen den Tugenden weichen und daß du frei deinem Haupte, das ist Christus, dienest, der du einst in Banden der Wurzel alles Übels gedient hattest.“
In dem Prolog des fünften Buches seiner Historien richtet sich Gregor von Tours direkt an die herrschenden, zerstrittenen Könige seiner Zeit und ermahnt diese zu mehr Eintracht und Bescheidenheit. Mehr noch: er hält ihnen das Idealbild eines Königs vor Augen.
Es ist laut dem Historiker Martin Heinzelmann jedoch oft übersehen worden, dass Gregor, wie man dem obigen Zitat entnehmen kann, die Habgier eines einzelnen Königs „Hast du, o König, deine Lust am Bürgerkriege […]“ für die Bürgerkriegssituation verantwortlich macht oder darauf reduziert. Gierig, kriegslustig, gottlos - Chilperich I. von Neustrien ist für Gregor der Nero und Herodes seiner Zeit und er beschreibt an ihm das Bild eines Königs, wie es nicht sein sollte.
Das Pendant zu dem bösen König Chilperich bildet dessen Halbbruder Gunthchramn von Burgund. Der vom Volk für einen Bischof des Herrn gehaltene, gottesfürchtige und durch wundersame Krankenheilung für heilig erklärte König wird durch die Beschreibung des Bischofs von Tours in der heutigen Forschung zum gregorischen Königsideal erhoben, so wie sein Vorfahre, der erste Frankenkönig Chlodwig I.
Wie beschreibt Gregor von Tours diese beiden Herrschaftstypen? Welche Kriterien sind für ihn maßgebend einen König als gut oder böse darzustellen? Und welche Bedeutung haben seine erschaffenen Herrscherbilder für die heutige Konstruktion eines Herrscherbildes im 6. Jahrhundert?
Die Geschichtsforschung hat sich in den vergangen Jahren besonders auf den Themengebieten der Gewalt, den Geschlechtsidentitäten, Ritualen oder Rechtssystemen im Frühmittelalter mit den von Gregor von Tours beschriebenen Königen auseinandergesetzt, da die Königsthematik scheinbar den einzigen Zugang zur Geschichte des 6. Jahrhunderts bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Welt Gregor von Tours' und seine „Zehn Bücher Geschichten“
- Chlodwig als Gregors Königsideal
- Die „sieben“ Sünden Chilperichs und die Tugendhaftigkeit Gunthchramns
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung frühmittelalterlicher Herrschaftstypen bei Gregor von Tours im 6. Jahrhundert. Sie analysiert Gregors Kriterien zur Bewertung von Königen als "gut" oder "böse" anhand der Beispiele Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn. Das Ziel ist es, Gregors Herrscherbild zu rekonstruieren und dessen Einfluss auf die heutige Geschichtswissenschaft zu beleuchten.
- Gregors Kriterien für ein ideales Herrscherbild
- Vergleichende Analyse der Herrscher Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn
- Der Einfluss von Gregors Geschichtsschreibung auf die moderne Interpretation frühmittelalterlicher Herrschaft
- Die Rolle von Religion und Moral in Gregors Darstellung der Könige
- Die Grenzen und Perspektiven von Gregors Geschichtsschreibung als Quelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach Gregors Kriterien für die Darstellung guter und böser Könige im 6. Jahrhundert. Sie benennt Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn als zentrale Beispiele und verweist auf die einseitige Darstellung Chlodwigs in der Forschung. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der Gregors "Zehn Bücher Geschichten" als Hauptquelle nutzt und die Analyse der Herrscherbilder anhand der Kriterien Gregors vornimmt.
2. Die Welt Gregor von Tours´ und seine „Zehn Bücher Geschichten“: Dieses Kapitel skizziert das Leben und die historische Situation Gregors von Tours im 6. Jahrhundert, geprägt von Bürgerkriegen und politischer Instabilität im fränkischen Reich. Es betont Gregors gallo-römische Herkunft und seine Ausbildung im Klerus. Gregors Intention, durch seine Geschichtsschreibung eine Sinnstiftung in einer chaotischen Zeit zu schaffen und die Klerikalisierung der Gesellschaft zu fördern, wird herausgestellt. Sein Fokus auf die Könige und die Bedeutung der Beziehung zwischen Königen und Bischöfen in seinen "Zehn Bücher Geschichten" werden ebenfalls erläutert.
Schlüsselwörter
Gregor von Tours, Frühmittelalter, Merowinger, Chlodwig I., Chilperich I., Gunthchramn, Herrscherbild, Königsideal, Geschichtsschreibung, Historiographie, Religion, Moral, Gewalt, Bürgerkrieg.
Gregor von Tours: Herrscherbilder im 6. Jahrhundert - FAQs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung frühmittelalterlicher Herrschaftstypen bei Gregor von Tours im 6. Jahrhundert. Im Fokus stehen Gregors Kriterien zur Bewertung von Königen (als "gut" oder "böse") anhand der Beispiele Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn. Ziel ist die Rekonstruktion von Gregors Herrscherbild und die Beleuchtung dessen Einflusses auf die heutige Geschichtswissenschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Gregors Kriterien für ein ideales Herrscherbild, vergleicht die Herrscher Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn, beleuchtet den Einfluss von Gregors Geschichtsschreibung auf die moderne Interpretation frühmittelalterlicher Herrschaft, untersucht die Rolle von Religion und Moral in Gregors Darstellung der Könige und analysiert die Grenzen und Perspektiven von Gregors Geschichtsschreibung als Quelle.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit sind Gregors "Zehn Bücher Geschichten". Die Analyse der Herrscherbilder erfolgt anhand der Kriterien, die Gregor selbst verwendet.
Wer sind die zentralen Figuren der Analyse?
Die zentralen Figuren sind die merowingischen Könige Chlodwig I., Chilperich I. und Gunthchramn. Ihre Handlungen und Charaktere werden im Hinblick auf Gregors Kriterien für ein "gutes" oder "böses" Königtum untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Welt Gregors von Tours und seinen "Zehn Büchern Geschichten", ein Kapitel zu Chlodwig als Gregors Königsideal, ein Kapitel zu den "sieben" Sünden Chilperichs und der Tugendhaftigkeit Gunthchramns, und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Was ist die Schlussfolgerung der Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist im gegebenen Textfragment nicht enthalten. Die Arbeit zielt darauf ab, Gregors Herrscherbild zu rekonstruieren und dessen Einfluss auf die moderne Geschichtswissenschaft zu beleuchten.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Gregor von Tours, Frühmittelalter, Merowinger, Chlodwig I., Chilperich I., Gunthchramn, Herrscherbild, Königsideal, Geschichtsschreibung, Historiographie, Religion, Moral, Gewalt, Bürgerkrieg.
- Citation du texte
- Wiebke Schwind (Auteur), 2018, Guter König, böser König. Frühmittelalterliche Herrschaftstypen nach Gregor von Tours und ihre Bedeutung für die Konstruktion eines Herrscherbildes im 6. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449027