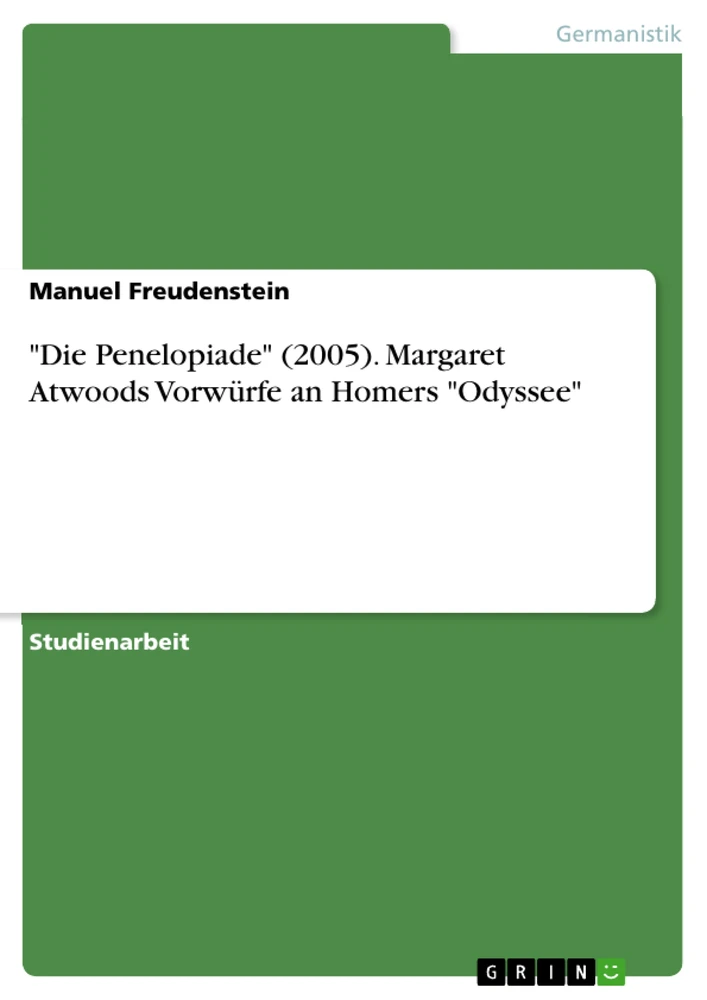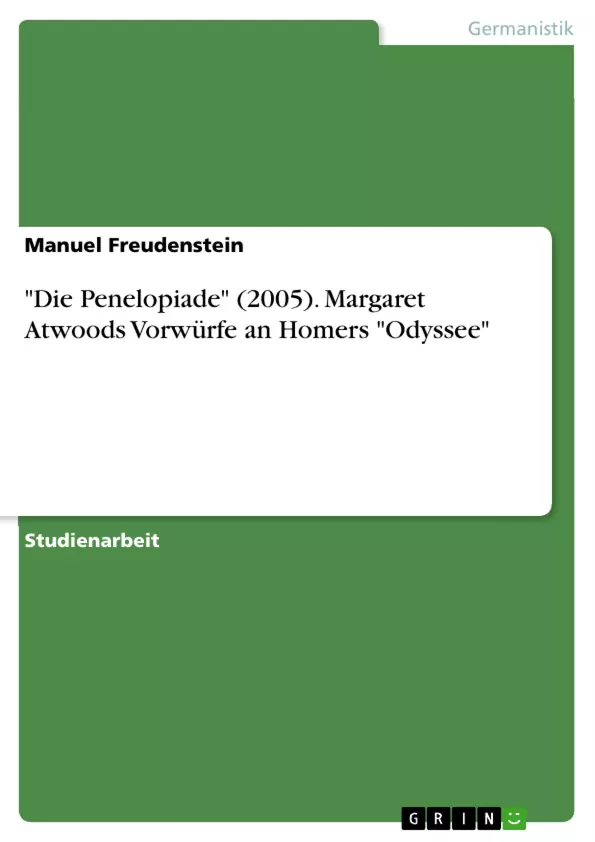„Canongate Myth Series“ heißt das ambitionierte Unterfangen des britischen Verlegers Jamie Byng, welches darauf abzielt antike Mythen der verschiedensten Kulturen von zeitgenössischen Autoren in Form von Kurzgeschichten und Romanen neu zu erzählen. Neben „Canongate Books“, dem schottischen Verlag des Initiators Byng, beteiligen sich weltweit über 30 Verlage. Als eine von bisher 18 namhaften Autoren ist auch die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood dem Ruf des internationalen literarischen Großprojekts gefolgt und hat einen antiken Mythos neu aufgelegt. In Die Penelopiade von 2005 erzählt sie den Mythos um Odysseus aus der Perspektive seiner Frau Penelope und ihrer Mägde.
Während ihr Mann nach dem langen trojanischen Krieg die beschwerliche Heimreise nach Ithaka antritt, kämpfen Penelope und ihr gemeinsamer Sohn Telemachos tagtäglich um die Bewahrung des Königshauses, das von Dutzenden adligen Freiern bedroht wird. Odysseus ist bekannt für seinen Listenreichtum, seinen Verstand und seinen Mut. Als einer der Helden des trojanischen Krieges reiht er sich neben Achilles, Hector, Paris und Ajax ein und wird besonders mit der großen Kriegslist des trojanischen Pferdes in Verbindung gebracht, die den Griechen den Sieg über das mächtige Troja bescherte. Die Tatsache, dass er nach der langersehnten Ankunft in Ithaka, nach 20 Jahren Krieg und Irrfahrten, ein Blutbad unter den Freiern und den Mägden seiner Frau anrichtet, wird aus Sicht Atwoods zu sehr missachtet, womöglich um dem Ansehen des großen griechischen Helden nicht zu schaden.
In ihrer Adaption bietet sie ein alternatives Szenario an und lässt die zwölf erhängten Mägde in Tradition des antiken griechischen Theaterchores mehrmals zu Wort kommen, um die Handlung zu kommentieren und provokativ oder satirisch die Geschehnisse der Odyssee in Frage zu stellen. Atwoods Werke, darunter nicht nur Romane, sondern ebenso Kurzgeschichten, Gedichte und Kinderbücher, sind bekannt für ihren gesellschaftskritischen und emanzipatorischen Ton. Die Beweggründe der kanadischen Autorin, gerade den Epos von Homer aus Sicht Penelopes zu erzählen, sollen im Verlauf dieser Arbeit aufgedeckt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt und Struktur
- Romananalyse und Deutungsansätze
- Penelope als kritische Ich-Erzählerin
- Die Klagen des Mägdechors
- Vergleiche mit Homer und seiner Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Margaret Atwoods Roman „Die Penelopiade“ (2005) im Kontext des antiken griechischen Epos „Odyssee“ von Homer. Die Arbeit beleuchtet die Motive und Ziele der kanadischen Autorin, den Mythos von Odysseus aus der Sicht seiner Frau Penelope und ihrer Mägde neu zu erzählen. Die Analyse beleuchtet die narrative Struktur, die Charakterisierung der Figuren und die kritischen Ansätze, die Atwood in ihrer Interpretation der Odyssee verwendet.
- Die Rolle der Frau im antiken Griechenland und in Atwoods Interpretation
- Die Rezeption des Odysseus-Mythos in der modernen Literatur
- Kritik am patriarchalen Gesellschaftssystem und der Behandlung von Sklaven
- Die Bedeutung von Sprache und Erzählperspektive in der Literatur
- Die Verbindung von antiken Mythen und zeitgenössischen Themen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Entstehung und den Kontext des Romans „Die Penelopiade“ innerhalb der „Canongate Myth Series“. Es werden die Beweggründe Atwoods, den Odysseus-Mythos neu zu erzählen, und ihre kritische Auseinandersetzung mit Homers Werk vorgestellt.
Kapitel 2 behandelt den Inhalt und die Struktur des Romans. Es wird die Unterteilung in 29 Kapitel, darunter zehn Einschübe des Mägdechors, erläutert. Die Kapitel behandeln die wichtigsten Stationen in Penelopes Leben, angefangen von ihrer Kindheit bis zu Odysseus' Rückkehr nach Ithaka.
In Kapitel 3 werden die beiden zentralen Erzählinstanzen, Penelope und der Mägdechor, analysiert. Penelope schildert ihre Sicht auf Odysseus und die Ereignisse der Odyssee, während der Mägdechor die Geschichte aus der Perspektive der Sklavinnen kommentiert. Kapitel 3.1 beleuchtet Penelopes kritisches Ich-Erzählerin und ihre Sicht auf die Rolle der Frau im antiken Griechenland.
Kapitel 3.2 befasst sich mit den Gesängen des Mägdechors. Die Mägde thematisieren satirisch und melancholisch die Behandlung durch Odysseus, ihre Lebensbedingungen als Sklavinnen und die Ereignisse der Odyssee.
Kapitel 4 vergleicht die Darstellung der Ereignisse in Atwoods Roman mit Homers Odyssee. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen der Geschichte sowie die Unterschiede in der Darstellung der Figuren und Ereignisse diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Penelopiade, Margaret Atwood, Homer, Odyssee, Mythos, Rezeption, Patriarchat, Sklaverei, Geschlechterrollen, Gesellschaftskritik, Erzählperspektive, Frauengeschichte, feministische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Margaret Atwoods „Die Penelopiade“?
Der Roman erzählt den antiken Mythos von Odysseus neu, jedoch konsequent aus der Perspektive seiner Frau Penelope und ihrer zwölf erhängten Mägde.
Welche Kritik übt Atwood an Homers „Odyssee“?
Atwood kritisiert die Idealisierung des Odysseus und die Vernachlässigung der Gewalt gegen die Mägde, die nach seiner Rückkehr ohne gerechtes Urteil hingerichtet wurden.
Welche Rolle spielt der Mägdechor im Roman?
Der Chor der zwölf Mägde kommentiert die Handlung satirisch und provokativ in der Tradition des antiken Theaters und gibt den namenlosen Opfern eine Stimme.
Wie wird Penelope als Ich-Erzählerin dargestellt?
Penelope wird als kluge, aber auch leidende Frau gezeichnet, die im Schatten ihres Mannes steht und gegen patriarchale Strukturen und die Einsamkeit kämpft.
Was ist die „Canongate Myth Series“?
Es ist ein internationales Literaturprojekt, bei dem zeitgenössische Autoren antike Mythen in moderner Form neu interpretieren.
- Arbeit zitieren
- Manuel Freudenstein (Autor:in), 2018, "Die Penelopiade" (2005). Margaret Atwoods Vorwürfe an Homers "Odyssee", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449059