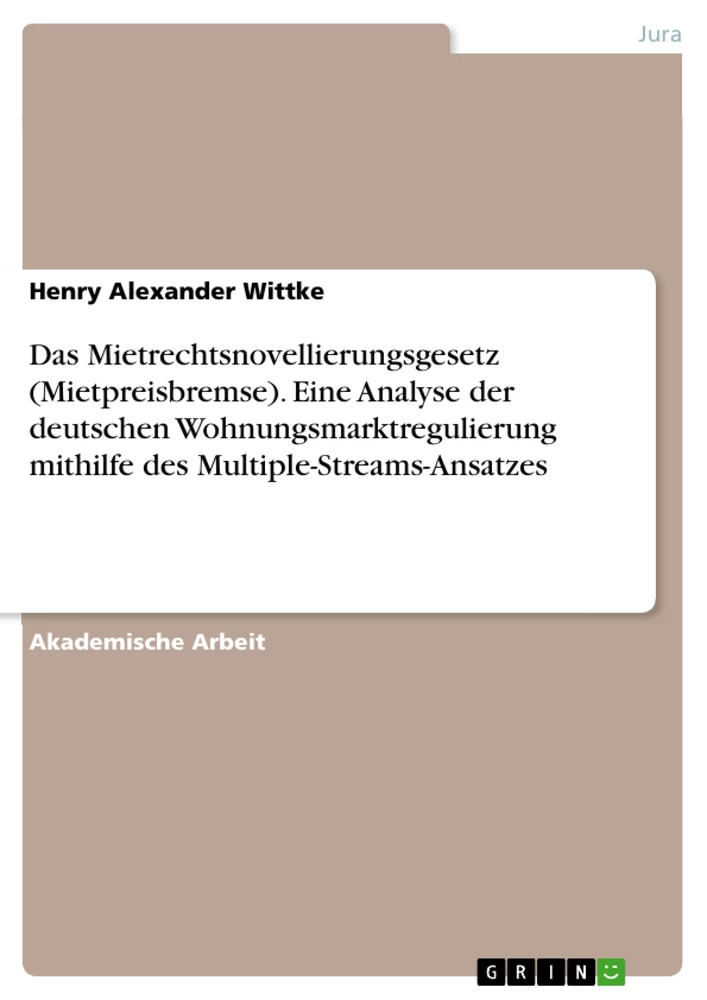Mit der folgenden Untersuchung sollen jene Dimensionen der theoretischen Grundlage herangezogen werden, die erklären, wodurch ein Agenda-Wandel und die Einführung einer neuen Policy zustande kommen. Exemplarisch soll untersucht werden, wie der Zeitpunkt der Verkündung des deutschen Mietrechtsnovellierungsgesetzes (Mietpreisbremse) im April 2015 und die Grundlage für das Mietrechtsanpassungsgesetz zu erklären sind.
„We seek to understand why some subjects become prominent on the policy agenda and others do not, and why some alternatives for choice are seriously considered while others are neglected?“ (Kingdon 1984: 3).
An diese entscheidende Frage knüpft der Multiple-Streams-Ansatz von John W. Kingdon an. Damit wurde ein analytisches Modell zum Agenda-Setting geschaffen, welches dem Bereich der Policy-Forschung zugeordnet wird. Es liefert Erklärungskraft darüber, welche Faktoren einen sogenannten Agenda-Wandel vorantreiben, eine neue Policy begünstigen und erklärt das Handeln von Akteuren im Rahmen ihrer Kontextbedingungen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MULTIPLE-STREAMS-ANSATZ
- Problem-Strom
- Politics-Strom
- Policy-Strom
- Policy-Fenster & Policy-Entrepreneur
- Hypothesen auf Basis der theoretischen Grundlage
- MIETRECHTSNOVELLIERUNGSGESETZ („MIETPREISBREMSE“)
- METHODIK
- ANALYSE UND ANWENDUNG DES MULTIPLE-STREAMS-ANSATZES
- Problem-Strom
- Politics-Strom
- Policy-Strom
- Policy-Fenster & Policy-Entrepreneur
- AUSWERTUNG DER ANALYSE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der empirischen Untersuchung des Multiple-Streams-Ansatzes von John W. Kingdon, um den Zeitpunkt der Verkündung des deutschen Mietrechtsnovellierungsgesetzes („Mietpreisbremse“) im April 2015 zu erklären. Die Arbeit analysiert die Faktoren, welche einen sogenannten Agenda-Wandel vorantreiben und erklärt, wie das Handeln von Akteuren im Rahmen ihrer Kontextbedingungen abläuft.
- Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes auf ein Fallbeispiel
- Analyse des Agenda-Wandels im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse
- Identifikation der relevanten Problem-, Politics- und Policy-Ströme
- Bewertung der Rolle von Policy-Fenstern und Policy-Entrepreneurs
- Beitrag zur deutschen Wohnungsmarktregulierung mithilfe des Multiple-Streams-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Kontext des Mietrechtsnovellierungsgesetzes. Im Anschluss daran wird das Konzept des Multiple-Streams-Ansatzes nach John W. Kingdon im Detail vorgestellt. Dieses Konzept basiert auf drei Grundannahmen: 1. Politische Systeme sind organisierte Anarchien, 2. Entscheidungssituationen lassen sich durch das Denken in Strömen erfassen und 3. Agenda-Wandel hängt von der Verbindung dieser Ströme ab.
Das zweite Kapitel analysiert die drei Ströme des Multiple-Streams-Ansatzes: den Problem-Strom, den Politics-Strom und den Policy-Strom. Der Problem-Strom beschreibt die Wahrnehmung von Problemen, die politischen Willen zur Änderung auslösen. Der Politics-Strom betrachtet den prozessualen Aspekt des Politischen, beeinflusst durch öffentliche Meinung, Interessengruppen und personelle Veränderungen im politisch-administrativen System. Der Policy-Strom hingegen konzentriert sich auf den inhaltlichen Aspekt des Politischen, insbesondere auf die diskutierten Ideen der Policy Communities.
Das dritte Kapitel beschreibt das Policy-Fenster, eine Voraussetzung für einen Agenda-Wandel, und den Policy-Entrepreneur, der versucht, seine favorisierte Policy als Lösung für ein Problem anzubinden. Es werden auch verschiedene Arten von Policy-Fenstern und die Bedeutung des Timings für den Erfolg eines Policy-Entrepreneurs beleuchtet. Die Rolle des Policy-Entrepreneurs wird in diesem Kapitel ebenfalls detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Multiple-Streams-Ansatz, Agenda-Setting, Policy-Forschung, Mietrechtsnovellierungsgesetz, Mietpreisbremse, Problem-Strom, Politics-Strom, Policy-Strom, Policy-Fenster, Policy-Entrepreneur, Agenda-Wandel, Wohnungsmarktregulierung, politische Prozesse, Kontingenz-Modell, Policy Communities.
Häufig gestellte Fragen
Was erklärt der Multiple-Streams-Ansatz von Kingdon?
Er erklärt, wie Themen auf die politische Agenda gelangen, indem drei "Ströme" (Probleme, Lösungen/Policies und politische Ereignisse) durch ein "Policy-Fenster" zusammengeführt werden.
Was ist ein Policy-Entrepreneur?
Ein Akteur, der aktiv darauf hinarbeitet, ein Problem mit einer bestimmten Lösung zu verknüpfen und den richtigen Zeitpunkt (das Policy-Fenster) nutzt, um eine politische Änderung herbeizuführen.
Wann wurde die deutsche Mietpreisbremse verkündet?
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz, bekannt als Mietpreisbremse, wurde im April 2015 verkündet.
Was versteht man unter dem "Problem-Strom" im Kontext der Mieten?
Der Problem-Strom umfasst die öffentliche Wahrnehmung stark steigender Mieten in Ballungsräumen, die einen politischen Handlungsdruck erzeugten.
Welche Rolle spielt der "Politics-Strom" bei Gesetzgebungsverfahren?
Er beinhaltet Faktoren wie die öffentliche Meinung, den Einfluss von Interessengruppen und Regierungswechseln, die das politische Klima für eine neue Regulierung prägen.
- Arbeit zitieren
- Master-Abschluss (M.A.) Henry Alexander Wittke (Autor:in), 2018, Das Mietrechtsnovellierungsgesetz (Mietpreisbremse). Eine Analyse der deutschen Wohnungsmarktregulierung mithilfe des Multiple-Streams-Ansatzes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449702