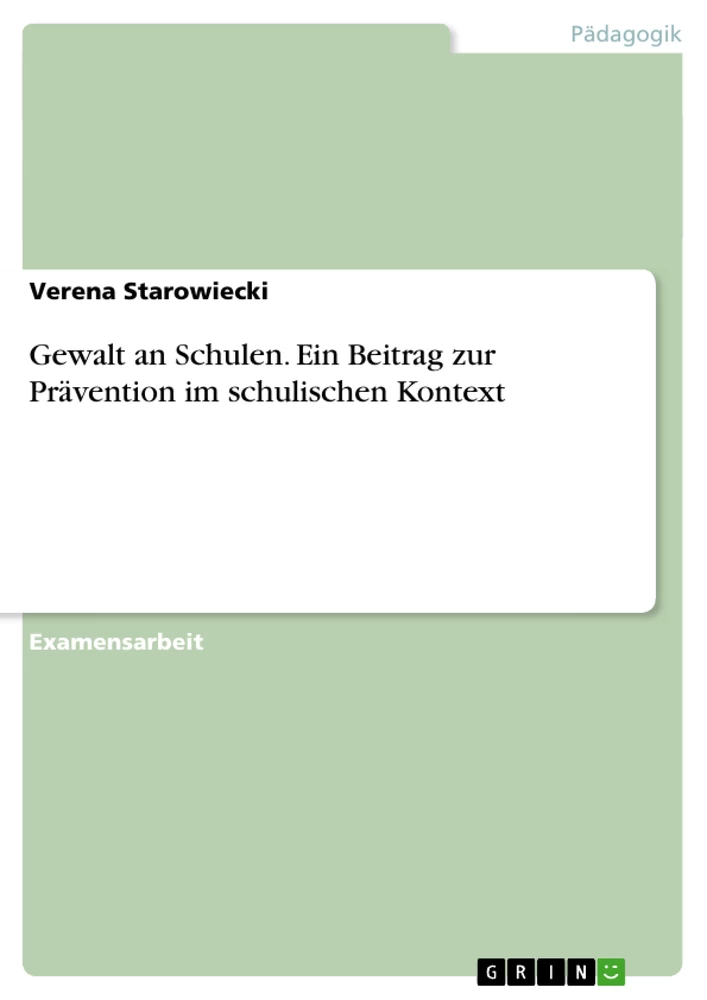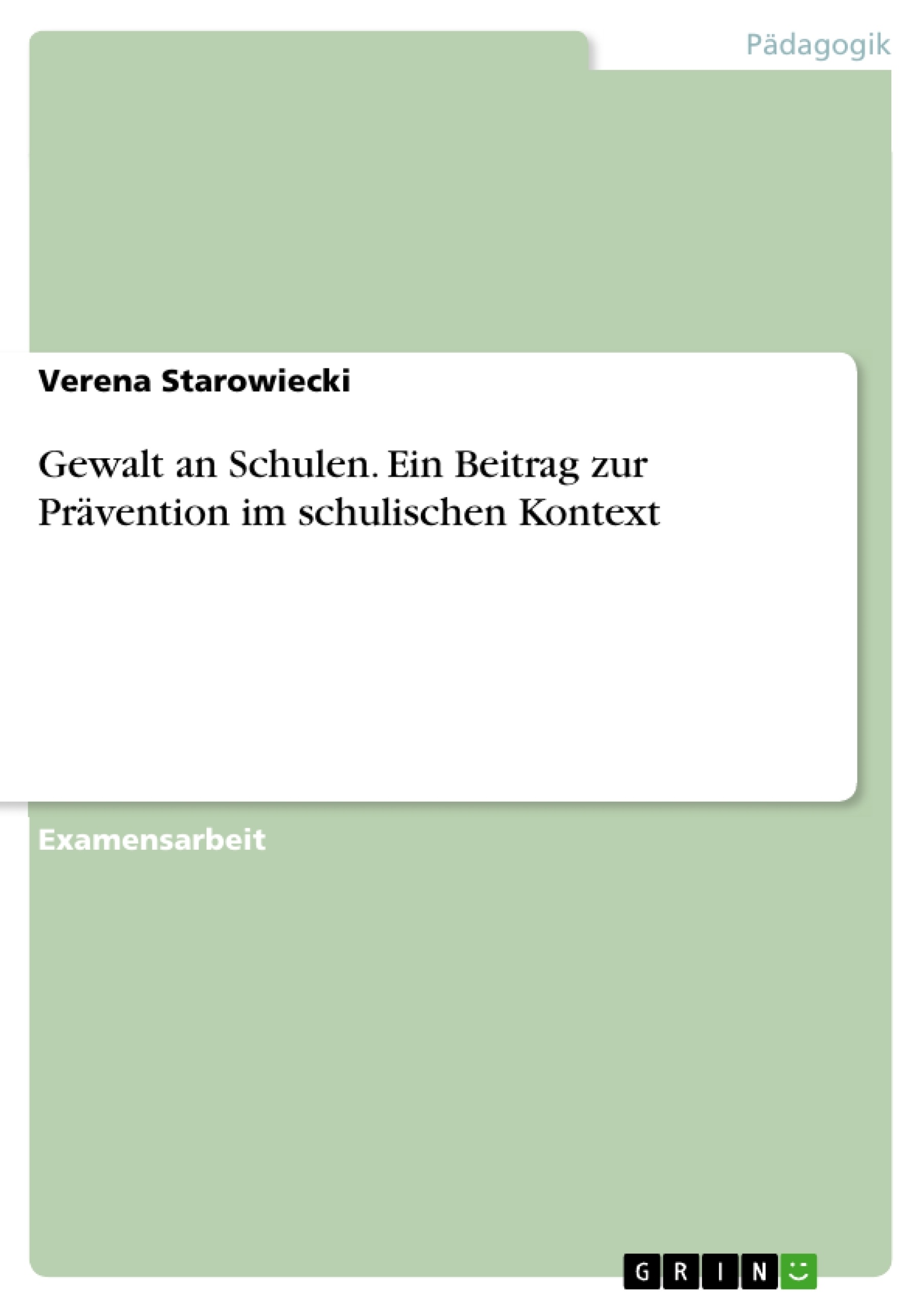Bereits im Alten Testament sind Aggression und Gewalt sowohl von den Menschen als auch von Gott ein Thema. Adam und Eva versündigen sich gegen Gott. Gott vertreibt diese daraufhin aus dem Paradies (vgl. Gen 3, 23-24) und wenig später erschlägt Kain seinen Bruder Abel (vgl. Gen 4, 8). Am deutlichsten wird der alttestamentarische, zornige und aggressive Gott, wenn er fordert: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex 21, 24). Nach DARWIN muss eine Art um ihr Überleben kämpfen, denn nur der Stärkere überlebt (vgl. 1963, S. 120). Um überleben zu können, ist natürlich Gewalt im Spiel. Es gilt, in der Konkurrenz zu bestehen und sich durchzusetzen. Dies hatte DARWIN damals in erster Linie auf die Tierwelt bezogen, doch diese Aussage ist durchaus auch auf den Menschen zu übertragen. Ein Blick auf die Literatur bestätigt das, wenn z. B. EIBL-EIBESFELDT konstatiert, dass sich Tiere einer Art sehr oft bekämpfen. Die Geschichte der Menschheit ist nach der Autorin eine Geschichte von Gewalttaten. Dieses aggressive Verhalten bestimmt auch die heutige Zeit. Gewiss bestehen kulturelle Unterschiede. Jedoch scheint die „Aggressivität als Disposition zur Aggression vielmehr auf der ganzen Erde verbreitet“, was diese aber keineswegs rechtfertigt. Gewalt ist demnach tief in den Instinkten des Menschen verwurzelt. Kriege ziehen sich durch die ganze Menschheitsgeschichte und galten lange Zeit „als eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ (CLAUSEWITZ, 1963, S. 22). Doch im Gegensatz zu den Tieren hat der Mensch die Macht, sich gegen seine Instinkte und Triebe zu entscheiden. In der heutigen freien und aufgeklärten Gesellschaft besitzt der Staat deshalb ein alleiniges Gewaltmonopol, welches besagt, dass „allein staatliches Handeln die Anwendung physischer Gewalt legitimieren kann“ (WEBER, http, 21.11.2004). Die Anwendung physischer Gewalt ist also außer in Notwehrsituationen nicht erlaubt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition
- 2.1 Aggression und Gewalt - Versuch einer definitorischen Klärung
- 2.2 Verschiedene Arten
- 3 Entstehungsmechanismen
- 4 Erklärungspositionen aggressiven Verhaltens
- 4.1 Triebtheorien
- 4.1.1 Triebtheorien der Psychoanalyse nach FREUD
- 4.1.2 Triebtheorie der Ethologie nach LORENZ
- 4.2 Frustrations-Aggressions-Theorie
- 4.3 Lernpsychologische Theorien
- 4.3.1 Klassisches Konditionieren
- 4.3.2 Operantes Konditionieren
- 4.3.3 Beobachtungslernen
- 4.3.4 Kognitives Lernen
- 4.4 Kritische Reflexion
- 4.1 Triebtheorien
- 5 Aggressionsfelder
- 5.1 Persönliches
- 5.2 Familie
- 5.3 Medien
- 5.4 Schule
- 5.5 Peergroups
- 6 Gewaltprävention
- 6.1 Einzelne Praxisfelder
- 6.1.1 Erziehung in der Familie
- 6.1.2 Medien
- 6.1.3 Schule
- 6.1.4 Gesellschaft
- 6.2 Grundformen der Gewaltprävention nach MARTIN
- 6.3 Ein Präventionskonzept nach NOLTING
- 6.3.1 Aggression abreagieren - geht das?
- 6.3.2 Die Anreger verändern
- 6.3.3 Die Anreger anders bewerten
- 6.3.4 Aggressionshemmungen fördern
- 6.3.5 Alternatives Verhalten lernen
- 6.4 Präventionsprogramme
- 6.4.1 Familien-Management nach PATTERSON
- 6.4.2 Training mit aggressiven Kindern nach PETERMANN/PETERMANN
- 6.4.3 Interventionsprogramm in schwierigen Schulklassen nach GUGGENBÜHL
- 6.4.4 Schulisches Interventionsprogramm nach OLWEUS
- 6.5 Kritische Reflexion
- 6.1 Einzelne Praxisfelder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Ursachen von Aggression und Gewalt bei Heranwachsenden im schulischen Kontext und legt einen Schwerpunkt auf präventive Maßnahmen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Problematik zu zeichnen und praktikable Lösungsansätze für die Schule zu entwickeln.
- Definition und Differenzierung von Aggression und Gewalt
- Erklärungsansätze für aggressives Verhalten (Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorien)
- Einflussfaktoren auf aggressives Verhalten (Familie, Medien, Schule, Peergroups)
- Präventionsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen (individuell, klassenbezogen, schulbezogen)
- Bewertung bestehender Präventionsprogramme
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische und gesellschaftliche Relevanz von Aggression und Gewalt, beginnend mit alttestamentarischen Beispielen und Darwins Konzept des Überlebenskampfes. Sie führt den Amoklauf von Erfurt als drastisches Beispiel für die Notwendigkeit von präventiven Maßnahmen an und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Begriffsdefinition: Dieses Kapitel widmet sich der terminologischen Abgrenzung von Aggression und Gewalt. Es analysiert unterschiedliche Definitionen, unterscheidet zwischen weiten und engen Fassungen und diskutiert die Konzepte von Aggressivität und verschiedenen Aggressionsformen (körperlich, verbal, nonverbal, direkt, indirekt, affektiv, instrumental).
3 Entstehungsmechanismen: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung aggressiven Verhaltens über die Lebensphasen hinweg, beginnend mit pränatalen Einflüssen bis hin zur Adoleszenz. Es thematisiert die Rolle von Temperament, frühkindlichen Erfahrungen und den Einfluss der sozio-emotionalen Entwicklung nach Erikson.
4 Erklärungspositionen aggressiven Verhaltens: Hier werden verschiedene Theorien zur Erklärung aggressiven Verhaltens vorgestellt und kritisch diskutiert: Triebtheorien (Freud, Lorenz), die Frustrations-Aggressions-Theorie und lernpsychologische Ansätze (klassisches und operantes Konditionieren, Beobachtungslernen, kognitives Lernen). Die Stärken und Schwächen der einzelnen Theorien werden herausgearbeitet.
5 Aggressionsfelder: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Bereiche, die die Entstehung und Ausprägung von Aggression beeinflussen: persönliche Faktoren (Geschlecht, Persönlichkeit), familiäre Einflüsse (Erziehungsstile, Gewalt in der Familie), Medienkonsum, die Schule als Institution und Peergroups. Die jeweiligen Einflussmöglichkeiten werden detailliert betrachtet.
6 Gewaltprävention: Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen der Gewaltprävention und Intervention. Es werden die drei Präventionsebenen nach Caplan (primär, sekundär, tertiär) erläutert und verschiedene Praxisfelder (Familie, Medien, Schule, Gesellschaft) mit konkreten Maßnahmen diskutiert. Es werden die Grundformen der Gewaltprävention nach Martin sowie das Präventionskonzept von Nolting und ausgewählte Präventionsprogramme (Patterson, Petermann/Petermann, Guggenbühl, Olweus) detailliert dargestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Aggression, Gewalt, Gewaltprävention, Heranwachsende, Schule, Familie, Medien, Peergroups, Lerntheorien, Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Theorie, Präventionsprogramme, Intervention, Soziales Lernen, Konfliktlösung, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aggression und Gewalt bei Heranwachsenden
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Aggression und Gewalt bei Jugendlichen im schulischen Kontext und konzentriert sich auf präventive Maßnahmen. Sie umfasst eine umfassende Definition von Aggression und Gewalt, die Analyse verschiedener Erklärungsansätze (Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Theorie, Lerntheorien), die Betrachtung von Einflussfaktoren (Familie, Medien, Schule, Peergroups) und die Evaluierung bestehender Präventionsprogramme.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Differenzierung von Aggression und Gewalt; Erklärungsansätze für aggressives Verhalten; Einflussfaktoren auf aggressives Verhalten (Familie, Medien, Schule, Peergroups); Präventionsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen (individuell, klassenbezogen, schulbezogen); Bewertung bestehender Präventionsprogramme; Konkrete Beispiele für Präventionsprogramme (z.B. Patterson, Petermann/Petermann, Guggenbühl, Olweus); Analyse verschiedener Aggressionsfelder (persönlich, Familie, Medien, Schule, Peergroups); Diskussion von Gewaltpräventionsansätzen auf verschiedenen Ebenen.
Welche Theorien zur Erklärung aggressiven Verhaltens werden behandelt?
Die Arbeit analysiert Triebtheorien (Freud, Lorenz), die Frustrations-Aggressions-Theorie und lernpsychologische Ansätze (klassisches und operantes Konditionieren, Beobachtungslernen, kognitives Lernen). Die Stärken und Schwächen der einzelnen Theorien werden kritisch diskutiert.
Welche Präventionsprogramme werden vorgestellt und bewertet?
Die Arbeit stellt und analysiert verschiedene Präventionsprogramme vor, darunter Familien-Management nach Patterson, Training mit aggressiven Kindern nach Petermann/Petermann, Interventionsprogramm in schwierigen Schulklassen nach Guggenbühl und das schulische Interventionsprogramm nach Olweus. Die drei Präventionsebenen nach Caplan (primär, sekundär, tertiär) werden ebenfalls erläutert.
Welche Aggressionsfelder werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss persönlicher Faktoren (Geschlecht, Persönlichkeit), familiärer Einflüsse (Erziehungsstile, Gewalt in der Familie), Medienkonsum, der Schule als Institution und Peergroups auf die Entstehung und Ausprägung von Aggression.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition, Entstehungsmechanismen, Erklärungspositionen aggressiven Verhaltens, Aggressionsfelder und Gewaltprävention. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Bild der Problematik von Aggression und Gewalt bei Heranwachsenden im schulischen Kontext zu zeichnen und praktikable Lösungsansätze für die Schule zu entwickeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Aggression, Gewalt, Gewaltprävention, Heranwachsende, Schule, Familie, Medien, Peergroups, Lerntheorien, Triebtheorien, Frustrations-Aggressions-Theorie, Präventionsprogramme, Intervention, Soziales Lernen, Konfliktlösung, Erziehung.
- Quote paper
- Verena Starowiecki (Author), 2005, Gewalt an Schulen. Ein Beitrag zur Prävention im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45004