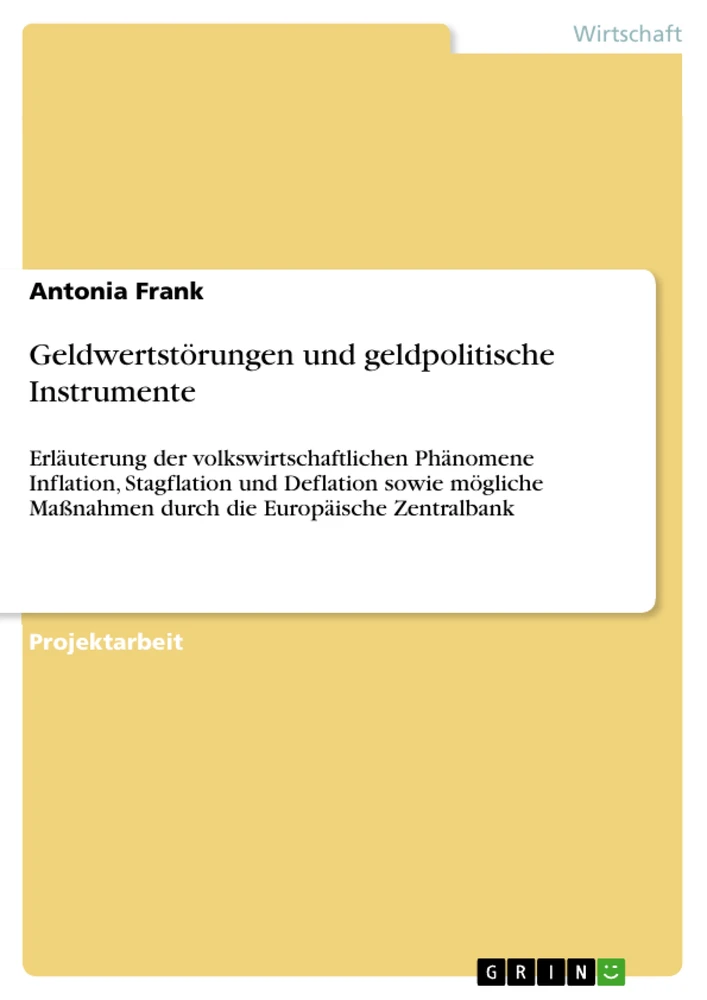Geld begleitet Menschen im täglichen Leben. Doch was bezeichnet der Begriff „Geld“ eigentlich? Die Literatur und die allgemeine Auffassungsweise der Bevölkerung bieten auf diese Frage zahlreiche Antworten, welche die universelle Rolle des Geldes reflektiert. Als Geld wird ein Zahlungsmittel bezeichnet, das es dessen Inhabern erlaubt Geldschulden gegenüber dem Staat, Unternehmen und Haushalten zu begleichen. Menschen sagen „Bares ist Wahres“ und es scheint, als würde die Allgemeinheit Geld als Ausdruck von Münzen und Banknoten sehen. Jedoch sind circa 92 Prozent der Geldmenge nur digital vorhanden und spiegeln ein Verhältnis zwischen Schuld und Anspruch wieder. Ebenfalls gilt Geld als Treibmittel für den sozialen Fortschritt. Der amerikanische Autor Lewis H. Lapham bezeichnet Geld als „einen der Grundstoffe, mit denen die Menschheit die Architektur der Zivilisation errichtet.“. Geld ist somit nicht nur der Stoff mit dem Menschen ihrer Bedürfnisbefriedigung nachgehen, sondern auch Grundstein für ein zivilisiertes gesellschaftliches Leben. Fakt ist, dass sich die Bedeutung von Geld im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und so wurde aus dem Warengeld, welches die Basis für die Tauschwirtschaft bildete, das Fiatgeld. Dabei handelt es sich um ein gesetzliches Zahlungsmittel, welches von Zentralbanken ausgegeben wird und nicht nur in physischer sondern auch in digitaler Form existiert. Geld fungiert heutzutage als Tausch- und Zahlungsmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrungs- und Wertübertragungsmittel. Vor allem die Funktion der Wertaufbewahrung verspricht, das Geld für eine gewisse Zeit in der Zukunft seinen Wert behält. Aber was geschieht, wenn sich der Wert des Geldes zu verändern droht? Aufgrund dessen soll die Veränderung des Geldwertes die Basis dieser Arbeit darstellen.
Die zentrale Zielfrage der Arbeit ist: „Welche geldpolitischen Instrumente stehen der Europäischen Zentralbank zur Verfügung, um auf die verschiedenen Geldwertstörungen innerhalb einer Volkswirtschaft zu reagieren und welche Wirkungen bringen sowohl die Störungen des Geldwertes als auch die Maßnahmen des Entgegenwirkens mit sich?“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geldwertstörungen: Ursachen und Auswirkungen auf Volkswirtschaften
- 2.1. Inflation
- 2.2. Stagflation
- 2.3. Deflation
- 3. Geldpolitische Instrumente der EZB und deren Wirkungen
- 3.1. Mindestreserve
- 3.2. Offenmarktgeschäfte
- 3.3. Ständige Fazilitäten
- 3.4. Wirkungsketten geldpolitischer Instrumente
- 4. Mögliche Maßnahmen des Staates gegen drohende Störungen des Geldwertes
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Reaktion auf Geldwertstörungen wie Inflation, Stagflation und Deflation. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Auswirkungen dieser Störungen und beleuchtet die Wirkungsweise der EZB-Instrumente. Der Fokus liegt auf der präzisen Darstellung der Inflation und der Wirkungszusammenhänge zwischen geldpolitischen Maßnahmen und dem Wirtschaftsgeschehen.
- Geldwertstörungen (Inflation, Stagflation, Deflation)
- Ursachen und Auswirkungen von Geldwertstörungen
- Geldpolitische Instrumente der EZB (Mindestreserve, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten)
- Wirkungsketten geldpolitischer Maßnahmen
- Mögliche staatliche Maßnahmen gegen Geldwertstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und definiert den Begriff „Geld“ in seinen verschiedenen Funktionen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Geldes vom Warengeld zum Fiatgeld und hebt die Bedeutung der Wertaufbewahrungsfunktion hervor. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert: Welche geldpolitischen Instrumente stehen der EZB zur Verfügung, um auf Geldwertstörungen zu reagieren, und welche Auswirkungen haben diese Störungen und die Gegenmaßnahmen? Die Struktur der Arbeit wird skizziert, wobei der Schwerpunkt auf der Analyse von Inflation, den EZB-Instrumenten und deren Wirkungszusammenhängen liegt.
2. Geldwertstörungen: Ursachen und Auswirkungen auf Volkswirtschaften: Dieses Kapitel behandelt die drei Hauptformen von Geldwertstörungen: Inflation, Stagflation und Deflation. Es erläutert die Ursachen und Folgen dieser Störungen im Kontext des magischen Vierecks der Wirtschaftspolitik. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) als Indikator für Preisniveaustabilität wird vorgestellt. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung der Inflation und ihrer Auswirkungen auf die Kaufkraft des Geldes, das Sparverhalten und die allgemeine Wirtschaft.
Schlüsselwörter
Geldwertstörungen, Inflation, Stagflation, Deflation, Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Mindestreserve, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Preisniveaustabilität, Kaufkraft, Wirtschaftspolitik, Wirkungsketten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Geldpolitische Instrumente der EZB
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit analysiert die geldpolitischen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Reaktion auf Geldwertstörungen wie Inflation, Stagflation und Deflation. Sie untersucht die Ursachen und Auswirkungen dieser Störungen und beleuchtet die Wirkungsweise der EZB-Instrumente. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Inflation und der Wirkungszusammenhänge zwischen geldpolitischen Maßnahmen und dem Wirtschaftsgeschehen.
Welche Geldwertstörungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Inflation, Stagflation und Deflation. Für jede Störung werden Ursachen und Auswirkungen im Kontext des magischen Vierecks der Wirtschaftspolitik erläutert. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) als Indikator für Preisniveaustabilität wird ebenfalls vorgestellt.
Welche geldpolitischen Instrumente der EZB werden untersucht?
Die Projektarbeit untersucht die folgenden geldpolitischen Instrumente der EZB: Mindestreserve, Offenmarktgeschäfte und ständige Fazilitäten. Die Wirkungsweise dieser Instrumente und ihre Wirkungsketten werden detailliert beschrieben.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben den geldpolitischen Instrumenten der EZB werden auch mögliche staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwertstörungen behandelt. Die Einleitung definiert den Begriff "Geld" in seinen verschiedenen Funktionen und skizziert seine historische Entwicklung. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Geldwertstörungen, ein Kapitel zu den geldpolitischen Instrumenten der EZB, ein Kapitel zu möglichen staatlichen Maßnahmen und ein abschließendes Fazit mit Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Geldwertstörungen, Inflation, Stagflation, Deflation, Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Mindestreserve, Offenmarktgeschäfte, Ständige Fazilitäten, Preisniveaustabilität, Kaufkraft, Wirtschaftspolitik, Wirkungsketten.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist im Dokument enthalten und beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert. Die Zusammenfassung der Einleitung beinhaltet die zentrale Forschungsfrage der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Geldpolitik und Wirtschaftswissenschaften.
- Citation du texte
- Antonia Frank (Auteur), 2018, Geldwertstörungen und geldpolitische Instrumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450061