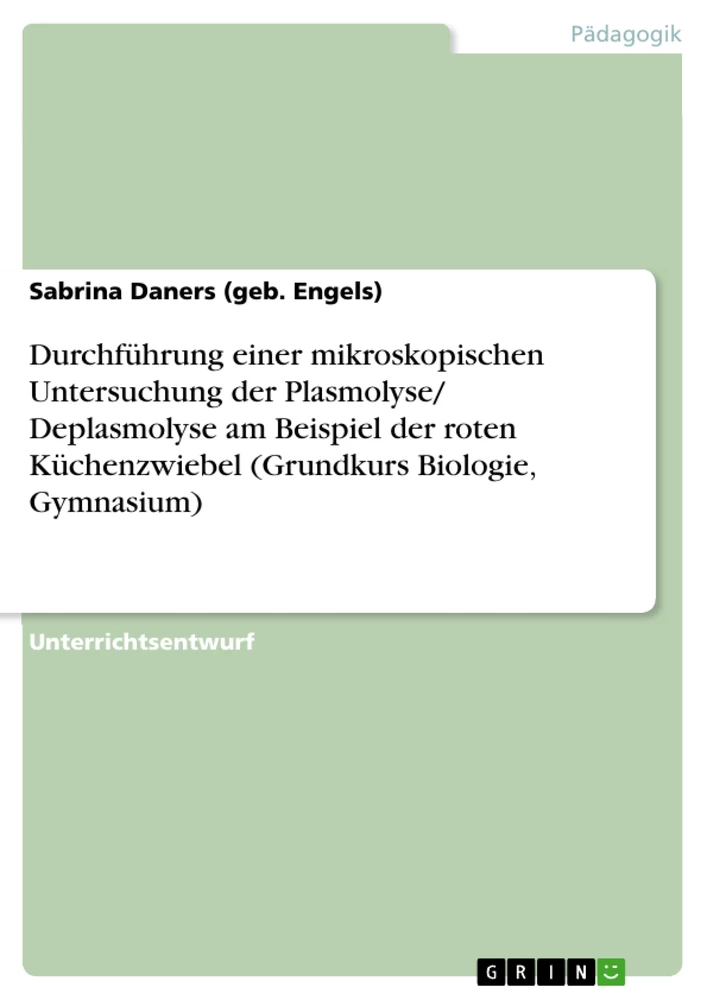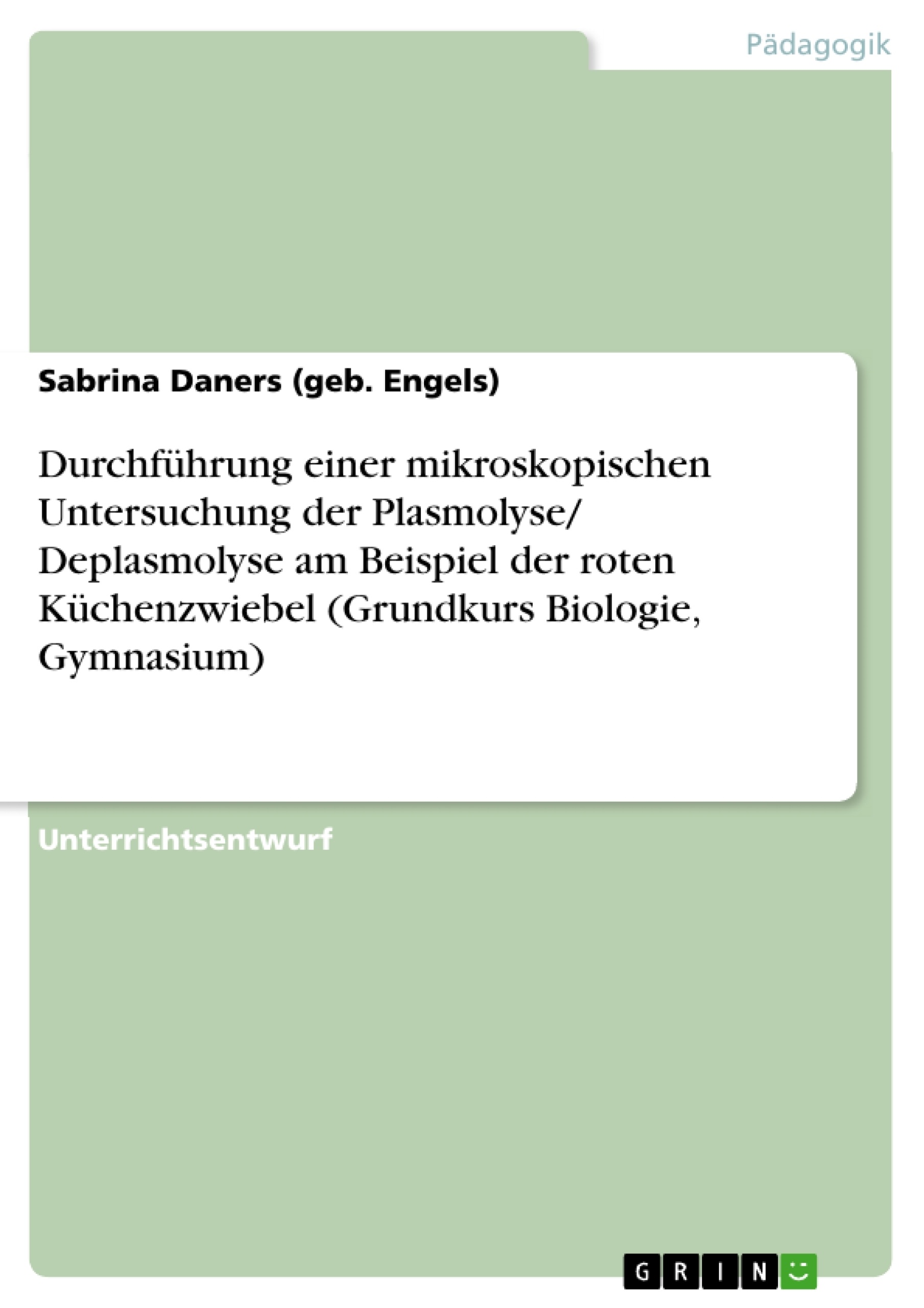Thema der Unterrichtsreihe: Zellbiologie
Thema der Unterrichtsstunde: Durchführung einer mikroskopischen Untersuchung der Plasmolyse/Deplasmolyse am Beispiel der roten Küchenzwiebel.
Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe:
- Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie;
- Aufbau der pflanzlichen Zelle: Elodea und rote Küchenzwiebel;
- Aufbau der tierischen Zelle: menschliche Mundschleimhaut;
- Organisation der Lebewesen;
- Differenzierung pflanzlicher und tierischer Gewebe;
- Mitose;
- Vakuole und Zellsaft;
- Kohlenhydrate als Reservestoffe in der Vakuole;
- Molekularer Aufbau der Kohlenhydrate (Glucose, Fructose, Saccharose);
- Struktur und Funktion der Zellwand (Cellulose);
- Plasmolyse und Deplasmolyse (praktischer Versuch);
- Anschließende Stunde - theoretische Grundlagen der Plasmolyse und Deplamolyse
Inhaltsverzeichnis
- Thema der Unterrichtsreihe: Zellbiologie
- Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie
- Aufbau der pflanzlichen Zelle: Elodea und rote Küchenzwiebel
- Aufbau der tierischen Zelle: menschliche Mundschleimhaut
- Organisation der Lebewesen
- Differenzierung pflanzlicher und tierischer Gewebe
- Mitose
- Vakuole und Zellsaft
- Kohlenhydrate als Reservestoffe in der Vakuole
- Molekularer Aufbau der Kohlenhydrate (Glucose, Fructose, Saccharose)
- Struktur und Funktion der Zellwand (Cellulose)
- Plasmolyse und Deplasmolyse (praktischer Versuch)
- Anschließende Stunde → theoretische Grundlagen der Plasmolyse und Deplamolyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde soll die Schüler dazu befähigen, ausgehend von einem alltäglichen Phänomen, die Plasmolyse/Deplasmolyse am Beispiel der roten Küchenzwiebel mikroskopisch zu untersuchen, zeichnerisch darzustellen und mit Hilfe ihrer Beobachtungen und ihres Vorwissens zu erklären. Die Schüler sollen Hypothesen formulieren, die mit Hilfe ihrer Kenntnisse über biologische Untersuchungsmethoden überprüft werden können.
- Mikroskopische Untersuchung der Plasmolyse/Deplasmolyse
- Zeichnerische Darstellung der Beobachtungen
- Erklärung des beobachteten Phänomens
- Entwicklung von Strategien zur Untersuchung des Problems
- Hypothesenbildung und -überprüfung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Stunde beginnt mit einer kurzen Einführung in das Thema Plasmolyse/Deplasmolyse, das an ein alltägliches Phänomen, das Salzen eines Gurkensalats, geknüpft wird. Die Schüler sollen Hypothesen aufstellen, die sie im weiteren Verlauf der Stunde überprüfen können.
- Durchführung des Versuchs: Die Schüler führen selbständig einen Versuch zur Plasmolyse/Deplasmolyse an roten Küchenzwiebeln durch. Dabei sollen sie die Wirkung von Kochsalzlösung auf die pflanzliche Zelle beobachten und dokumentieren.
- Auswertung des Versuchs: Anhand der beobachteten Ergebnisse sollen die Schüler ihre Hypothesen überprüfen und das Phänomen der Plasmolyse/Deplasmolyse erklären. Sie zeichnen ihre Beobachtungen und diskutieren diese im Plenum.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Unterrichtsstunde sind: Plasmolyse, Deplasmolyse, rote Küchenzwiebel, Mikroskopie, Hypothesenbildung, Versuchsdurchführung, Auswertung, Beobachtung, Zeichnung, pflanzliche Zelle, Zellwand, Vakuole, Turgor, Osmose, Diffusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Versuchs zur Plasmolyse?
Schüler sollen mikroskopisch beobachten, wie sich der Zellinhalt bei Zugabe von Salzlösung von der Zellwand ablöst und diesen Vorgang zeichnerisch dokumentieren.
Warum wird die rote Küchenzwiebel als Beispiel verwendet?
Die Zellen der roten Küchenzwiebel besitzen einen farbigen Zellsaft in der Vakuole, wodurch die Veränderungen bei der Plasmolyse unter dem Mikroskop besonders gut sichtbar sind.
Was ist der Unterschied zwischen Plasmolyse und Deplasmolyse?
Plasmolyse ist das Ablösen des Protoplasten von der Zellwand durch Wasserentzug (Salzlösung). Deplasmolyse ist der umgekehrte Vorgang, bei dem die Zelle wieder Wasser aufnimmt (destilliertes Wasser).
Welches Alltagsphänomen dient als Einstieg in die Stunde?
Das Salzen eines Gurkensalats, bei dem die Gurkenscheiben nach kurzer Zeit „wässrig“ und schlaff werden, dient als Ausgangspunkt für die Hypothesenbildung.
Welche Rolle spielt die Vakuole bei diesem Vorgang?
Die Vakuole speichert den Zellsaft. Durch Osmose verliert sie bei der Plasmolyse Wasser, wodurch der Turgor (Zellinnendruck) sinkt und die Zelle schrumpft.
- Quote paper
- Sabrina Daners (geb. Engels) (Author), 2006, Durchführung einer mikroskopischen Untersuchung der Plasmolyse/ Deplasmolyse am Beispiel der roten Küchenzwiebel (Grundkurs Biologie, Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450130