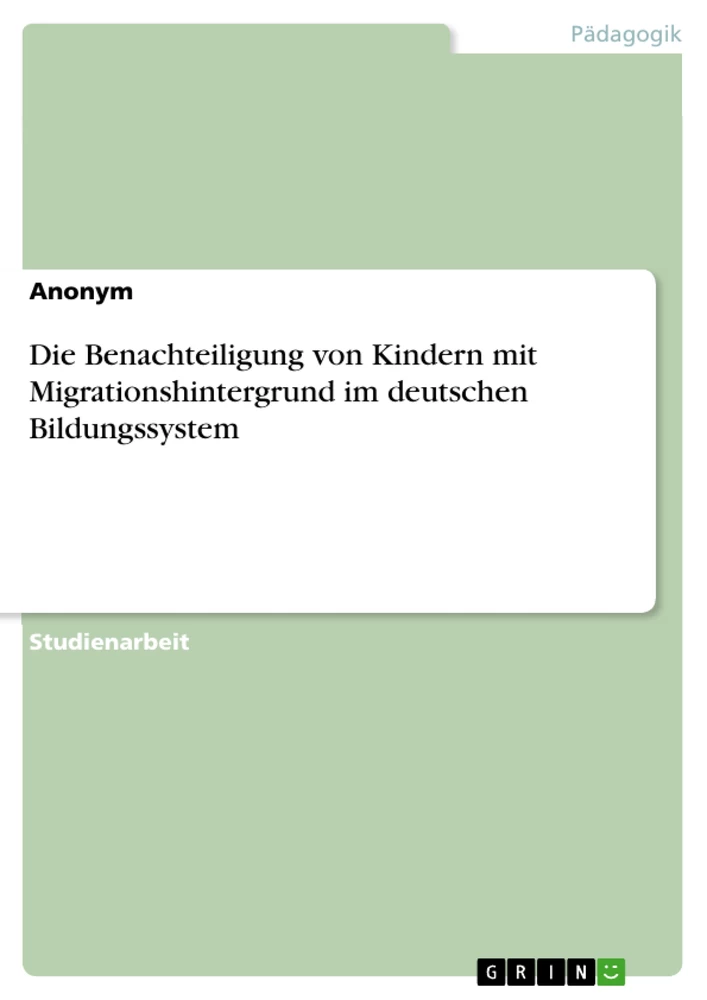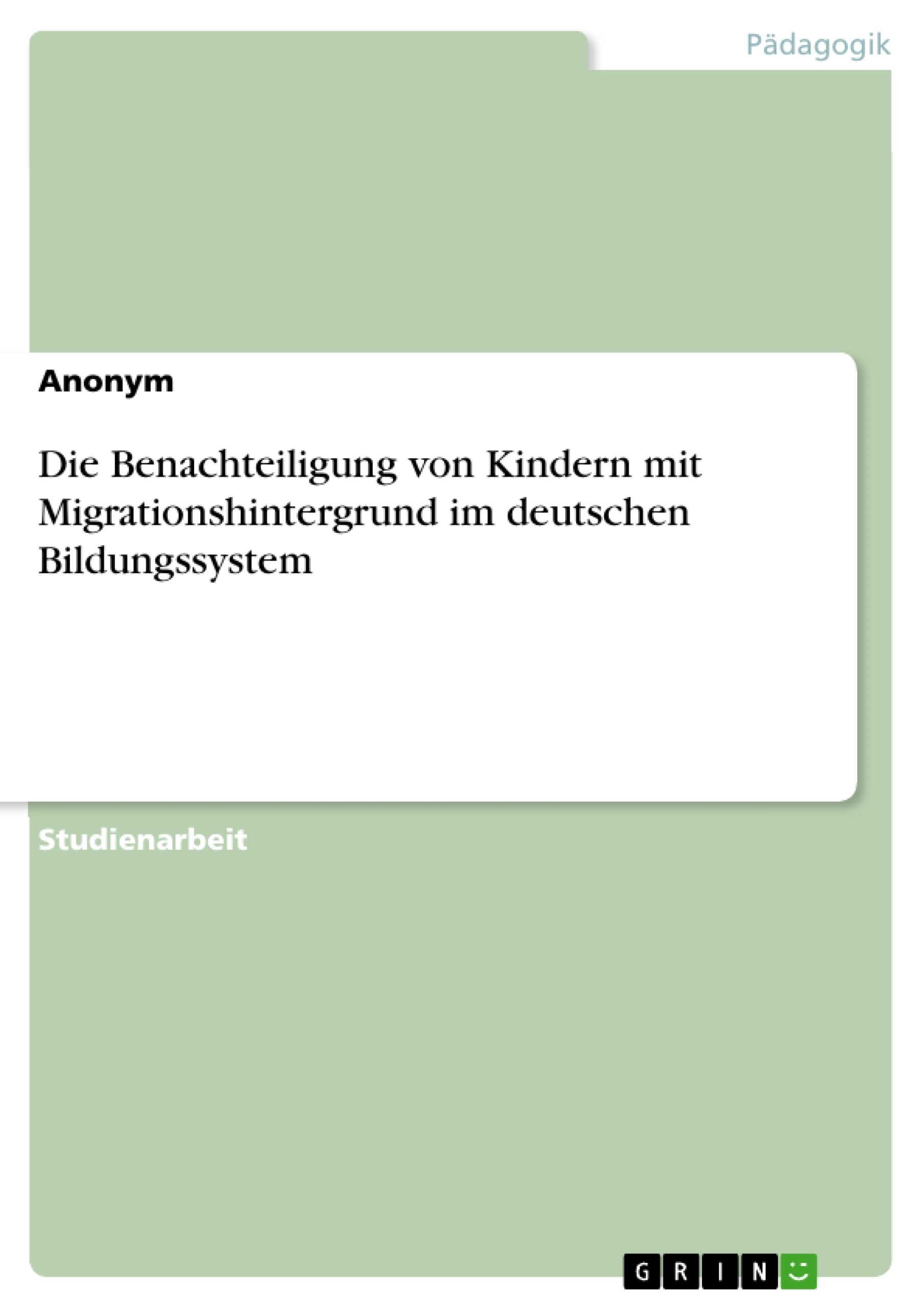Zum einen schreibt die Autorin etwas Allgemeines über die internationalen Schulleistungsstudien, da sie dazu beigetragen haben, dass die Diskriminierungen des Bildungssystems gegenüber Migrantenkinder Achtsamkeit gewonnen haben. Als Beispiele für diese Studien nennt die Autorin als erstes die PISA-Studie, die im Jahre 2000 erstmals stattgefunden hat. Diese hat die Schüler im Alter von 15 Jahren über die Kompetenzbereiche der Lesekompetenz, der mathematischen Grundbildung und der naturwissenschaftlichen Grundbildung getestet. Als zweites Beispiel erläutert die Autorin die IGLU-Studie, welche die Kinder der vierten Klasse auf ihre Lesekompetenz getestet hat. In beiden Studien kam heraus, dass der schulische Erfolg eng an die soziale Herkunft geknüpft sei. Vor allem war damit die Gruppe der Schüler-/innen gemeint, die aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen mit nicht-deutscher Familiensprache stammen. Trotz, dass sie hier geboren sind oder ihre Bildungslaufbahn in Deutschland durchlaufen haben, konnten sie nur ungenügend lesen, schreiben und rechnen. Für die Bildungsbenachteiligung der Schüler mit Migrationshintergrund spielt außer dem Faktor der Herkunft aber auch die Subjektivität seitens der Lehrkräfte und die Schule als Institution eine große Rolle.
Weiter bezieht sie sich auf die institutionelle Diskriminierung. Dort schreibt die Autorin über die Ungleichbehandlung von Personen durch das organisatorische Handeln gesellschaftlicher Institutionen. Anschließend bezieht sie sich auf die institutionelle Diskriminierung in der Institution Schule, da ihr als Institution die Zuteilung von Statuspositionen vorgeworfen wird. Das Thema der Selektion in der Schule soll diese Diskriminierungsthese der Schule näher erläutern.
Die Autorin verschafft einen Einblick, wie sich die genannten Probleme auflösen könnten. Dieses Thema soll dazu beitragen, in Zukunft auf die Bildungsbenachteiligung zu achten und den in dem Bildungssystem vorhandenen Diskriminierungen entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Internationale Schulleistungsstudien am Beispiel von PISA und IGLU
- PISA
- IGLU
- Institutionelle Diskriminierung
- Institutionelle Diskriminierung in der Schule
- Selektion in der Schule
- Mögliche Gründe für die Benachteiligung von Migrantenkindern
- Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem und untersucht, ob die Rede von Benachteiligung oder Ungerechtigkeit gegenüber Migrantenkindern gerechtfertigt ist. Die Autorin analysiert internationale Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU, beleuchtet die institutionelle Diskriminierung in der Schule und erörtert mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen.
- Analyse der Ergebnisse von internationalen Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU im Hinblick auf die Leistungen von Migrantenkindern
- Untersuchung der institutionellen Diskriminierung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem
- Identifizierung von möglichen Gründen für die Benachteiligung von Migrantenkindern
- Bewertung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen für Migrantenkinder
- Diskussion der Frage, ob die Rede von Benachteiligung oder Ungerechtigkeit gegenüber Migrantenkindern gerechtfertigt ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die leitende Fragestellung vor. Sie gibt einen Überblick über die Themenbereiche, die in der Arbeit behandelt werden.
Kapitel 2 befasst sich mit internationalen Schulleistungsstudien wie PISA und IGLU. Es wird erläutert, wie diese Studien die Diskriminierung von Migrantenkindern im Bildungssystem aufgezeigt haben. Insbesondere wird auf die Ergebnisse der PISA- und IGLU-Studien eingegangen, die einen Zusammenhang zwischen dem Bildungserfolg und der sozialen Herkunft der Schüler aufzeigen.
Kapitel 3 behandelt die institutionelle Diskriminierung von Migrantenkindern in der Schule. Die Autorin geht auf die ungleiche Behandlung von Personen durch das organisatorische Handeln gesellschaftlicher Institutionen ein und untersucht die institutionelle Diskriminierung in der Schule als Institution, die Statuspositionen vergibt. Die Selektion in der Schule wird als Beispiel für diese Diskriminierungsthese betrachtet.
Kapitel 4 beleuchtet mögliche Gründe für die Benachteiligung von Migrantenkindern. Es werden Faktoren wie die Subjektivität der Lehrkräfte und die Rolle der Schule als Institution berücksichtigt.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen für Migrantenkinder. Es werden Vorschläge für eine gerechtere Bildungslandschaft vorgestellt, die dazu beitragen sollen, der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern entgegenzuwirken.
Kapitel 6 beinhaltet eine kritische Würdigung der Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit. Es wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Schlussfolgerungen präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, Schulleistungsstudien (PISA, IGLU), institutionelle Diskriminierung, Bildungschancen, soziale Herkunft, Inklusion, Integration, Interkulturelle Kompetenz, Deutsch als Fremdsprache, Interkulturelle Pädagogik, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigen PISA und IGLU über Kinder mit Migrationshintergrund?
Die Studien belegen, dass der schulische Erfolg in Deutschland stark an die soziale Herkunft geknüpft ist und Kinder aus benachteiligten Migrantenfamilien oft geringere Kompetenzen aufweisen.
Was versteht man unter institutioneller Diskriminierung?
Es handelt sich um die Ungleichbehandlung von Personen durch organisatorische Strukturen und Regeln gesellschaftlicher Institutionen wie der Schule.
Welche Rolle spielen Lehrkräfte bei der Benachteiligung?
Die Subjektivität von Lehrkräften bei der Leistungsbewertung und Empfehlungen für weiterführende Schulen kann zur Benachteiligung von Migrantenkindern beitragen.
Warum ist die Selektion in der Schule problematisch?
Die frühe Aufteilung auf verschiedene Schulformen verfestigt oft soziale Unterschiede, anstatt sie auszugleichen, was Migrantenkinder überproportional trifft.
Wie können die Bildungschancen verbessert werden?
Maßnahmen wie interkulturelle Pädagogik, gezielte Sprachförderung und eine Sensibilisierung für institutionelle Diskriminierung sind zentrale Lösungsansätze.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450202