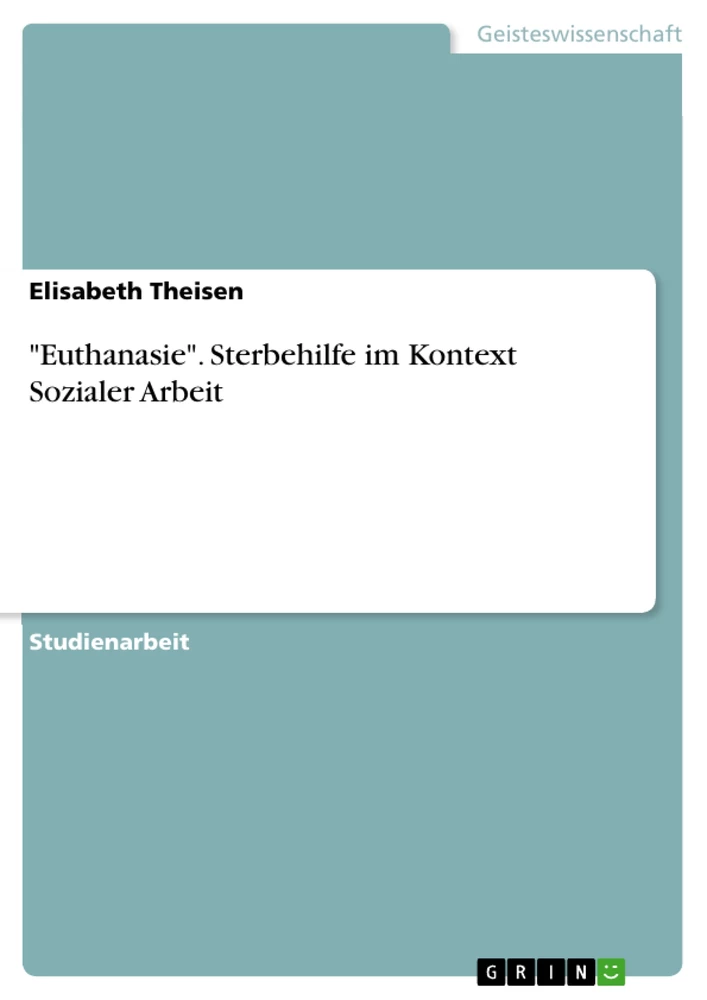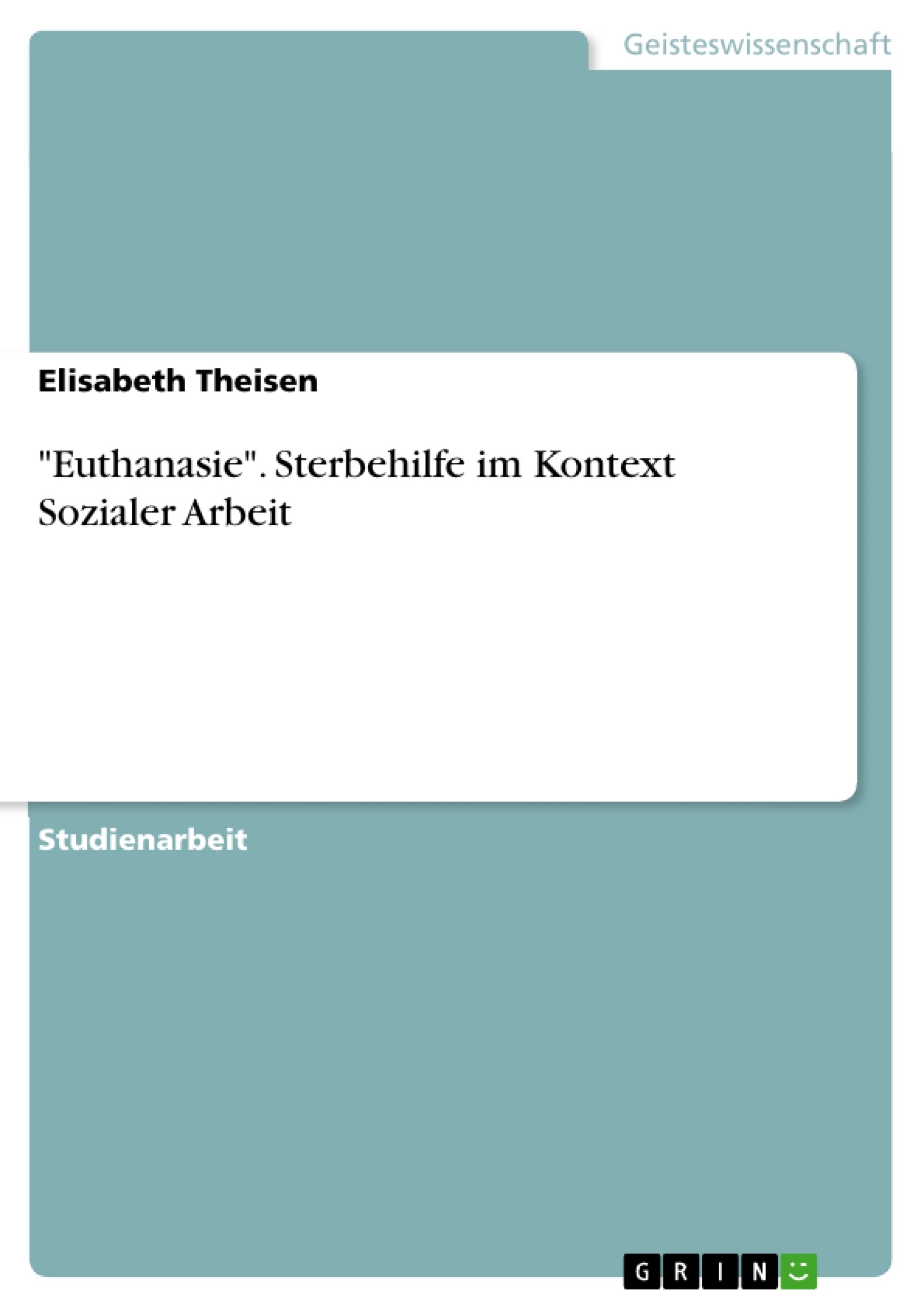In dieser Hausarbeit soll es um den Tod, insbesondere um die Sterbehilfe, auch Euthanasie genannt, gehen.
Das erste Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Arten der Sterbehilfe. Unter 2.1 wird auf die aktive direkte Sterbehilfe, in 2.2 auf die aktive indirekte Sterbehilfe, in 2.3 auf die passive Sterbehilfe und in Kapitel 2.4 auf die Beihilfe zum Suizid eingegangen. Gerade in Deutschland ist die Sterbehilfe ein sehr ethisch umstrittenes Thema. Hierzu werde ich unter 3.ff auf die rechtlichen Hintergründe in Deutschland und im europäischen Ausland eingehen. In 4. werden die ethischen Aspekte zur Sterbehilfe beleuchtet. Hierzu zählt ebenfalls das grundlegende, theoretische Verständnis von Sozialer Arbeit. Was kann die Soziale Arbeit im Rahmen von Sterbehilfe professionell beitragen? Ich werde in 4.1 auf die Soziale Arbeit im Hospizbereich eingehen und in 4.2 und 4.3 die Soziale Arbeit in der Sterbebegleitung/ -betreuung und in der Trauerarbeit/ -begleitung der Hinterbliebenen erläutern, welche für die Soziale Arbeit wesentlich sind und auch ineinander übergehen können. Denn nicht nur der Betroffene benötigt Beratung und Begleitung, sondern auch die Hinterbliebenen und Angehörigen benötigen eine Unterstützung. Gerade bei der Sterbehilfe wünschen sich die Menschen Akzeptanz und Verständnis und dies hat mich auch zu dieser Hausarbeit bewegt. Denn wenn der Mensch auf Grund einer Krankheit sein Leben nicht mehr lebenswert weiterführen kann, so finde ich, soll er doch das Recht haben selbst zu entscheiden um in Würde gehen zu können. In der heutigen Gesellschaft wird deutlich, dass ein langes Leben und nicht der Tod gewollt ist. Die Medizin entwickelt ungeahnte Möglichkeiten, ein Leben auch künstlich weiter zu erhalten, auch wenn es vielen nicht mehr lebenswert ist. Auch der Suizid findet in unserer heutigen keine Akzeptanz. Hierzu werde ich unter 5. das Verständnis von Würde in Bezug auf die Sterbehilfe erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arten der Sterbehilfe
- Aktive direkte Sterbehilfe
- Aktive indirekte Sterbehilfe
- Passive Sterbehilfe
- Beihilfe zum Suizid
- Rechtliche Hintergründe zur Sterbehilfe
- Deutsche Rechtslagen
- Rechtslagen im europäischen Ausland
- Niederlande
- Belgien
- Schweiz
- Sterbehilfe im Kontext Sozialer Arbeit
- Soziale Arbeit im Hospizbereich
- Sterbebegleitung/ -betreuung
- Trauerarbeit/ -begleitung
- Sterbehilfe und Ethik
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem komplexen Thema der Sterbehilfe, auch bekannt als Euthanasie, im Kontext der Sozialen Arbeit. Die Arbeit analysiert verschiedene Arten der Sterbehilfe, beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und im europäischen Ausland und untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung und -betreuung.
- Verschiedene Arten der Sterbehilfe
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Sterbehilfe in Deutschland und Europa
- Ethische Aspekte der Sterbehilfe
- Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Sterbebegleitung und -betreuung
- Das Konzept der Würde im Kontext der Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung präsentiert das Thema Sterbehilfe und die Relevanz der Thematik. Es wird auf die verschiedenen Arten der Sterbehilfe eingegangen und die rechtlichen und ethischen Aspekte werden kurz beleuchtet.
- Arten der Sterbehilfe: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Arten der Sterbehilfe, darunter aktive direkte Sterbehilfe, aktive indirekte Sterbehilfe, passive Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid.
- Rechtliche Hintergründe zur Sterbehilfe: Der Abschnitt fokussiert auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sterbehilfe in Deutschland und im europäischen Ausland. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Rechtslagen beleuchtet.
- Sterbehilfe im Kontext Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit im Hospizbereich, in der Sterbebegleitung und -betreuung sowie in der Trauerarbeit und -begleitung.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt Schlüsselthemen wie Sterbehilfe, Euthanasie, aktive und passive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid, rechtliche Rahmenbedingungen, Soziale Arbeit, Hospizbereich, Sterbebegleitung, Trauerarbeit, Ethik und Würde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Aktive Sterbehilfe ist die gezielte Herbeiführung des Todes, während passive Sterbehilfe den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen bezeichnet.
Wie ist die rechtliche Lage der Sterbehilfe in Deutschland?
Die Rechtslage in Deutschland ist ethisch und juristisch stark umstritten und unterscheidet sich deutlich von liberaleren Modellen in Ländern wie den Niederlanden oder Belgien.
Welche Aufgaben hat die Soziale Arbeit im Hospizbereich?
Sie umfasst die psychosoziale Begleitung Sterbender, die Beratung von Angehörigen und die Unterstützung bei der Bewältigung administrativer und emotionaler Lasten.
Was bedeutet "Beihilfe zum Suizid"?
Hierbei leistet eine Person (z. B. ein Arzt) Hilfe zur Selbsttötung, indem sie beispielsweise ein tödliches Medikament bereitstellt, das der Patient selbst einnimmt.
Warum ist das Konzept der Würde zentral in der Sterbehilfedebatte?
Es geht um die Frage, ob das Recht auf ein würdevolles Sterben auch die Selbstbestimmung über den Zeitpunkt und die Art des Todes einschließt.
- Quote paper
- Elisabeth Theisen (Author), 2017, "Euthanasie". Sterbehilfe im Kontext Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450224