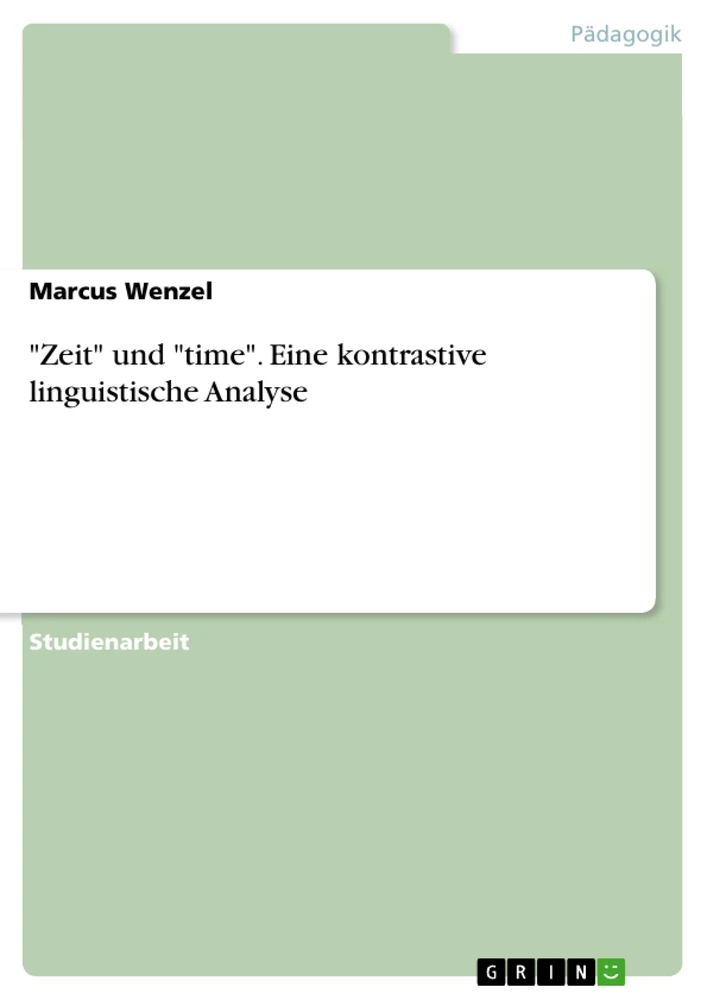Mit dem Aufkeimen der kontrastiven Linguistik, durch die Ideen des klassischen Strukturalismus initiiert, begann die Sprachwissenschaft eine vergleichende Forschung von verschiedenen Sprachsystemen auf phonologischer, morphologischer und Syntaxebene einzuführen. Man wählte diese Ebenen zu Analyse, da sie eine relative Geschlossenheit im Sprachsystem besaßen und somit möglichst detailliert und präzise auf Unterschiede hin untersucht werden konnten. Um eine Sprache jedoch im Ganzen analysieren zu können, müssen auch offenere Sprachsysteme einen Platz in der kontrastiven Linguistik finden.
Aus diesem Grund spielt die lexikalische Ebene einer Sprache in der gegenwärtigen Forschung eine zentrale Rolle. Aufgrund der Öffnung dieses Gebietes stellte Kurt jedoch fest, es sei „im Gegensatz zu den genannten entsprechend schwieriger zu analysieren und zu systematisieren“.
Versucht man nun, die Begriffe der Zeit und time auf dieser offenen und somit auch komplexeren Ebene zu untersuchen, kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu. Oft gründen sich Kontraste im Wortschatz auch auf Kontraste im Weltbild. Gerade bei abstrakten Ideen, wie die von Zeit und Raum besitzt eine Sprache oft ganz eigene „universalistische und philosophische Aspekte“. Diese Aspekte stellen nicht selten eine Grenze für die Vergleichbarkeit von Sprachen dar.
In der folgenden Gegenüberstellung von Zeit und time wird nun versucht, sich möglichst nah an diese Grenze heranzutasten.
Inhaltsverzeichnis
- Das Konstrukt der Zeit
- Der Vergleich von time und Zeit
- Etymologie
- Polysemie
- Die Zeitmessung
- Der Vergleich von second und Sekunde + minute und Minute
- Der Vergleich von hour und Stunde
- Der Vergleich von day und Tag
- Der Vergleich von week und Woche
- Der Vergleich von year und Jahr
- Decade-century - millenium
- Jahrzehnt-Jahrhundert - Jahrtausend
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Konzepte von Zeit und time im Deutschen und Englischen, untersucht etymologische und semantische Gemeinsamkeiten und Unterschiede und vergleicht die Zeitmessung in beiden Sprachen.
- Das Konstrukt der Zeit in beiden Sprachen
- Etymologie und semantische Entwicklung von Zeit und time
- Kontrastiver Vergleich der Zeitmessungseinheiten
- Untersuchung der philosophischen und universalistischen Aspekte der Zeit
- Der Einfluss der Zeitmessung auf die Entwicklung des Zeitverständnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Das Konstrukt der Zeit: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Zeitkonzepts, insbesondere die Bedeutung der Zeitmessung für die menschliche Erfahrung. Dabei werden die verschiedenen Einteilungen der Zeit, wie Tag, Woche, Jahr etc., betrachtet und ihre Bedeutung im Kontext der menschlichen Wahrnehmung und Organisation des Lebens beleuchtet.
Der Vergleich von time und Zeit: Dieses Kapitel stellt den Begriff time im Englischen dem deutschen Zeit gegenüber. Es analysiert die etymologischen Wurzeln beider Begriffe und die semantische Entwicklung. Dabei werden die unterschiedlichen Bedeutungen von time und Zeit im Kontext ihrer historischen Entwicklung und sprachlichen Entwicklung beleuchtet.
Die Zeitmessung: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der Zeitmessung in beiden Sprachen. Es werden die Unterschiede in der Verwendung und Bedeutung von Zeitmessungseinheiten wie Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche und Jahr betrachtet. Die etymologischen und semantischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen werden untersucht, um ein umfassendes Bild der Zeitmessung in beiden Sprachen zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Konzepte von Zeit und time, untersucht die etymologische und semantische Entwicklung beider Begriffe sowie die Zeitmessung in beiden Sprachen. Die Untersuchung umfasst wichtige Schlüsselwörter wie Zeitmessungseinheiten, etymologische Wurzeln, semantische Entwicklung, kontrastive Linguistik, Zeitverständnis, kulturelle Unterschiede und universalistische Aspekte der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer kontrastiven linguistischen Analyse von "Zeit" und "time"?
Ziel ist der Vergleich der Sprachsysteme auf lexikalischer Ebene, um etymologische und semantische Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten im Weltbild beider Sprachen aufzuzeigen.
Warum ist die Analyse auf lexikalischer Ebene besonders komplex?
Im Gegensatz zu Phonologie oder Syntax ist der Wortschatz ein offenes System, das stark von philosophischen Aspekten und dem kulturellen Weltbild geprägt ist.
Wie unterscheiden sich die Begriffe etymologisch?
Die Arbeit untersucht die historischen Wurzeln von "time" und "Zeit" und wie sich deren Polysemie (Mehrdeutigkeit) im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.
Welche Zeitmessungseinheiten werden verglichen?
Es erfolgt ein direkter Vergleich von Einheiten wie Sekunde/second, Minute/minute, Stunde/hour, Tag/day, Woche/week und Jahr/year sowie größeren Zeitspannen.
Welchen Einfluss hat die Zeitmessung auf das Zeitverständnis?
Die Arbeit beleuchtet, wie die Einteilung der Zeit die menschliche Wahrnehmung und die Organisation des Lebens in beiden Sprachräumen strukturiert.
- Arbeit zitieren
- Marcus Wenzel (Autor:in), 2014, "Zeit" und "time". Eine kontrastive linguistische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450715