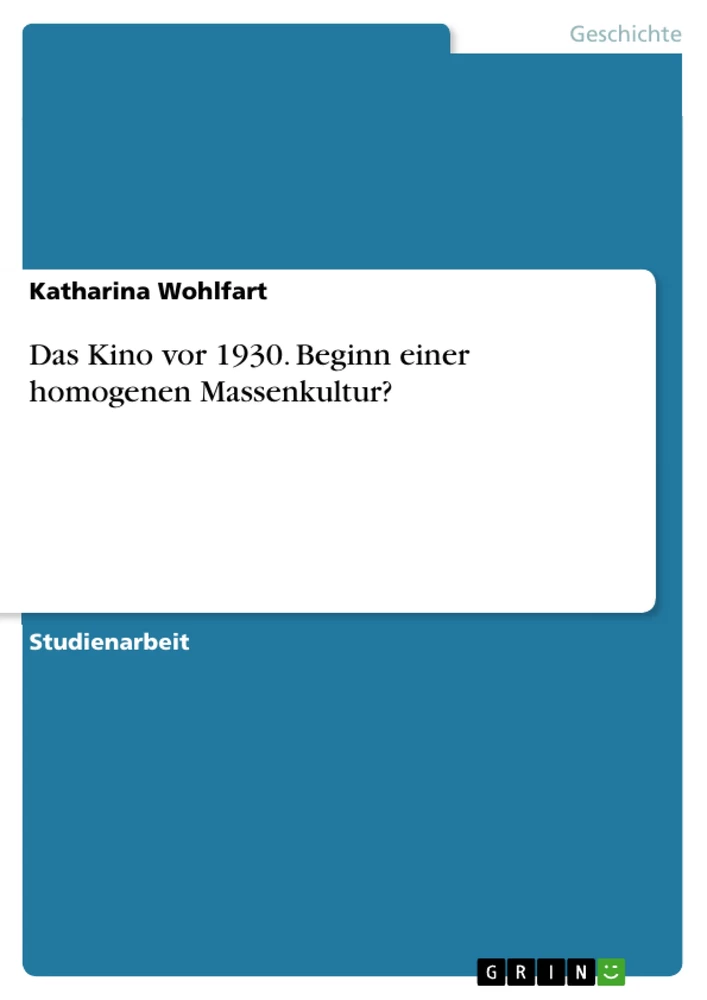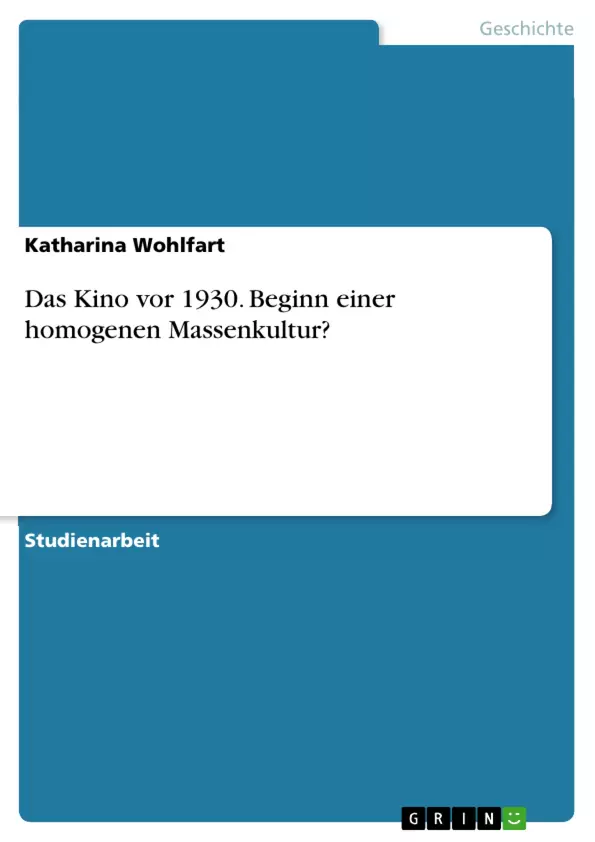Die Massenmedien haben seit der Wende zum 20. Jahrhundert entscheidend dazu beigetragen, eine kommerzielle Populärkultur entstehen zu lassen, die ausschließlich auf die Unterhaltung der Rezipienten zielte. Vor allem die Jahre vor 1930 seien für die Entwicklung prägend gewesen, da unter anderem das Kino und das Radio in diesem Zeitraum ihre Breitenwirkung stark ausbauten. Insbesondere das Kino gilt dabei als Motor einer homogenen Massenkultur: Da sich ab 1900 die verschiedenen Schichten der deutschen Gesellschaft in Vergnügungsorten wie dem Kino trafen, verwischten die trennenden Klassengrenzen. Die sozialen und regionalen Unterschiede seien durch die sich angleichenden Konsumgewohnheiten nicht mehr so wichtig gewesen. Doch ist diese These für das Kino vor 1930 tatsächlich zutreffend? Mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigt sich die vorliegende Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das frühe Kino
- 2.1 Verfügbarkeit zwischen Stadt und Land
- 2.2 Gezeigte Inhalte: Kino der Attraktionen
- 2.3 Das Publikum und seine Rezeptionsweise.
- 3 Kino in den Zwanziger Jahren
- 3.1 Verfügbarkeit zwischen Stadt und Land
- 3.2 Gezeigte Inhalte: Kino der narrativen Integration
- 3.3 Das Publikum und seine Rezeptionsweise.
- 4 Veränderungen durch den Tonfilm
- 5 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob das deutsche Kino vor 1930 tatsächlich eine homogenisierte Massenkultur schuf, die soziale und regionale Grenzen nivellierte. Sie analysiert, ob die Verbreitung des Kinos als Massenmedium zu einer einheitlichen Volksgemeinschaft führte, wie es die These von der „egalisierenden Kraft“ der Massenkultur postuliert.
- Verfügbarkeit von Kinos zwischen Stadt und Land
- Gezeigte Inhalte und Filmprogramme
- Zusammensetzung des Publikums und Rezeptionsweise
- Unterschiede zwischen dem frühen Kino und dem Kino der 1920er Jahre
- Entwicklung des Kinos als Massenmedium
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung einer homogenen Massenkultur im Kino vor 1930. Sie diskutiert den Begriff der Massenkultur und die These ihrer „egalisierenden Kraft“. Zudem skizziert sie den Forschungsstand und die Quellenlage.
Das Kapitel „Das frühe Kino“ betrachtet die Entwicklung des Kinos bis zum Ersten Weltkrieg. Es analysiert die Verfügbarkeit von Kinos in Stadt und Land, die gezeigten Inhalte und das Publikum. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Einfluss des frühen Kinos auf die Rezeptionsweise des Publikums.
Das Kapitel „Kino in den Zwanziger Jahren“ untersucht die Veränderungen im Kino während der Weimarer Republik. Es analysiert die Verfügbarkeit von Kinos, die Entwicklung des Filmprogramms und die Zusammensetzung des Publikums. Der Fokus liegt auf der Frage, ob sich in dieser Zeit bereits Anzeichen einer homogenen Massenkultur abzeichneten.
Schlüsselwörter
Das deutsche Kino vor 1930, Massenkultur, Homogenisierung, Sozialstruktur, Rezeption, Filmgeschichte, Stummfilm, Tonfilm, Verfügbarkeit, Filmprogramm, Publikum, Weimarer Republik, Klassengrenzen.
Häufig gestellte Fragen
Schuf das Kino vor 1930 eine homogene Massenkultur?
Die Arbeit untersucht kritisch die These, ob das Kino tatsächlich Klassengrenzen nivellierte oder ob soziale und regionale Unterschiede bestehen blieben.
Was ist der Unterschied zwischen dem frühen Kino und dem der 1920er Jahre?
Das frühe Kino wird als „Kino der Attraktionen“ beschrieben, während die 1920er Jahre durch das „Kino der narrativen Integration“ (Erzählkino) geprägt waren.
Wie unterschied sich die Kinoverfügbarkeit zwischen Stadt und Land?
Die Arbeit analysiert, ob der Zugang zum Massenmedium Kino in ländlichen Regionen ebenso gegeben war wie in den Städten.
Welche Rolle spielte der Tonfilm für diese Entwicklung?
Der Übergang zum Tonfilm um 1930 markierte eine Zäsur, die die Rezeptionsweise und die Verbreitung von Filmen grundlegend veränderte.
Was besagt die These von der „egalisierenden Kraft“ des Kinos?
Diese These postuliert, dass sich durch gleiche Konsumgewohnheiten im Kino die sozialen Unterschiede innerhalb der deutschen Gesellschaft verringerten.
- Arbeit zitieren
- Katharina Wohlfart (Autor:in), 2017, Das Kino vor 1930. Beginn einer homogenen Massenkultur?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450734