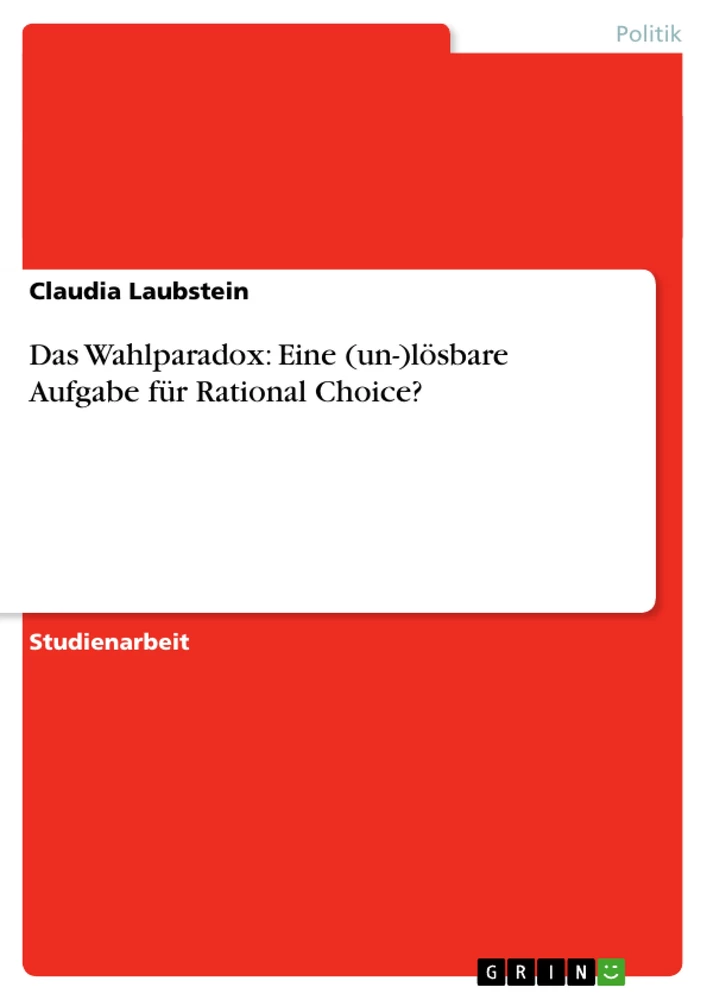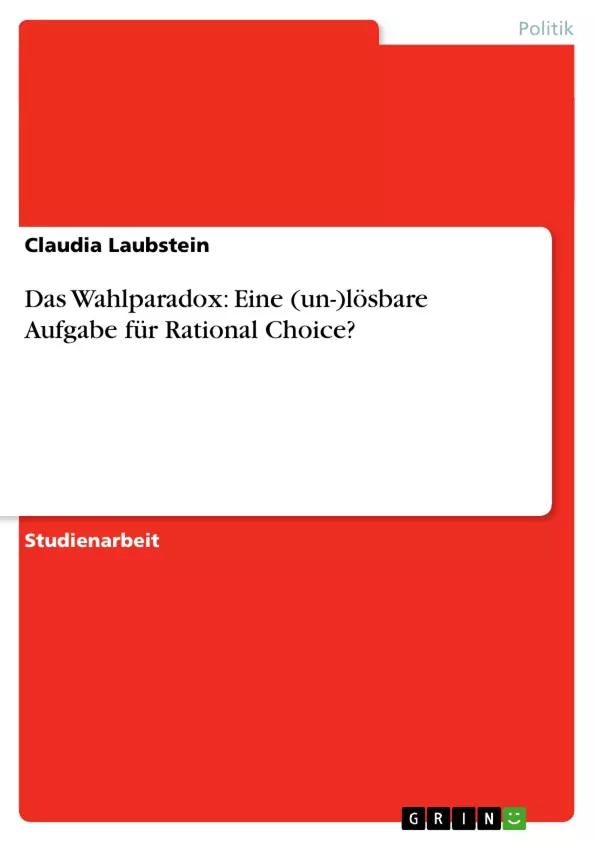Rational Choice hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem der führenden Forschungsprogramme nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern in den gesamten Sozialwissenschaften entwickelt. Die Attraktivität der Erklärungen liegt vor allem in ihrer Einfachheit und Vollständigkeit durch die Einbeziehung des Akteurs für die Erklärung von Makrophänomenen.
In seinem 1957 erschienenem Werk "An Economic Theory of Democracy", das maßgeblich zur Gründung der Public-Choice-Schule beitrug, entwirft Anthony Downs ein Modell, das sowohl das Wahlverhalten als auch das Handeln von Parteien auf der Grundlage des Homo Oeconomicus erklären will. Dabei wird die Frage aufgeworfen, warum Menschen überhaupt wählen gehen. Nach dem Prinzip der individuellen Nutzenmaximierung handelt es sich bei der Wahlbeteiligung um ein Kollektivgutproblem: zwar hat jeder ein Interesse an dem Zustandekommen des Kollektivgutes (hier: Regierungsbildung), aber die Kosten dafür will keiner tragen. Die Prognose ist also keine oder zumindest eine sehr niedrige Wahlbeteiligung. Die empirischen Beobachtung zeigen jedoch eine ganz andere Realität: "Zum Leidwesen der Theorie gehen die Leute aber doch wählen" (Uhlaner 1989, zit. nach Green / Shapiro 1999, 65), so fasst Carole Uhlaner prägnant das Downs′sche Wahlparadox zusammen. Wie ist das zu erklären?
Die Bedeutung, die dem Wahlparadox in der Folgezeit in der Rational-Choice-Literatur zukam, erklärt sich aus den Konsequenzen für das Rational-Choice-Forschungsprogramm. Wenn Rational-Choice-Erklärungen bei einem so wichtigen Phänomen wie der Wahlbeteiligung scheitern, dann können sie ihren allgemeinen Geltungsanspruch für politische Phänomene nicht halten. Handelt es sich jedoch nur um einen Konstruktionsfehler in Downs′ Modell, dann müsste das Paradox durch Ummodellierung zu lösen sein, ohne das der Kern der Rational-Choice-Theorie betroffen ist.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Umgang der Rational-Choice-Literatur mit der Herausforderung, die das Wahlparadox als Anomalie an sie gestellt hat. Die zentrale Frage ist also, ob das Paradox erfolgreich aufgelöst wurde oder ob die Rational-Choice-Theorie hier nicht anwendbar und so an die Grenze ihres Geltungsbereiches gestoßen ist. Nach einer kurzen Erläuterung des Modell des rationalen Wählers nach Downs und des Wahlparadox werden im zweiten Teil der Arbeit die wichtigsten Lösungsversuche vorgestellt und analysiert, ob und inwieweit sie in der Lage sind, das Wahlparadox aufzulösen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RATIONALES WAHLVERHALTEN
- 2.1 DER RATIONALE WÄHLER
- 2.2 DAS WAHLPARADOX
- 3. LÖSUNGSANSÄTZE
- 4. SCHLUSSFOLGERUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das sogenannte Wahlparadox im Kontext der Rational-Choice-Theorie. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob und inwieweit das Paradox durch verschiedene Lösungsansätze aufgelöst werden kann, oder ob es einen grundlegenden Mangel der Rational-Choice-Theorie aufzeigt.
- Das Wahlparadox als Anomalie in der Rational-Choice-Theorie
- Analyse des Modells des rationalen Wählers nach Downs
- Bewertung verschiedener Lösungsansätze zum Wahlparadox
- Bedeutung des Wahlparadox für den Geltungsanspruch der Rational-Choice-Theorie
- Diskussion der Grenzen der Rational-Choice-Theorie im Hinblick auf politisches Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema des Wahlparadox ein und stellt die Rational-Choice-Theorie als führendes Forschungsprogramm in den Sozialwissenschaften vor. Das zweite Kapitel erläutert das Modell des rationalen Wählers nach Downs, welches auf dem homo oeconomicus basiert und den Entscheidungsprozess des Wählers auf Basis von Kosten-Nutzen-Kalkülen darstellt. Das Wahlparadox wird anschließend als Widerspruch zwischen den theoretischen Erwartungen und der empirischen Beobachtung der Wahlbeteiligung aufgezeigt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Lösungsansätzen, die versucht haben, das Wahlparadox zu erklären und aufzulösen. Diese Ansätze werden kritisch betrachtet und ihre Stärken und Schwächen werden analysiert.
Schlüsselwörter
Wahlparadox, Rational-Choice-Theorie, Homo Oeconomicus, Wahlbeteiligung, Public-Choice-Schule, Nutzenmaximierung, Kollektivgutproblem, Downs'sche Wahlparadox, Lösungsansätze, Anomalie, Geltungsbereich, politische Rationalität, politische Phänomene.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Downs’sche Wahlparadox?
Es beschreibt den Widerspruch, dass Menschen wählen gehen, obwohl der individuelle Nutzen der Stimmabgabe angesichts der Kosten (Zeit, Aufwand) laut Rational-Choice-Theorie fast Null ist.
Was versteht man unter dem „Homo Oeconomicus“ in der Politik?
Dieses Modell geht davon aus, dass Wähler rein rational handeln und stets versuchen, ihren persönlichen Nutzen durch Kosten-Nutzen-Abwägungen zu maximieren.
Warum ist das Wahlparadox ein Problem für die Theorie?
Wenn die Rational-Choice-Theorie ein so grundlegendes Phänomen wie die Wahlbeteiligung nicht erklären kann, wird ihr allgemeiner Geltungsanspruch für politische Phänomene infrage gestellt.
Welche Lösungsansätze gibt es für das Paradox?
Lösungsversuche beinhalten die Einbeziehung von Faktoren wie Bürgerpflicht, langfristigem Erhalt der Demokratie oder sozialen Belohnungen in das Kalkül.
Wurde das Paradox erfolgreich aufgelöst?
Die Arbeit analysiert, ob die Theorie durch Ummodellierung gerettet werden kann oder ob sie hier schlicht an ihre Grenzen stößt.
- Quote paper
- Claudia Laubstein (Author), 2005, Das Wahlparadox: Eine (un-)lösbare Aufgabe für Rational Choice?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45085