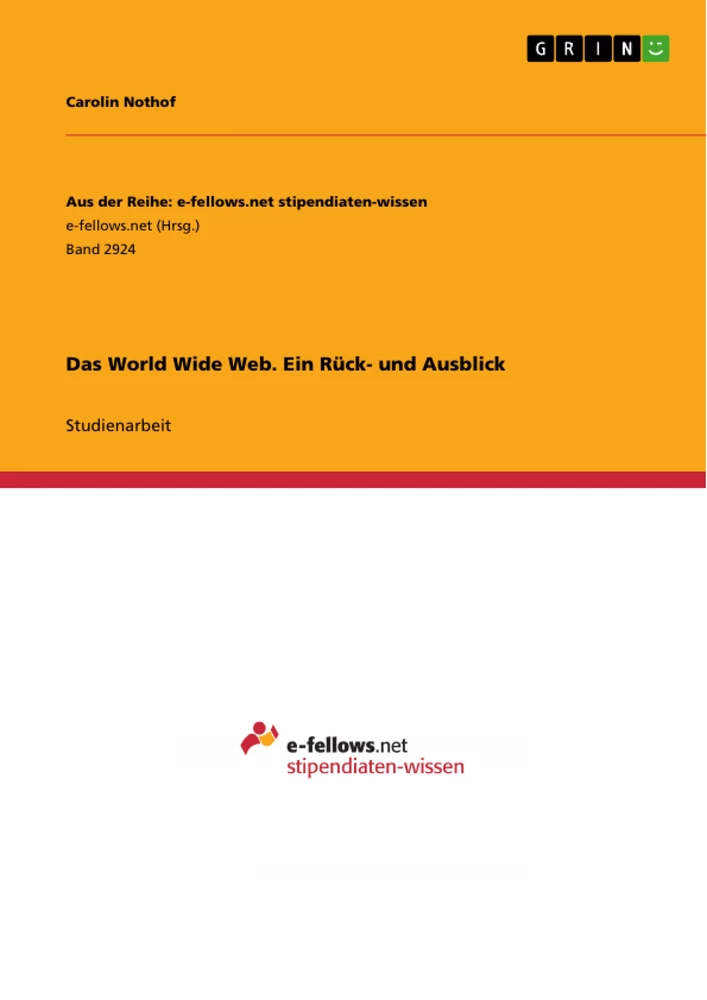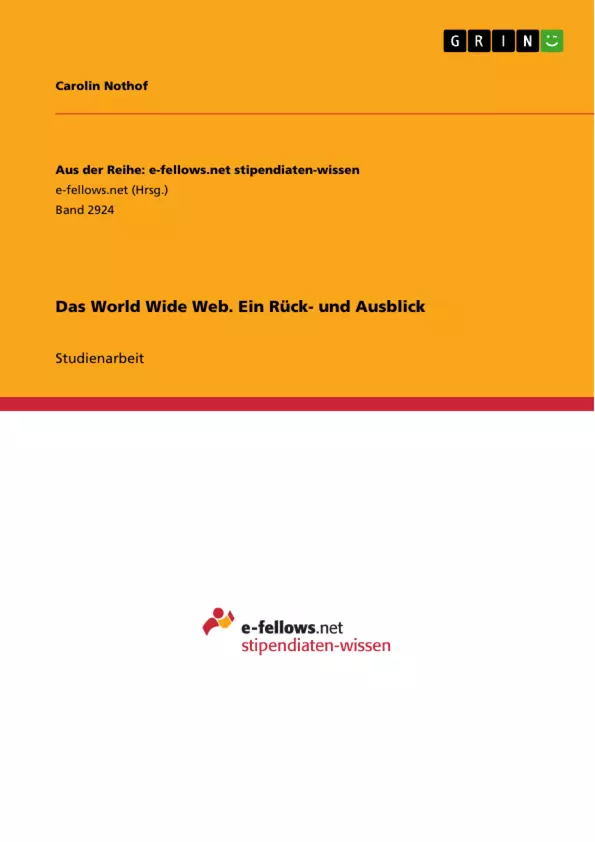Sei es als Studierender an einer Hochschule, im Beruf oder in der Freizeit: das World Wide Web unterstützt eine Vielzahl an Menschen in unterschiedlichsten Situationen und bei verschiedensten Fragestellungen. Das World Wide Web hat das Leben der Menschen verändert, es hat viele neue Gefahren mit sich gebracht und mindestens genauso viele positive Entwicklungen begünstigt.
Diese Arbeit möchte einen groben Überblick darüber verschaffen, woher das Web kommt, wie es funktioniert und wie es sich vom Internet unterscheidet. Ein weiteres Ziel ist das Verständnis verschiedener Herausforderungen und Hürden, denen sich das Web aktuell stellen muss, sowie die Untersuchung spezifischer Web-Technologien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Internet
- Entstehung des Internet
- Geschichte des World Wide Web
- World Wide Web Consortium
- Funktionsweise des Internet
- Funktionsweise des WWW
- Ein Rückblick auf das World Wide Web
- Perspektiven des World Wide Web
- Aktuelle Herausforderungen
- Netzneutralität
- Überwachung und Missbrauch
- Zugang zum Web
- Aktuelle Entwicklungen
- Web Real-Time Communication
- Linked Open Data
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Funktionsweise und aktuelle Herausforderungen des World Wide Web zu liefern. Sie beleuchtet die Geschichte des Internets und des Web, untersucht ihre Unterschiede und beleuchtet verschiedene Web-Technologien.
- Entstehung und Entwicklung des Internets und des World Wide Web
- Funktionsweise von Internet und World Wide Web
- Aktuelle Herausforderungen des World Wide Web, wie Netzneutralität, Überwachung und Missbrauch sowie der Zugang zum Web
- Moderne Web-Technologien wie Web Real-Time Communication und Linked Open Data
- Zukünftige Entwicklungen und Perspektiven des World Wide Web
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des World Wide Web in verschiedenen Lebensbereichen und hebt dessen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft hervor. Sie stellt die These auf, dass ein Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Webs unerlässlich ist, um seine zukünftige Entwicklung zu verstehen. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des Internets, die Geschichte des World Wide Web und die Funktionsweise beider Netzwerke. Es wird auf die Entstehung des World Wide Web Consortiums und die Funktionsweise von Internet und Web eingegangen. Kapitel 3 widmet sich einem Rückblick auf das World Wide Web, untersucht dessen Perspektiven und analysiert aktuelle Herausforderungen wie Netzneutralität, Überwachung und Missbrauch sowie den Zugang zum Web. Es werden auch aktuelle Entwicklungen wie Web Real-Time Communication und Linked Open Data beleuchtet.
Schlüsselwörter
World Wide Web, Internet, Entstehung, Entwicklung, Funktionsweise, Netzneutralität, Überwachung, Missbrauch, Zugang, Web-Technologien, Web Real-Time Communication, Linked Open Data, Zukunft, Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Internet und dem World Wide Web?
Das Internet ist die physische Infrastruktur (Netzwerk von Netzwerken), während das World Wide Web ein Dienst auf dieser Infrastruktur ist, der Dokumente über Hyperlinks verknüpft.
Wer hat das World Wide Web erfunden?
Die Geschichte des Webs ist eng mit Tim Berners-Lee und dem CERN verbunden, wo die ersten Protokolle wie HTTP und HTML entwickelt wurden.
Was ist das World Wide Web Consortium (W3C)?
Das W3C ist das internationale Gremium, das Standards für das Web (wie HTML5 oder CSS) festlegt, um die Interoperabilität und langfristige Entwicklung zu sichern.
Welche aktuellen Herausforderungen gibt es für das Web?
Zentrale Themen sind die Netzneutralität, die zunehmende Überwachung und der Missbrauch von Daten sowie die Gewährleistung des globalen Zugangs zum Web.
Was versteht man unter "Linked Open Data"?
Es handelt sich um ein Konzept, bei dem Daten im Web so veröffentlicht und miteinander verknüpft werden, dass sie sowohl für Menschen als auch für Maschinen leicht auffindbar und nutzbar sind.
- Quote paper
- Carolin Nothof (Author), 2018, Das World Wide Web. Ein Rück- und Ausblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450854