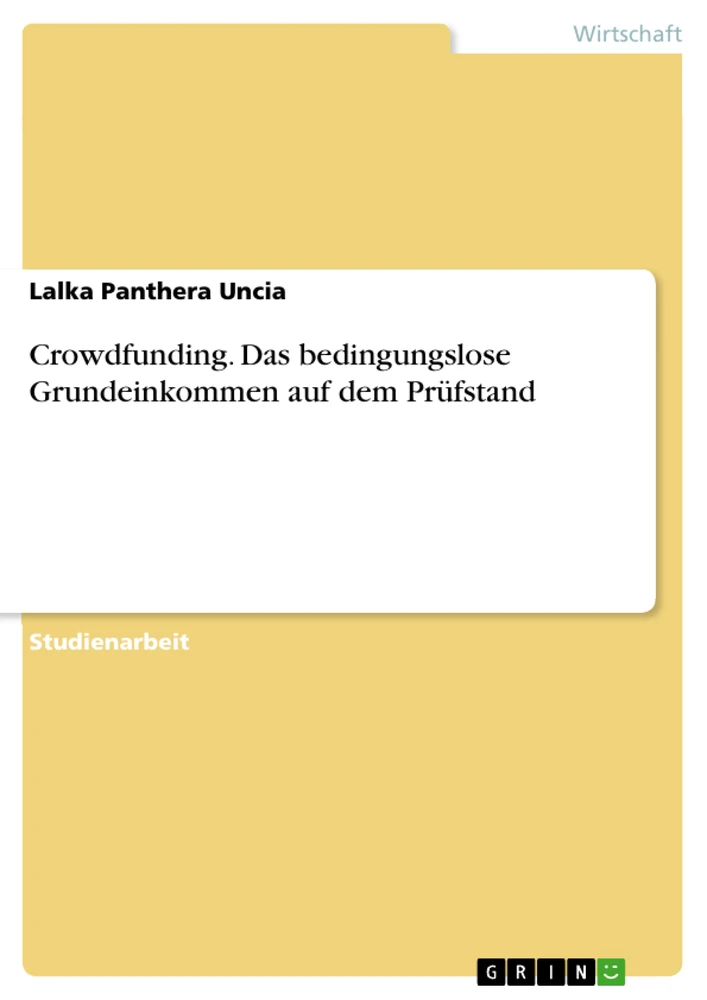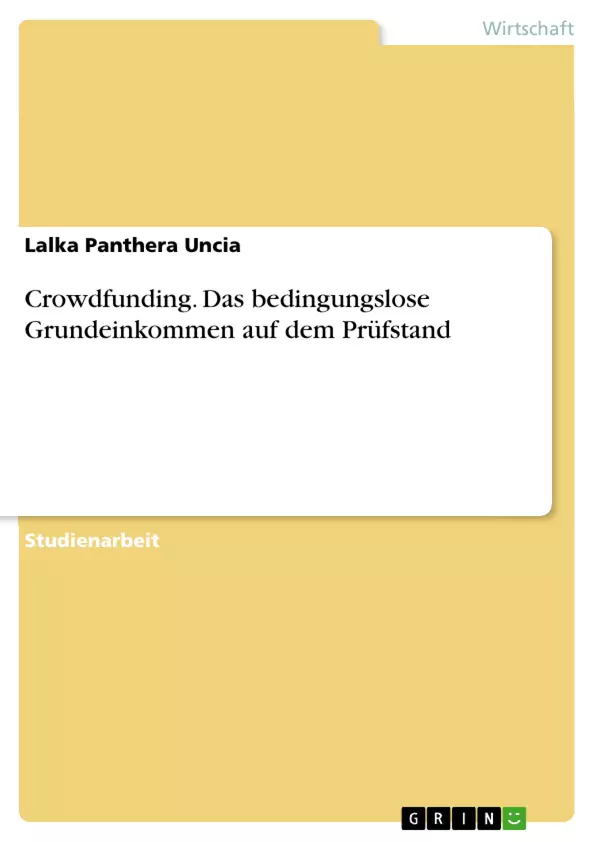Im Zuge der Digitalisierung hat der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Die technische Revolution, lässt viele Arbeitsplätze in Zukunft verschwinden, aber schafft gleichzeitig nicht genügend neue Arbeitsplätze. Im Gegenteil: Die menschliche Arbeitskraft wird vollständig und meistens sogar noch besser durch sie ersetzt.
Unsere Gesellschaft sieht sich permanent konfrontiert, mit einem Mangel an Zeit, Ressourcen und Arbeitsplätzen zu leben und zu wirtschaften. Trotz knapper Produktionsmittel werden immer mehr Konsumgüter produziert, die keine Verwendung finden. Gleichzeitig leben viele Menschen in dieser Überflussgesellschaft in Existenzangst, da die Schere zwischen Arm und Reich stetig wächst. In Deutschland waren 2016 laut Statistischem Bundesamt 16 Millionen Menschen von Armut betroffen, das entspricht 19,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Der demografische Wandel führt zu einer Unterversorgung an Arbeitskräften im Bereich der Pflege. Zudem muss bedacht werden, nicht jeder Bürger hat die finanziellen Mittel oder sieht aus persönlichen Gründen von der Inanspruchnahme einer professionellen Pflegekraft ab. Die Sozialstrukturen stehen vor einem Härtetest. Die sozial-ökologischen Implikationen dieser Entwicklung sind noch zu wenig erforscht.
Aufgrund dieser Problematik beschäftigen sich immer mehr Personen aus den unterschiedlichsten Branchen mit der Frage, wie wir auch in Zukunft in einer Wohlstandsgesellschaft leben können und der Spaltung der Gesellschaft vorbeugen. Um Bismarcks Sozialstaat fit für die digitalisierte Zukunft zu machen, wird das bedingungslose Grundeinkommen als Lösung vorgeschlagen. Es wird als grundlegende Alternative zur Politik des Druckausübens auf Erwerbslose und Sozialhilfebezieher und zur zunehmenden Prekarisierung gesehen. In der ganzen Welt schließen sich mehr und mehr Menschen in Netzwerken zusammen, um das Grundeinkommen durchzusetzen. Es gilt nun zu experimentieren, wie die Sozialsysteme möglicherweise reformiert werden können, um besser auf das offenere und wechselhaftere Arbeitsleben zugeschnitten zu sein.
Die Arbeit ist eine Fallstudie in dem Modul "Unternehmensfinanzierung". Die dort erlernten Instrumente zur Finanzierung werden an einem reellen Beispiel angewandt um einen Bezug zwischen Theorie und Praxis zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Problemstellung
- 1.2. Ziel der Fallstudie
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Das bedingungslose Grundeinkommen
- 2.1. Modelle
- 2.1.1. Emanzipatorisches Grundeinkommen
- 2.1.2. Götz W. Werner
- 2.2. Die öffentliche Diskussion
- 2.2.1. Pro
- 2.2.2. Contra
- 2.3. Pilotprojekte
- 2.3.1. Staatliche
- 2.3.2. Private
- 2.1. Modelle
- 3. Crowdfunding als Finanzierungsinstrument nicht-kommerzieller Vereine
- 4. Die Finanzierung eines NGO-Start-Ups
- 4.1. Mein Grundeinkommen
- 4.1.1. Leitbild, Unternehmensstrategie & -ziel
- 4.1.2. Kapitalstruktur & -bedarf
- 4.1.3. Einblick in die Unternehmensorganisation & das Personalwesen
- 4.2. Finanzierungsinstrumente
- 4.2.1 Donation-Crowdfunding
- 4.2.2. konsumbasierte Finanzierung
- 4.2.3. Finanzierung durch B2B-Kooperationen
- 4.3. Non-Profit Marketingmix
- 4.3.1. Nutzer werben Nutzer
- 4.3.2. Social-Media Marketing
- 4.1. Mein Grundeinkommen
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Fallstudie untersucht die Finanzierung eines Start-Ups für die bedingungslose Grundeinkommen-Initiative „Mein Grundeinkommen". Dabei wird insbesondere der Einsatz von Crowdfunding-Methoden im Kontext einer gemeinnützigen Organisation beleuchtet.
- Das bedingungslose Grundeinkommen und seine verschiedenen Modelle
- Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für Non-Profit-Organisationen
- Die Finanzierung eines NGO-Start-Ups
- Marketingstrategien im Non-Profit-Bereich
- Die Herausforderungen und Chancen der Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens ein und erläutert die Zielsetzung und Vorgehensweise der Fallstudie.
Kapitel 2 beleuchtet das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) aus unterschiedlichen Perspektiven. Es werden verschiedene Modelle des BGE vorgestellt, die öffentliche Diskussion zum Thema beleuchtet und Beispiele für Pilotprojekte aufgezeigt.
Kapitel 3 widmet sich dem Crowdfunding als Finanzierungsinstrument für nicht-kommerzielle Vereine und NGOs. Es werden die unterschiedlichen Crowdfunding-Modelle und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Kontext von Non-Profit-Organisationen diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Finanzierung des NGO-Start-Ups „Mein Grundeinkommen". Es werden das Leitbild und die Unternehmensstrategie, die Kapitalstruktur und der Kapitalbedarf sowie die Unternehmensorganisation und das Personalwesen des Start-Ups beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Crowdfunding, Non-Profit-Organisationen, Finanzierung, Start-Ups, NGO-Marketing, Mein Grundeinkommen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Initiative „Mein Grundeinkommen“?
Die Initiative nutzt Crowdfunding, um bedingungslose Grundeinkommen zu verlosen und so das Konzept in der Praxis zu testen und öffentlich zur Diskussion zu stellen.
Welche Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens gibt es?
Die Arbeit stellt unter anderem das emanzipatorische Grundeinkommen und das Modell von Götz W. Werner vor.
Wie funktioniert Crowdfunding für Non-Profit-Organisationen?
Es wird insbesondere das „Donation-Crowdfunding“ genutzt, bei dem viele Menschen kleine Beträge spenden, um ein gemeinschaftliches Ziel ohne direkte materielle Gegenleistung zu finanzieren.
Warum wird das Grundeinkommen im Kontext der Digitalisierung diskutiert?
Da durch die technische Revolution viele traditionelle Arbeitsplätze wegfallen, wird das Grundeinkommen als soziale Absicherung in einer sich wandelnden Arbeitswelt gesehen.
Welche Marketingstrategien nutzen NGOs wie „Mein Grundeinkommen“?
Wichtige Instrumente sind Social-Media-Marketing und „Nutzer-werben-Nutzer“-Strategien, um eine breite Basis an Unterstützern aufzubauen.
Welche Kritikpunkte gibt es am bedingungslosen Grundeinkommen?
Die Arbeit beleuchtet die öffentliche Diskussion, einschließlich Gegenargumenten wie Finanzierbarkeit und der Sorge vor abnehmender Erwerbsmotivation.
- Quote paper
- Lalka Panthera Uncia (Author), 2018, Crowdfunding. Das bedingungslose Grundeinkommen auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450873