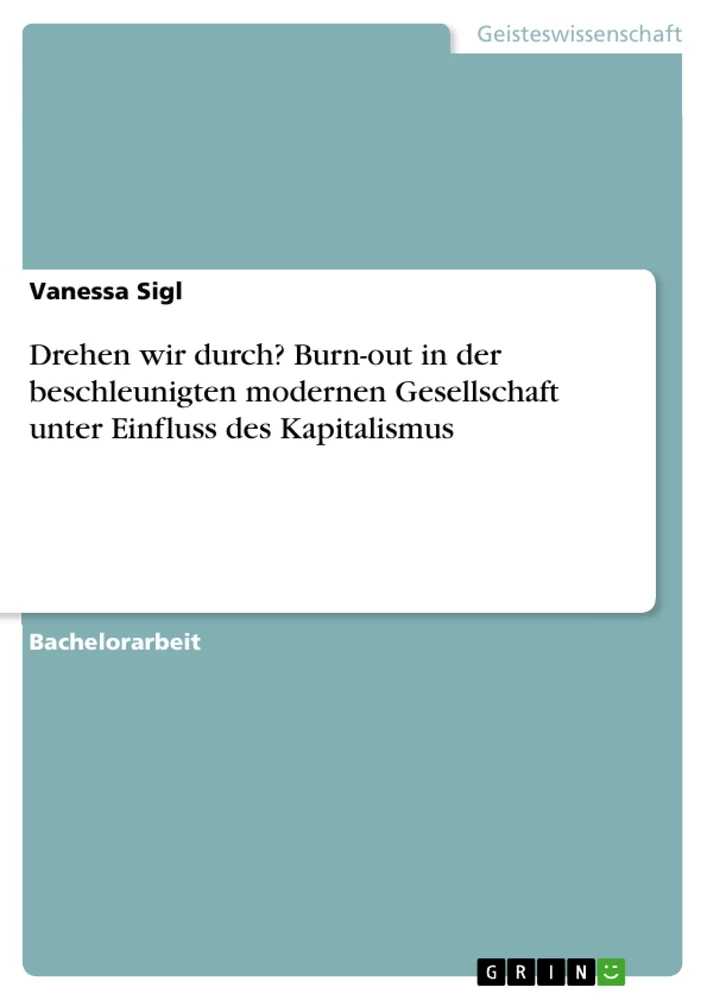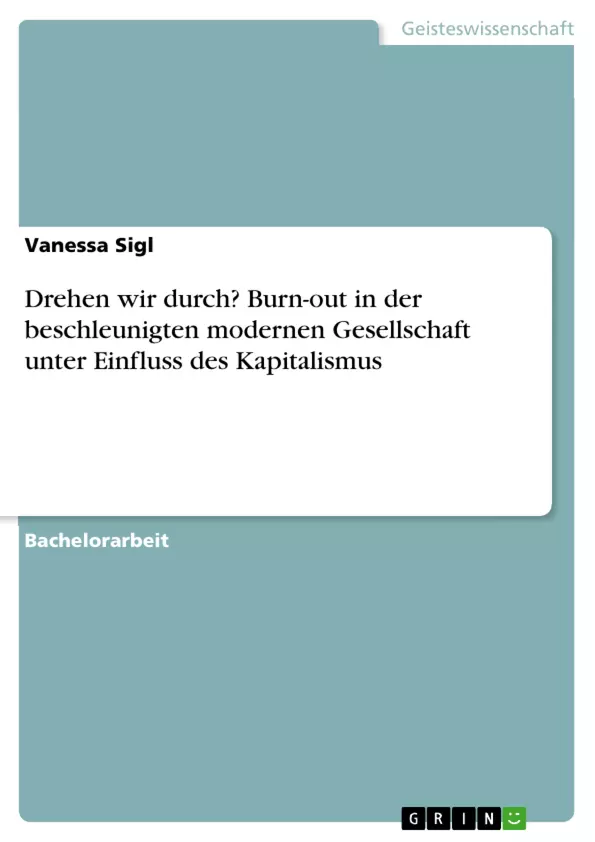Die zentrale These der Arbeit, die eingehend untersucht werden soll, ist, dass wir aktuell in einer immer schneller werdenden Gesellschaft leben, die mit diesem stetig erhöhenden Tempo neue Aufgaben an ihre Mitglieder stellt. Diese zunehmenden Herausforderungen, die vielen Menschen gerade in der Arbeitswelt begegnen, gehen einher mit einem Anstieg von psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Erscheinungen wie dem Burn-out Syndrom.
Einer der Gründe für diese Beschleunigung ist im kapitalistischen System im Kontext des Neoliberalismus zu suchen, welches tief in der modernen Gesellschaft verankert ist. Es fordert eine zunehmende Ökonomisierung unseres Lebens und unseres Alltags, sowie eine zunehmende Flexibilisierung, welche zu Diskontinuitäten im Lebenslauf vieler führt. Ziel dieser Arbeit soll es sein diese Zusammenhänge anhand einer umfangreichen Literaturrecherche dem aktuellen Stand der Forschung entsprechend darzustellen und kritisch zu beleuchten. Dazu werden zunächst allgemeine soziologische und ökonomische Theorien herangezogen und beschrieben, welche in einem weiteren Schritt mit konkreten Daten und Fakten in Bezug gesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschleunigung in der modernen Gesellschaft
- Die moderne Gesellschaft
- Beschleunigung nach Hartmut Rosa
- Burn-out und der Zusammenhang mit dem Kapitalismus
- Was ist Burn-out?
- Moderne Arbeitswelt - geprägt durch Flexibilisierung und Teamwork
- Fordismus als geschichtliche Voraussetzung
- Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeitswelt - Team- und Projektarbeit
- Identitäts- und Sinnkrise als Folge
- Empirische Daten zum Ausmaß psychischer Erkrankung auf dem deutschen Arbeitsmarkt (1997-2017)
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen der Beschleunigung in der modernen Gesellschaft, dem kapitalistischen System und dem Phänomen des Burn-out Syndroms. Sie analysiert die Auswirkungen der zunehmenden Ökonomisierung und Flexibilisierung auf das psychische Befinden von Menschen.
- Beschleunigung in der modernen Gesellschaft
- Burn-out und seine Ursachen
- Die Rolle des Kapitalismus und des Neoliberalismus
- Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeitswelt
- Empirische Daten zum Ausmaß psychischer Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die persönliche Motivation der Autorin. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Beschleunigung in der modernen Gesellschaft, wobei die moderne Gesellschaft und die Theorie der Beschleunigung nach Hartmut Rosa näher beleuchtet werden. Kapitel 3 behandelt das Burn-out Syndrom, seine Definition und seine Verbindung zum Kapitalismus. Hierbei werden die Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeitswelt sowie deren Auswirkungen auf die Identität und den Sinn im Leben beleuchtet. In Kapitel 4 werden empirische Daten zum Ausmaß psychischer Erkrankungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt (1997-2017) präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Beschleunigung, Burn-out, Kapitalismus, Neoliberalismus, Flexibilisierung, Entgrenzung, Arbeitswelt, psychische Erkrankungen und empirische Daten.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Burn-out und Kapitalismus zusammen?
Das kapitalistische System fordert stetige Beschleunigung und Ökonomisierung des Alltags, was laut der Arbeit zu einer Überforderung der Individuen führt.
Was besagt Hartmut Rosas Theorie der Beschleunigung?
Rosa beschreibt eine zunehmende Geschwindigkeit in sozialen Prozessen, die zu einer Entfremdung und einem Zeitdruck führt, dem viele nicht mehr standhalten.
Was bedeutet "Entgrenzung der Arbeit"?
Es beschreibt das Verschwimmen der Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, oft verstärkt durch Flexibilisierung und ständige Erreichbarkeit.
Warum führt Teamwork manchmal zu psychischen Krisen?
Moderne Arbeitsformen wie Team- und Projektarbeit können Identitäts- und Sinnkrisen auslösen, wenn sie mit hohem Leistungsdruck und Diskontinuität einhergehen.
Gibt es Belege für den Anstieg psychischer Erkrankungen?
Die Arbeit präsentiert empirische Daten vom deutschen Arbeitsmarkt (1997-2017), die einen deutlichen Anstieg von Depressionen und Burn-out zeigen.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Sigl (Autor:in), 2018, Drehen wir durch? Burn-out in der beschleunigten modernen Gesellschaft unter Einfluss des Kapitalismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450916