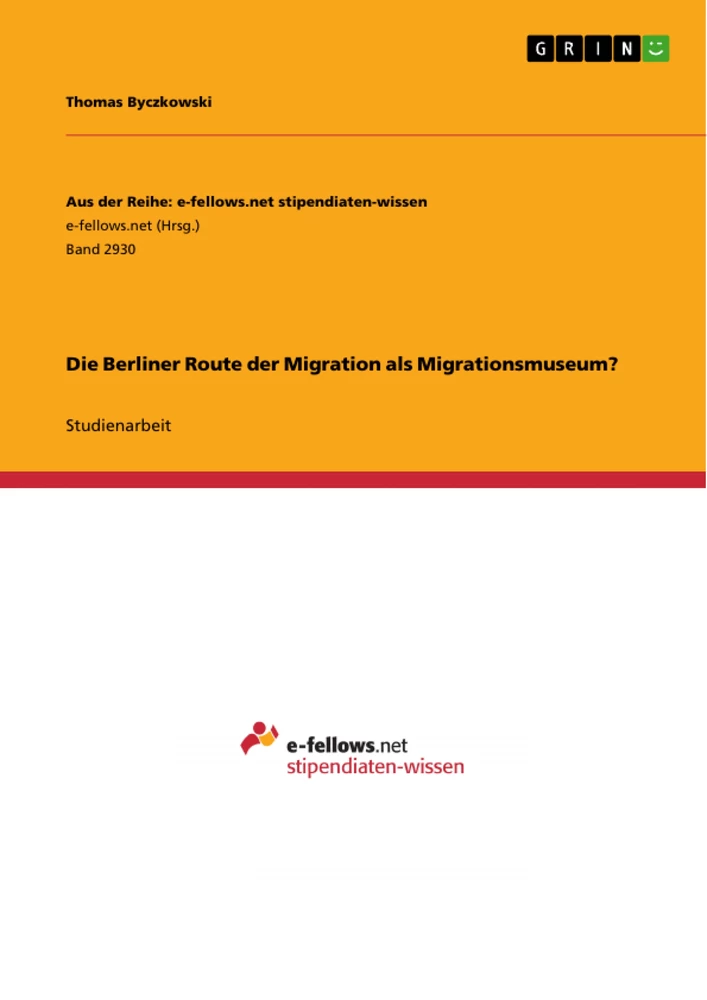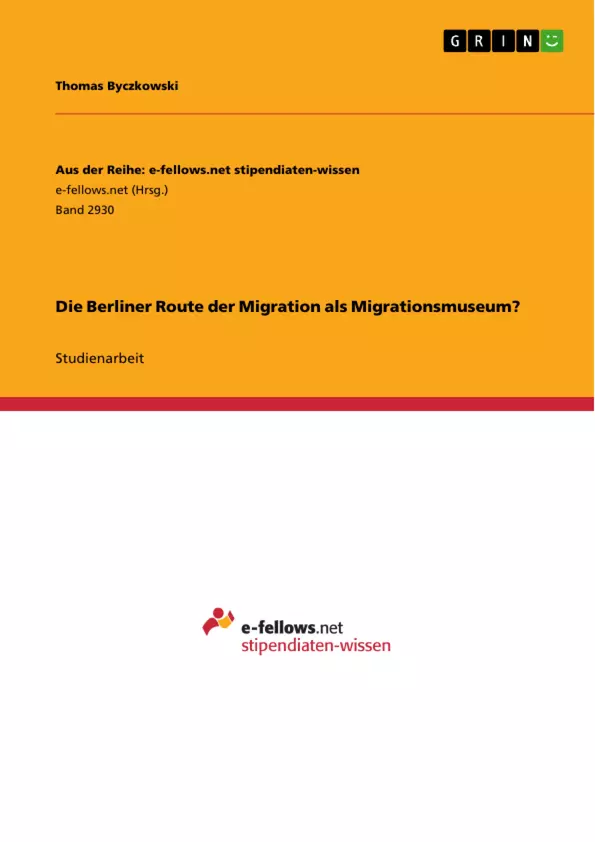Im Oktober des Jahres 2011 konnte man im Berliner Stadtraum auf vier rote Frachtcontainer stoßen, die mit unterschiedlichen Ausstellungen an Berliner Einwanderungsgeschichten erinnern sollten. Diese sogenannten Gedächtnisboxen waren ein erstes Ergebnis des Projekts der Berliner Route der Migration und stellten außerdem einen Teil der Aktivitäten zum 50. Jahrestag des Anwerberabkommens mit der Türkei am 31.10.1961 dar. Mit der Route der Migration wird nun auch der Berliner Migrationsgeschichte mehr Aufmerksamkeit zuteil. Zwar geschieht dies in Form einer im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbaren Form im Stadtraum, doch erinnern einzelne Aspekte des Konzepts und der Idee an schon existierende Migrationsmuseen.
Joachim Baur hat in seiner Monografie aufgezeigt, dass im Zuge eines allgemeinen „globalen Museumsbooms“ auch ein zunehmendes Interesse an der Musealisierung der Migration zu beobachten war. Als spezifische Gründe für dieses wachsende Interesse nennt er „die thematische Schwerpunktverlagerung mit der Hinwendung zur Sozialgeschichte“2 und die Veränderungen der Museumslandschaft durch die „New Museology“, also das Hinterfragen der gesellschaftlichen Bedeutungen von Museen und den von Museen konstruierten Bedeutungen.3 Er analysiert drei verschiedene Migrationsmuseen und stellt in einem Ausblick eigene Kriterien vor, was ein Migrationsmuseum leisten könnte und sollte. Im Rahmen dieser Arbeit soll anhand dieser Kriterien der Frage nachgegangen werden, inwiefern auch die Berliner Route der Migration als Migrationsmuseum bezeichnet werden kann.
In einem ersten Schritt der Arbeit werden im Folgenden die ersten Ergebnisse des Projekts der Berliner Route der Migration vorgestellt und analysiert. In einem zweiten Schritt werden zunächst die Kriterien Baurs erläutert und anschließend mit den Ergebnissen des Projekts verglichen. Abschließend sollen die herausgearbeiteten Aspekte zusammen betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Konzept und Realisierung der Berliner Route der Migration.
- 2.1. Entstehung und Konzept
- 2.2. Erste Realisierung: Die Gedächtnisboxen
- 3. Versuch einer Einordnung
- 4. Abschließende Betrachtung.
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Berliner Route der Migration, ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte der Einwanderung in Berlin erfahrbar zu machen. Sie untersucht, inwieweit dieses Projekt als Migrationsmuseum im Sinne der Kriterien von Joachim Baur betrachtet werden kann.
- Konzept und Realisierung der Berliner Route der Migration
- Kriterien für ein Migrationsmuseum nach Joachim Baur
- Einordnung der Berliner Route der Migration im Kontext bestehender Migrationsmuseen
- Potenziale und Herausforderungen des Projekts im Hinblick auf die Musealisierung der Migration
- Die Rolle der Berliner Route der Migration in der Erinnerungskultur der Stadt
Zusammenfassung der Kapitel
- 1. Einleitung: Die Arbeit stellt die Berliner Route der Migration und ihre Bedeutung für die Berliner Stadtgeschichte vor. Sie führt in das Thema der Musealisierung der Migration ein und verweist auf die Kriterien von Joachim Baur.
- 2. Konzept und Realisierung der Berliner Route der Migration: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und das Konzept der Berliner Route der Migration. Es stellt die Gedächtnisboxen als erste Realisierung des Projekts vor und erläutert die Bedeutung der Route für die Erinnerung an die Einwanderungsgeschichte Berlins.
- 3. Versuch einer Einordnung: Dieses Kapitel analysiert die Berliner Route der Migration anhand der Kriterien von Joachim Baur und betrachtet sie im Kontext anderer Migrationsmuseen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen der Migration, Stadtgeschichte, Erinnerungskultur, Musealisierung, Migrationsmuseen, Berliner Route der Migration, Gedächtnisboxen, Joachim Baur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Berliner Route der Migration“?
Es ist ein Projekt im Berliner Stadtraum, das durch Stationen wie rote Frachtcontainer (Gedächtnisboxen) an die Einwanderungsgeschichte der Stadt erinnert.
Kann man die Route als Migrationsmuseum bezeichnen?
Die Arbeit untersucht dies anhand der Kriterien von Joachim Baur, da die Route zwar kein Gebäude ist, aber museale Funktionen der Erinnerung und Vermittlung übernimmt.
Was sind die „Gedächtnisboxen“?
Vier rote Frachtcontainer, die 2011 Ausstellungen zu Berliner Einwanderungsgeschichten zeigten, unter anderem zum 50. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei.
Welche Kriterien definiert Joachim Baur für Migrationsmuseen?
Baur fokussiert auf die Hinwendung zur Sozialgeschichte, die „New Museology“ und die Frage, wie Museen gesellschaftliche Bedeutung von Migration konstruieren.
Warum findet Migration zunehmend Einzug in Museen?
Dies liegt an einem globalen Trend zur Musealisierung der Sozialgeschichte und dem Bedürfnis, die Vielfalt moderner Stadtgesellschaften abzubilden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Byczkowski (Autor:in), 2011, Die Berliner Route der Migration als Migrationsmuseum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450924