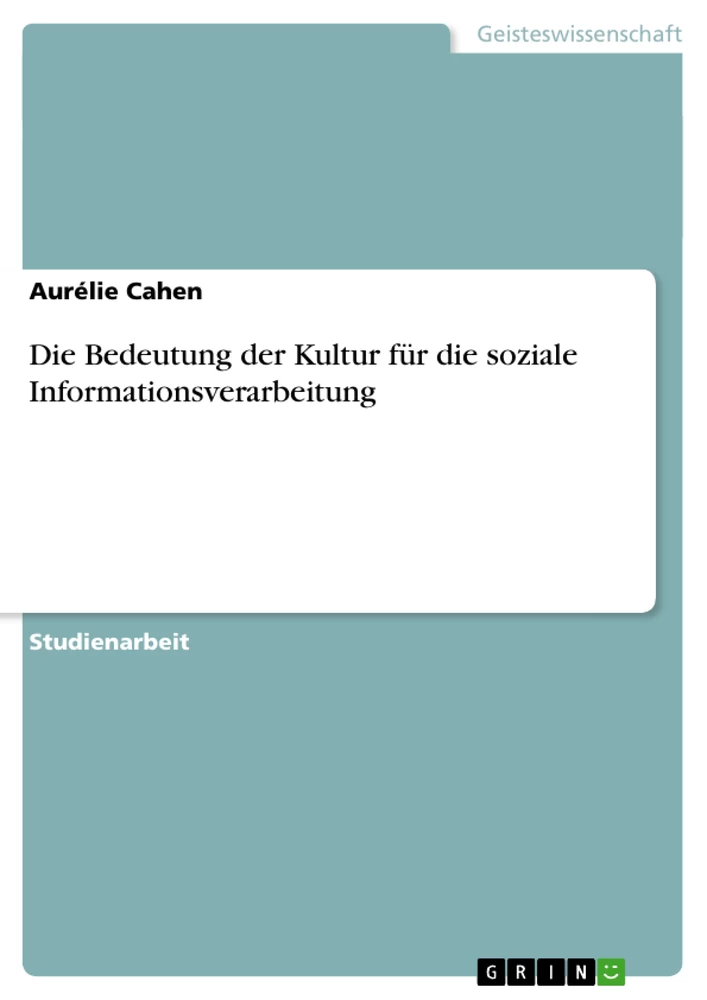Allgemein wird die Psychologie als die Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens befaßt. Mit Hilfe von verschiedenen wissenschaftlichen Methoden werden Verhalten und Erleben einzelner Personen oder einer für statistische Analysen ausreichend großen Zahl von Personen bzw. von Gruppen untersucht. Entdeckte Zusammenhänge zwischen den definierten äußeren Reizkonstellationen einerseits und innerem Erleben bzw. Verhalten bilden die Erkenntnisgrundlage zur Formulierung psychologischer Theorien. Doch obwohl die überwiegende Mehrheit der psychologischen Studien in Nord-Amerika, die meisten anderen in West-Europa, durchgeführt werden, werden die an überwiegend westlich-kulturell geprägten Versuchspersonen gewonnenen Ergebnisse verallgemeinert und daraus Gesetzte abgeleitet, die meist so behandelt werden, als seien sie für allen Menschen gültig. Die Psychologie läuft dabei Gefahr, die Auswirkungen kultureller Variablen zu vernachlässigen. Hier setzt nun die kulturvergleichende Psychologie an, die versucht zu prüfen, ob die gefundenen Gesetzmäßigkeiten psychischer Prozesse des Menschen universelle (Generalisierungsstudien) oder nur kulturspezifische Gültigkeit (Differenzierungsstudien) besitzen. So gesehen definiert sich die kulturvergleichende Psychologie weniger durch einen Gegenstandsbereich als durch eine methodische Strategie (Thomas, 1993). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluß des Selbstkonzeptes auf die soziale Informationsverarbeitung und versucht zu überprüfen, ob einige recht konsistente Ergebnisse universelle oder nur kulturspezifischen Gültigkeit besitzen. Zunächst wird im zweiten Kapitel versucht, den Begriffe „Selbstkonzept“ und „Kultur“ zu definieren und zu klären, wie unterschiedliche Kultur zur Bildung unterschiedlicher Selbstkonzepte führen kann. Der dritte Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit einigen bekannten und in zahlreichen Experimenten recht konsistent beobachteten Verzerrungen bei der Informations-verarbeitung. Anhand mehrerer kulturübergreifender Experimente soll überprüft werden, ob diese Ergebnisse unabhängig von kulturellen Variablen sind und ob die daraus entwickelten Theorien universelle oder nur kulturspezifischen Gültigkeit besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das „Selbst“ und die „Kultur“
- III. Ergebnisse der kulturvergleichenden Psychologie
- 1. Der fundamentale Attributionsfehler
- 2. Kognitive Konsistenz und kognitive Dissonanz
- 3. Selbstwertdienliche Verzerrungen
- IV. Das interdependente-Self und das independente-Self
- V. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Selbstkonzepts auf die soziale Informationsverarbeitung und prüft die universelle oder kulturspezifische Gültigkeit bestimmter Ergebnisse der psychologischen Forschung. Es wird analysiert, wie kulturelle Unterschiede zur Bildung unterschiedlicher Selbstkonzepte beitragen und wie diese wiederum die Informationsverarbeitung beeinflussen.
- Der Einfluss von Kultur auf das Selbstkonzept
- Der fundamentale Attributionsfehler im kulturellen Kontext
- Kognitive Konsistenz, Dissonanz und Selbstwertschutz im kulturellen Vergleich
- Das interdependente und independente Selbst
- Universell vs. kulturspezifisch gültige psychologische Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kulturvergleichenden Psychologie ein und betont die Notwendigkeit, kulturelle Variablen in der psychologischen Forschung zu berücksichtigen. Die Arbeit fokussiert auf den Einfluss des Selbstkonzepts auf die soziale Informationsverarbeitung und untersucht die universelle bzw. kulturspezifische Gültigkeit bestimmter, in der westlichen Psychologie etablierter Ergebnisse. Die einzelnen Kapitel und deren Forschungsfragen werden vorgestellt.
II. Das „Selbst“ und die „Kultur“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition der Konstrukte „Selbst“ und „Kultur“. Es wird erläutert, dass trotz der universellen Entwicklung eines Selbstkonzepts, der konkrete Inhalt und die Struktur des Selbstkonzepts durch kulturelle Einflüsse geprägt sind. Der kognitionspsychologische Ansatz zur Betrachtung des Selbstkonzepts als dynamische, sich ständig verändernde kognitive Struktur wird vorgestellt. Die Priorität selbstkonzeptrelevanter Informationen bei Wahrnehmung und Verarbeitung wird anhand des „Cocktail Party Phänomens“ und des „self-reference memory enhancement effect“ illustriert. Die verschiedenen Modelle zur Strukturierung des Selbstkonzepts (hierarchisch, assoziatives Netzwerk) werden kurz angerissen.
Schlüsselwörter
Kulturvergleichende Psychologie, Selbstkonzept, soziale Informationsverarbeitung, fundamentaler Attributionsfehler, kognitive Konsistenz, kognitive Dissonanz, Selbstwertdienliche Verzerrungen, interdependentes Selbst, independentes Selbst, kulturelle Variablen.
Häufig gestellte Fragen zu: Kulturvergleichende Psychologie und Selbstkonzept
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der kulturvergleichenden Psychologie und untersucht den Einfluss des Selbstkonzepts auf die soziale Informationsverarbeitung. Sie analysiert die universelle oder kulturspezifische Gültigkeit bestimmter Ergebnisse der psychologischen Forschung, insbesondere im Hinblick auf kulturelle Unterschiede bei der Bildung von Selbstkonzepten und deren Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Einfluss von Kultur auf das Selbstkonzept; der fundamentale Attributionsfehler im kulturellen Kontext; kognitive Konsistenz, Dissonanz und Selbstwertschutz im kulturellen Vergleich; das interdependente und independente Selbst; universell vs. kulturspezifisch gültige psychologische Theorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das „Selbst“ und die „Kultur“, Ergebnisse der kulturvergleichenden Psychologie (mit den Unterpunkten: Der fundamentale Attributionsfehler, Kognitive Konsistenz und kognitive Dissonanz, Selbstwertdienliche Verzerrungen), Das interdependente-Self und das independente-Self, und Schlusswort.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema der kulturvergleichenden Psychologie ein und betont die Notwendigkeit, kulturelle Variablen in der psychologischen Forschung zu berücksichtigen. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Einfluss des Selbstkonzepts und die Untersuchung der universellen bzw. kulturspezifischen Gültigkeit bestimmter Ergebnisse der westlichen Psychologie. Die einzelnen Kapitel und deren Forschungsfragen werden vorgestellt.
Was wird im Kapitel „Das „Selbst“ und die „Kultur“ behandelt?
Dieses Kapitel definiert die Konstrukte „Selbst“ und „Kultur“ und erläutert, wie kulturelle Einflüsse den Inhalt und die Struktur des Selbstkonzepts prägen, obwohl die Entwicklung eines Selbstkonzepts universell ist. Es wird ein kognitionspsychologischer Ansatz vorgestellt, und die Priorität selbstkonzeptrelevanter Informationen bei der Wahrnehmung und Verarbeitung wird anhand von Beispielen (Cocktail Party Phänomen, self-reference memory enhancement effect) illustriert. Verschiedene Modelle zur Strukturierung des Selbstkonzepts werden kurz angerissen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Kulturvergleichende Psychologie, Selbstkonzept, soziale Informationsverarbeitung, fundamentaler Attributionsfehler, kognitive Konsistenz, kognitive Dissonanz, Selbstwertdienliche Verzerrungen, interdependentes Selbst, independentes Selbst, kulturelle Variablen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Selbstkonzepts auf die soziale Informationsverarbeitung und prüft die universelle oder kulturspezifische Gültigkeit bestimmter Ergebnisse der psychologischen Forschung. Es wird analysiert, wie kulturelle Unterschiede zur Bildung unterschiedlicher Selbstkonzepte beitragen und wie diese wiederum die Informationsverarbeitung beeinflussen.
- Citation du texte
- Aurélie Cahen (Auteur), 2002, Die Bedeutung der Kultur für die soziale Informationsverarbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4511