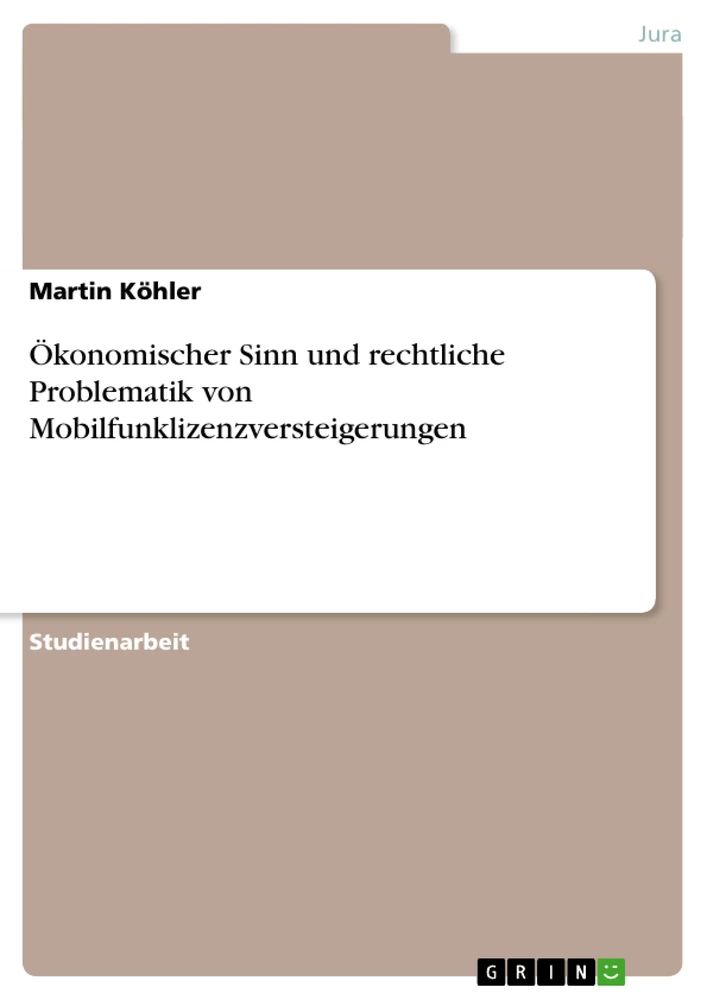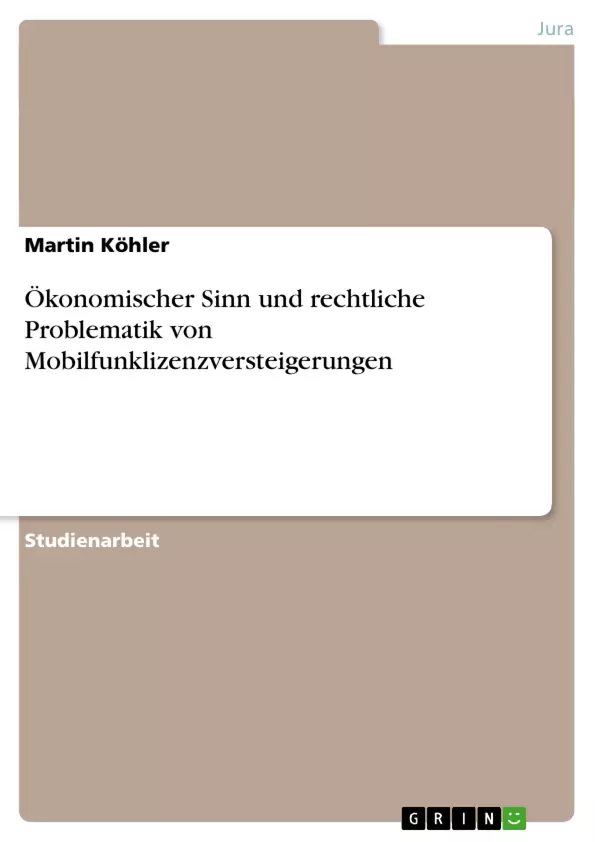Im Sommer des Jahres 2000 versteigerte die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) erstmalig bedeutende Lizenzen für die Erbringung eines neuen Standards mobiler Telekommunikation, die Universal Mobile Telecomunication Services (UMTS) oder dritte Generation des Mobilfunks. Dies betraf zum einen die Zuteilung von Funkfrequenzen gem. § 47 V 2 Telekommunikationsgesetz (TKG), zum anderen aber auch bereits die Vergabe von Lizenzen (§ 11 IV TKG), nach § 3 Nr. 7 TKG mit der „Erlaubnis zum Angebot bestimmter Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit“. Angesichts des unerwartet hohen Versteigerungserlöses von nahezu EUR 50 Mrd. kamen Zweifel auf, ob das gewählte Vergabeverfahren mit der Verfassung und den Gesetzen im Einklang stehe. So entsprach die Summe fast einem Viertel des Bundeshaushalts für das betroffene Haushaltsjahr. Dabei schaffte der Staat durch die Zuteilung einer Lizenz keinen eigenen Wert, unternahm keine eigene Anstrengung und besaß keinen entsprechenden eigenen Aufwand. Einer Versteigerung wurde vorgehalten, sie wandle knappe Güter zu Handelsgütern, obwohl ihre Verteilung durch eine n staatlichen Hoheitsakt zu erfolgen habe. Die sachlichen Interessen der Telekommunikationsbürger, wie die Sicherung des Daten- und Fernmeldegeheimnisses, eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung, die flächendeckende Grundversorgung und ein chancengleicher, funktionsfähiger Wettbewerb blieben dabei unberücksichtig. Daneben stellten Kritiker auch die Rechtmäßigkeit der konkreten Gestaltung und Durchführung der UMTS-Auktion in Frage. Die Mobilfunkanbieterin MobilCom Multimedia GmbH, die eine Lizenz für DM 16,4 Mrd. erworben hatte, erhob Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, mit der sie die Aufhebung der an sie gerichteten Zuschlags- und Zahlungsbescheide, nicht aber der gesondert erteilten Lizenz begehrte. Allein der Wunsch nach Planungs- und Investitionssicherheit, die Gefahr eines Lizenzverlusts und nicht zuletzt das erheblich Prozesskostenrisiko führten zur Rücknahme der Klage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- I. Ökonomische Betrachtung
- 1. Gegenstand von Versteigungen: Funkfrequenzen als knappes Gemeinschaftsgut
- 2. Versteigerung im Kontext klassischer Vergabeverfahren
- a) Materielle Auswahlverfahren
- b) Formale Auswahlverfahren
- 3. Ökonomische Kritik an klassischen Vergabeverfahren
- 4. Ökonomische Betrachtung von Versteigerungen
- II. Grundrechtliche Betrachtung
- 1. Vereinbarkeit der Lizenzierung von UMTS-Lizenzen mit Art. 12 I i.V.m. 19 III GG
- 2. Vereinbarkeit der UMTS-Versteigerung mit Art. 12 I i.V.m. Art. 3 I, 19 III GG als Teilhaberecht
- a) Prüfungsmaßstab – Berufsausübung oder Berufswahlregelung
- aa) Geeignetheit
- bb) Erforderlichkeit
- cc) Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
- b) Effizienz als sachgerechtes Auswahlkriterium
- aa) Gewährleistungsauftrag Art. 87 fI GG
- bb)Bereichsspezifisches Wettbewerbsprinzip Art. 87 f II GG
- a) Prüfungsmaßstab – Berufsausübung oder Berufswahlregelung
- 3. Mindestanforderungen an das Verfahrensrecht der UMTS-Mobilfunklizenzen
- a) Gebot der Kapazitätsausschöpfung
- b) Gewährleistung eines ökonomischen Bieterverhaltens
- aa) Kollusives Verhalten
- bb) Spekulative Motive
- cc) Gefahr von Überbewertungen
- 4. Zwischenergebnis
- III. Das UMTS-Versteigerungsverfahren im Lichte des Europäischen Gemeinschaftsrechts
- 1. Vereinbarkeit mit primären Gemeinschaftsrecht: Niederlassungsfreiheit Art. 43 EGV
- a) Nicht-diskriminierende Anwendung von § 11 IV TKG
- b) Zwingende Gründe des Allgemeinwohls
- 2. Vereinbarkeit mit sekundärem Gemeinschaftsrecht: Genehmigungsrichtlinie 97/13/EG
- a) Versteigerungserlös und Kostendeckungsprinzip
- b) Nutzungssicherungsfunktion
- c) Entwicklungssicherungs- und Wettbewerbsförderungsfunktion
- d) Diskriminierungsverbot
- 3. Zwischenergebnis
- 1. Vereinbarkeit mit primären Gemeinschaftsrecht: Niederlassungsfreiheit Art. 43 EGV
- IV. Gesamtergebnis
- I. Ökonomische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtliche Vereinbarkeit des im Telekommunikationsgesetz (TKG) vorgesehenen Versteigerungs- verfahrens mit dem Grundgesetz und dem Europäischen Gemeinschaftsrecht. Im Fokus steht dabei insbesondere die UMTS-Auktion im Jahr 2000.
- Ökonomische Betrachtung von Funkfrequenzen als knappes Gemeinschaftsgut
- Grundrechtliche Aspekte der Lizenzierung von UMTS-Frequenzen
- Vereinbarkeit der UMTS-Versteigerung mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht
- Bewertung des Versteigerungsmodells im Hinblick auf Effizienz und Fairness
- Rechtliche und wirtschaftliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der UMTS-Auktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die UMTS-Versteigerung im Jahr 2000 als Ausgangspunkt für die Untersuchung dar und beleuchtet die kritischen Diskussionen um die Rechtmäßigkeit und die Auswirkungen des Verfahrens.
- I. Ökonomische Betrachtung: Funkfrequenzen werden als knappe Gemeinschaftsgüter definiert und im Kontext von klassischen Vergabeverfahren betrachtet. Die ökonomischen Vorteile und Nachteile von Versteigerungen werden erörtert.
- II. Grundrechtliche Betrachtung: Die Vereinbarkeit der Lizenzierung und Versteigerung von UMTS-Frequenzen mit dem Grundgesetz, insbesondere mit dem Recht auf Berufsausübung und dem Gleichheitsgrundsatz, wird untersucht.
- III. Das UMTS-Versteigerungsverfahren im Lichte des Europäischen Gemeinschaftsrechts: Die Einhaltung der Niederlassungsfreiheit und der Genehmigungsrichtlinie 97/13/EG wird im Zusammenhang mit dem Versteigerungsverfahren geprüft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Telekommunikationsrecht, UMTS-Auktion, Versteigerung, Frequenzspektrum, Gemeinschaftsgut, Grundrechte, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Niederlassungsfreiheit, Genehmigungsrichtlinie, Effizienz, Fairness, Wettbewerb, Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP), Telekommunikationsgesetz (TKG).
Häufig gestellte Fragen
Warum wurden Mobilfunklizenzen versteigert?
Versteigerungen gelten ökonomisch als effizientes Mittel zur Zuteilung knapper Gemeinschaftsgüter wie Funkfrequenzen an diejenigen Bieter, die sie am besten nutzen können.
War die UMTS-Auktion im Jahr 2000 rechtmäßig?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit der Auktion mit dem Grundgesetz (Art. 12 Berufsfreiheit) und dem europäischen Gemeinschaftsrecht.
Welche Kritik gab es an dem Versteigerungsverfahren?
Kritiker bemängelten die extrem hohen Erlöse (ca. 50 Mrd. EUR), die mögliche Gefährdung der flächendeckenden Versorgung und Zweifel an der verfassungsrechtlichen Grundlage.
Wie steht die Auktion im Einklang mit EU-Recht?
Die Untersuchung prüft die Einhaltung der Niederlassungsfreiheit und der Genehmigungsrichtlinie 97/13/EG, insbesondere hinsichtlich Diskriminierungsverboten.
Welche Risiken birgt ein solches Auktionsmodell?
Es besteht die Gefahr von kollusivem Verhalten, spekulativen Motiven der Bieter und einer Überbewertung der Lizenzen (Winner's Curse).
- Arbeit zitieren
- Martin Köhler (Autor:in), 2005, Ökonomischer Sinn und rechtliche Problematik von Mobilfunklizenzversteigerungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45132