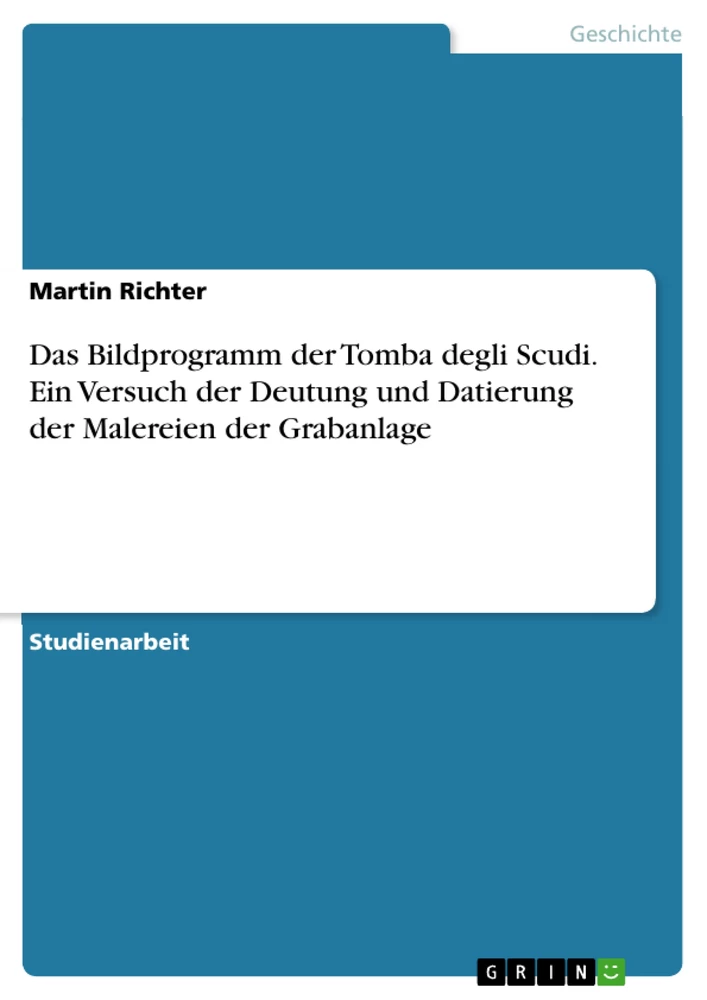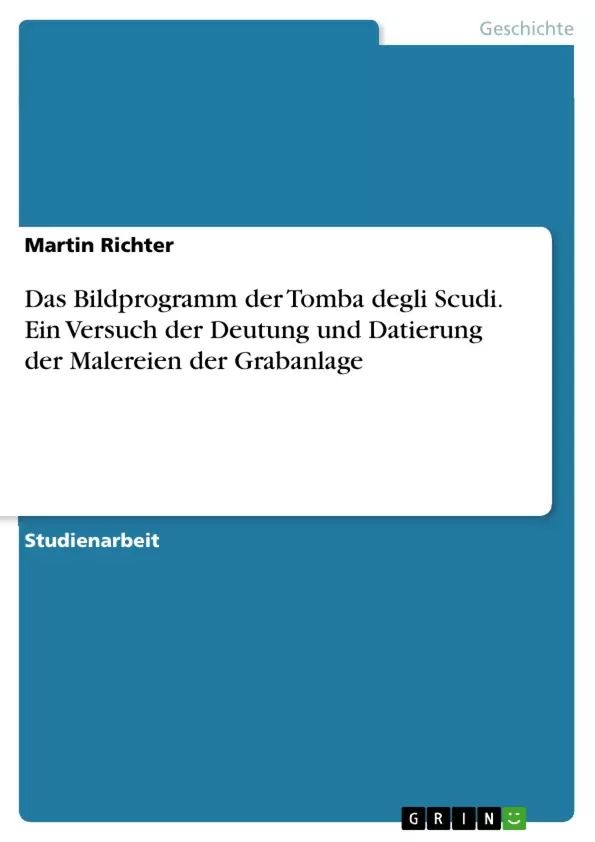Wie der Titel bereits aussagt, soll das Bildprogramm der Tomba degli Scudi vorgestellt werden. Dabei versuche ich zum einen darauf zu achten, welche Themen der Malerei uns in dieser Grabanlage begegnen und inwiefern diese Malereien zueinander in Verbindung zu setzen sind, um eventuelle Zusammenhänge herauszustellen und aufzuzeigen. Als Ziel soll bei dieser Betrachtung die Fragen in Augenschein genommen werden, wer hier bestattet lag bzw. welche Bedeutung er in seinem Umfeld hatte.
Am Ende steht jedoch die Hauptfrage danach, in welche Zeit die Grabanlage zu datieren ist. Zu diesem Zwecke sollen vor allem Vergleiche für den gestalterischen Aspekt herangezogen werden, da – um das vorweg zu nehmen – es keine publizierten Funde in dieser Anlage gab. Als Vergleiche werden dabei vor allem Grabanlagen herangezogen, die einer ähnlichen Zeitstufe zuzuordnen sind. Solche Anlagen wären z.B. in Tarquinia die Tomba dell' Orco I, sowie in Orvieto die Tomba Golini I. Als Ziel soll am Ende noch die Klärung der Frage nach der Einordnung in den spätklassisch-hellenistischen Kontext stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tarquinia
- Forschungsgeschichte
- Ziele der Arbeit
- Die spätklassische und hellenistische Zeit
- Beschreibung und Deutung der Malereien
- Die Rückwand
- Die linke Wand
- Die rechte Wand
- Die Eingangswand
- Die Nebenkammern
- Die Datierung der Tomba degli Scudi
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, das Bildprogramm der Tomba degli Scudi in Tarquinia zu analysieren und zu deuten. Dabei stehen die Themen der Malerei, die Beziehungen zwischen den einzelnen Darstellungen und die Bedeutung des Bestatteten im Vordergrund. Ziel ist es, die Grabanlage in einen spätklassisch-hellenistischen Kontext einzuordnen und ihre Datierung zu bestimmen.
- Analyse des Bildprogramms der Tomba degli Scudi
- Datierung der Grabanlage im spätklassisch-hellenistischen Kontext
- Deutung der Malereien und ihre Beziehung zueinander
- Bestimmung der Bedeutung des Bestatteten
- Vergleich mit anderen Grabanlagen aus der gleichen Zeitperiode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt zunächst in die Geschichte und Bedeutung von Tarquinia ein, der Stadt, in der sich die Tomba degli Scudi befindet. Die Forschungsgeschichte der Grabanlage wird beleuchtet, um den aktuellen Forschungsstand darzulegen. Die Arbeit erläutert die Ziele und Fragestellungen, die im Zentrum der Untersuchung stehen.
Das Kapitel "Die spätklassische und hellenistische Zeit" liefert den historischen Kontext für die Datierung der Tomba degli Scudi und beleuchtet die relevanten künstlerischen und kulturellen Entwicklungen dieser Epoche.
Im Kapitel "Beschreibung und Deutung der Malereien" werden die einzelnen Wandbilder der Grabanlage detailliert analysiert und gedeutet. Die Analyse konzentriert sich auf die Themen, Motive und Darstellungsweisen der Malereien, wobei Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bildern und ihre mögliche Bedeutung im Gesamtbild der Grabanlage herausgestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Tomba degli Scudi, Etrusker, Tarquinia, Malerei, Bildprogramm, Datierung, Spätklassik, Hellenismus, Bestattungsritual, Grabanlage, Kunstgeschichte, Archäologie, Etruskische Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Tomba degli Scudi?
Es handelt sich um eine bedeutende etruskische Grabanlage in Tarquinia, die für ihr komplexes Bildprogramm bekannt ist.
Welche Themen begegnen uns in den Malereien dieses Grabes?
Die Malereien zeigen Darstellungen der Verstorbenen, Bestattungsrituale und Symbole, die Rückschlüsse auf den sozialen Status der Familie zulassen.
In welche Zeit wird die Tomba degli Scudi datiert?
Die Arbeit ordnet die Anlage in den spätklassisch-hellenistischen Kontext ein, wobei Vergleiche mit Gräbern wie der Tomba dell' Orco I herangezogen werden.
Warum ist die Datierung ohne Funde schwierig?
Da keine publizierten Beifunde vorliegen, muss die Datierung primär über stilistische und gestalterische Vergleiche der Wandmalereien erfolgen.
Welche Bedeutung hatte der Bestattete?
Das Bildprogramm deutet darauf hin, dass die hier bestatteten Personen eine herausragende politische oder soziale Stellung in der etruskischen Gesellschaft innehatten.
- Citar trabajo
- Martin Richter (Autor), 2012, Das Bildprogramm der Tomba degli Scudi. Ein Versuch der Deutung und Datierung der Malereien der Grabanlage, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451394