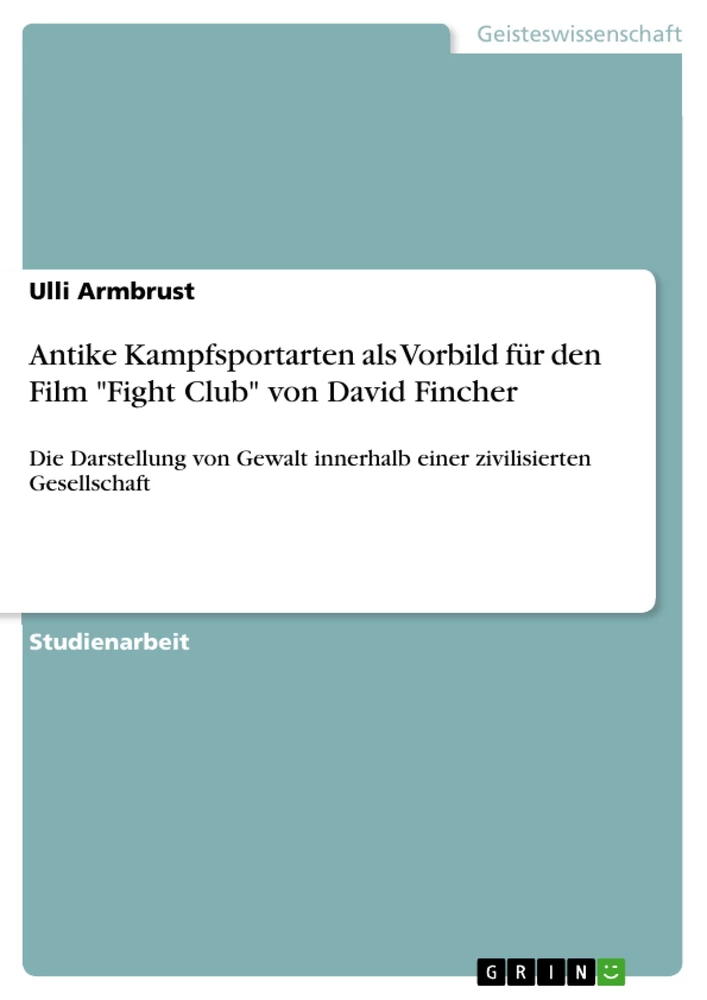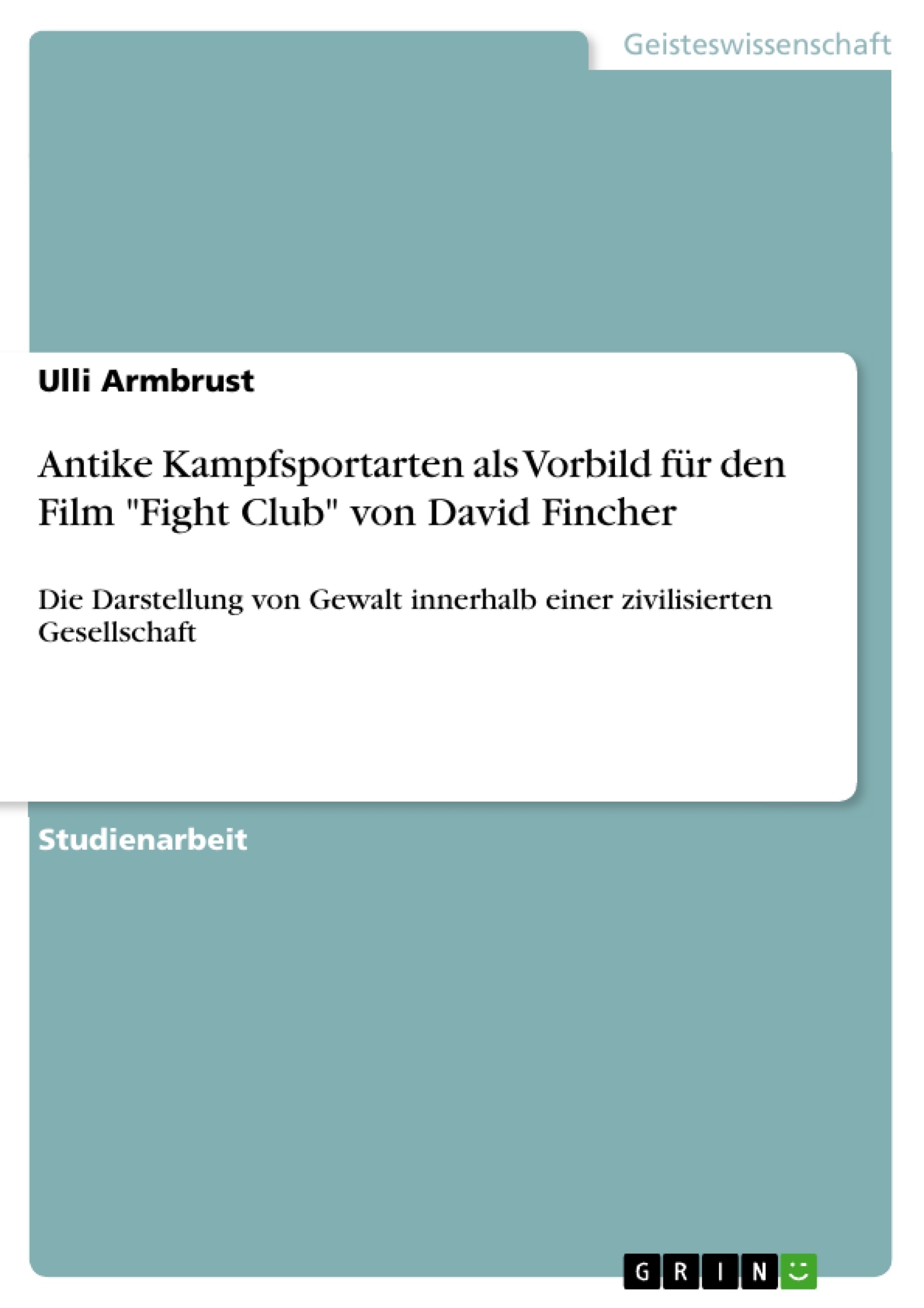Die vorliegende Seminararbeit fragt, inwieweit altgriechische Kampfsportarten David Fincher bei der Darstellung von Gewalt in seinem Film "Fight Club" aus dem Jahr 1999 als Vorbild gedient haben könnten. Darüber hinaus werden weitere Parallelen zwischen der Gesellschaft des antiken Griechenlands und der in "Fight Club" dargestellten Gesellschaft herausgearbeitet. Zudem wird mithilfe soziologischer Texte untersucht, wieso sich solch zivilisierte Gesellschaften so stark von der körperlichen Gewalt faszinieren lassen und sie sogar selbst exzessiv ausüben.
Die Mitglieder des Fight Clubs sind im gesellschaftlichen Alltag von Relevanz: Die Männer, die sich wöchentlich in dunklen Kellerräumen fast zu Tode prügeln, sind Kellner, Müllmänner und Mechaniker, aber auch Krankenwagenfahrer und Polizisten und somit Gesichter des öffentlichen Lebens und die Stützen der modernen Gesellschaft. Doch die in "Fight Club" dargestellte Kluft zwischen Zivilisation und exzessiver Gewalt ist kein einmaliges Phänomen. Schließlich weisen die Kämpfe in diesem Film deutliche Gemeinsamkeiten zum antiken Kampfsport auf.
Inhaltsverzeichnis
- Faszination Gewalt
- Gesellschaft in der griechischen Antike
- Beginn des Sports
- Teilnehmer an den Wettkämpfen
- Gewalt in den Olympischen Spielen
- Der Ringkampf
- Der Faustkampf
- Das Pankration
- Humane und wissenschaftliche Errungenschaften der Griechen
- Die Gesellschaft in Fight Club
- Gewalt in Fight Club
- Darstellung der Gewalt durch David Fincher
- Regeln im Fight Club
- Parallelen zwischen dem antiken Griechenland und Fight Club
- Gemeinsamkeiten in der Gesellschaft
- Gemeinsamkeiten im Kampf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert, inwieweit altgriechische Kampfsportarten David Fincher bei der Darstellung von Gewalt in Fight Club als Vorbild gedient haben könnten. Neben der Untersuchung der Parallelen zwischen der antiken griechischen und der in Fight Club dargestellten Gesellschaft wird zudem untersucht, warum sich zivilisierte Gesellschaften von körperlicher Gewalt so stark faszinieren lassen und sie sogar exzessiv ausüben.
- Die Darstellung von Gewalt in Fight Club im Kontext antiker griechischer Kampfsportarten
- Parallelen zwischen der antiken griechischen und der in Fight Club dargestellten Gesellschaft
- Die Faszination der Gewalt in zivilisierten Gesellschaften
- Die Rolle von Kampfsportarten in der antiken griechischen Gesellschaft
- Soziologische Perspektiven auf die Ausübung von Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Faszination der Gewalt und stellt den Zusammenhang zwischen Zivilisation und exzessiver Gewalt anhand des Films Fight Club und der antiken griechischen Olympischen Spiele her. Kapitel zwei befasst sich mit der Gesellschaft in der griechischen Antike, wobei der Fokus auf den Beginn des Sports, die Teilnehmer an den Wettkämpfen und die Rolle von Gewalt in den Olympischen Spielen liegt. Die einzelnen Kampfsportarten Ringkampf, Faustkampf und Pankration werden im Detail betrachtet. Im dritten Kapitel wird die Gesellschaft in Fight Club vorgestellt, während Kapitel vier die Darstellung von Gewalt in Fight Club, insbesondere durch David Fincher, und die Regeln im Fight Club analysiert. Abschließend werden im fünften Kapitel Parallelen zwischen dem antiken Griechenland und Fight Club in Bezug auf gesellschaftliche Strukturen und Kampfstile gezogen.
Schlüsselwörter
Antike Kampfsportarten, David Fincher, Fight Club, Gewalt, Gesellschaft, Zivilisation, Olympische Spiele, Ringkampf, Faustkampf, Pankration, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Parallelen gibt es zwischen „Fight Club“ und antiken Kampfsportarten?
Die rohe, reglementierte Gewalt im Film weist Ähnlichkeiten zum Pankration, dem antiken Allkampf, sowie zum klassischen Faust- und Ringkampf auf.
Was ist Pankration?
Pankration war eine antike olympische Disziplin, die Schlagen und Ringen kombinierte und fast ohne Regeln (außer Beißen und Augenausstechen) auskam.
Warum fasziniert Gewalt zivilisierte Gesellschaften?
Die Arbeit untersucht soziologisch, wie der Ausbruch aus dem hochzivilisierten Alltag durch körperliche Gewalt als Mittel zur Selbstvergewisserung und zum Stressabbau dienen kann.
Wer sind die Mitglieder des „Fight Club“ im Film?
Es sind Männer aus allen sozialen Schichten – Kellner, Mechaniker, aber auch Polizisten –, die im Alltag die Stützen der Gesellschaft bilden.
Wie stellt David Fincher Gewalt dar?
Fincher nutzt eine hyperrealistische und schmerzhafte Ästhetik, um die Unmittelbarkeit der körperlichen Erfahrung für die Protagonisten spürbar zu machen.
- Quote paper
- Ulli Armbrust (Author), 2015, Antike Kampfsportarten als Vorbild für den Film "Fight Club" von David Fincher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451678