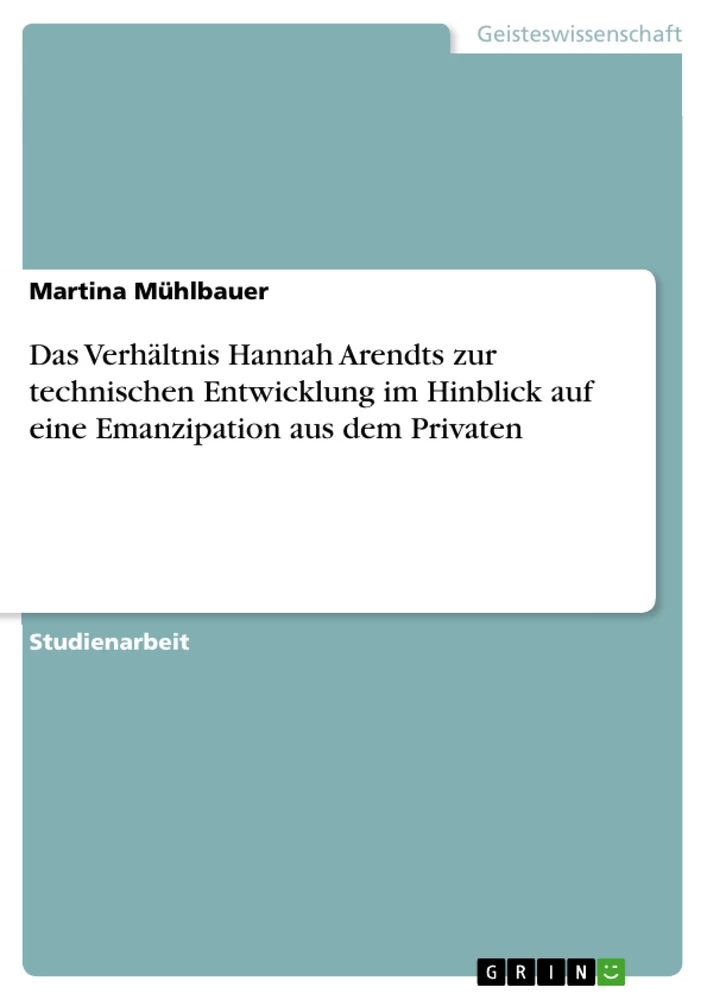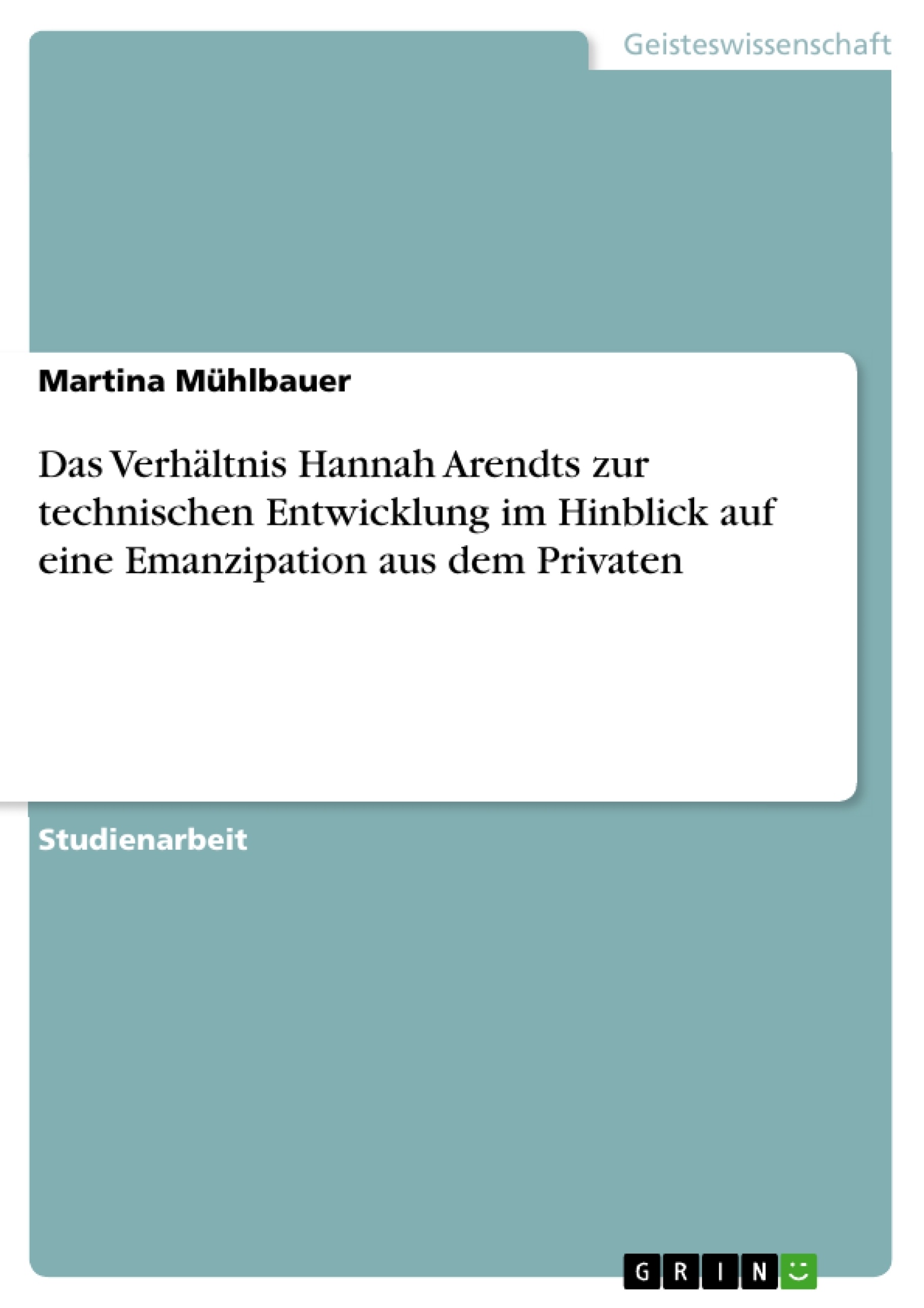Diese Arbeit beschäftigt sich mit Hannah Arendts Verhältnis zur technischen Entwicklung und stellt weiter die Frage, ob aus ihrer Sicht die Emanzipation des Menschen aus dem privaten Bereich durch technischen Fortschritt gelingen kann. Zunächst wird dazu die Arbeit, als die Tätigkeit, die der Notwendigkeit entspringt und den Menschen im Privaten hält, in Abgrenzung zum Herstellen betrachtet. Dabei findet auch der Wandel der Einstellung zur Arbeit mit dem Beginn der Neuzeit Berücksichtigung. Weiter stellt sich die Frage, aus welchem Grund die soziale Frage nicht mit politischen Mitteln lösbar ist. Die Technik als von Arendt postulierte Alternative ist der Gegenstand des letzten Kapitels der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird die technische Entwicklung grob umrissen um schließlich in Form von möglichen Chancen und Gefahren auf Arendts Bewertung ebenjener einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Arbeit und die Fessel der Lebensnotwendigkeiten
- Die Grundtätigkeiten der Vita activa
- Wesen und Verortung der Arbeit
- Wandel der Einstellung zur Arbeit in der Neuzeit
- Der politische Bereich und die soziale Frage
- Der technische Fortschritt
- Entwicklung der neuzeitlichen Technik
- Technik - Chance oder Gefahr?
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Hannah Arendts Verhältnis zur technischen Entwicklung und untersucht, ob ihrer Ansicht nach die Emanzipation des Menschen aus dem privaten Bereich durch technischen Fortschritt gelingen kann.
- Untersuchung von Arendts Sichtweise auf Arbeit und deren Bedeutung im Verhältnis zur menschlichen Existenz
- Analyse der Rolle des technischen Fortschritts in Arendts Philosophie
- Bewertung der Möglichkeit einer technischen Befreiung von der „Fessel der Lebensnotwendigkeiten“
- Beurteilung von Arendts Kritik an der „Standardauffassung“ der politischen Philosophie
- Einordnung von Arendts Werk in den Diskurs über die Vita activa und die menschliche Bedingung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Arendts Konzept der Freiheit und ihre kritische Betrachtung von Revolutionen dar, wobei sie die französische und die amerikanische Revolution vergleicht. Die Arbeit untersucht Arendts Ansatz zur Lösung der sozialen Frage und die Rolle der Technik in diesem Zusammenhang.
- Kapitel 2 befasst sich mit der Arbeit als Grundtätigkeit des Menschen, die dem Überleben dient. Es wird die Abgrenzung zur Tätigkeit des Herstellens sowie der Wandel der Einstellung zur Arbeit in der Neuzeit beleuchtet.
- Kapitel 3 analysiert Arendts Sicht auf die soziale Frage und deren Unlösbarkeit durch politische Mittel.
- Kapitel 4 widmet sich dem technischen Fortschritt als von Arendt postulierte Alternative zur Lösung der sozialen Frage. Es beschreibt die Entwicklung der Technik und geht auf mögliche Chancen und Gefahren ein.
Schlüsselwörter
Hannah Arendt, Vita activa, Arbeit, Technik, soziale Frage, Emanzipation, private Sphäre, öffentliche Sphäre, politisches Handeln, Freiheit, Revolution, moderne Entwicklung, The Human Condition.
- Quote paper
- Martina Mühlbauer (Author), 2018, Das Verhältnis Hannah Arendts zur technischen Entwicklung im Hinblick auf eine Emanzipation aus dem Privaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451702