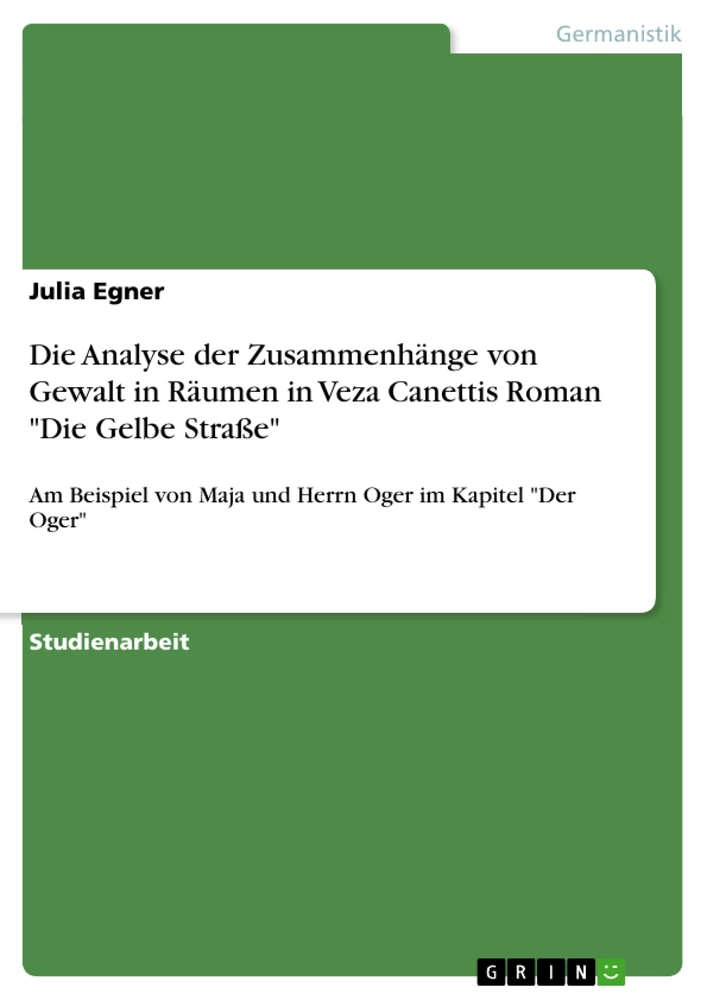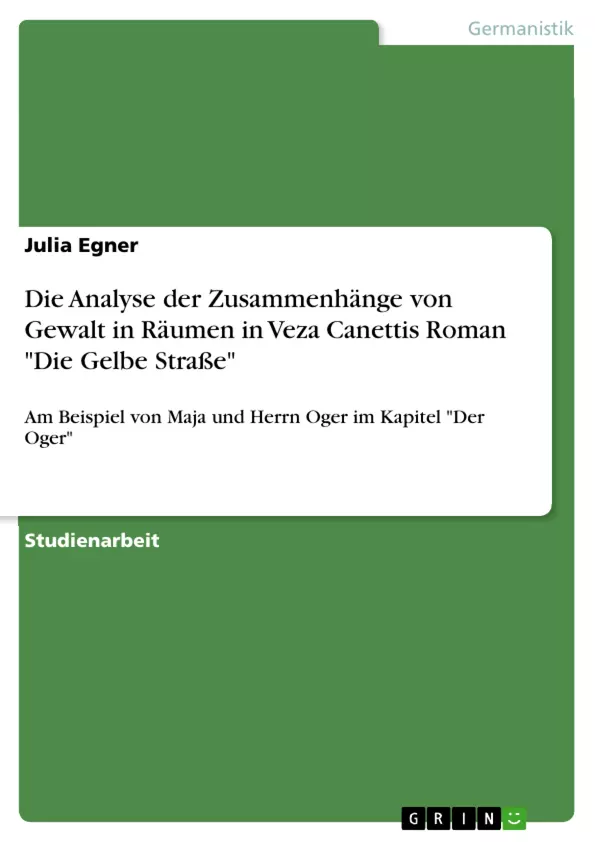Die im Folgenden analysierte Erzählung "Der Oger" konzentriert sich auf den Unabhängigkeitskampf der Protagonistin und den Erhalt ihrer Würde unter demütigenden, patriarchalischen Lebensverhältnissen. Ein Thema, das auch noch 80 Jahre nach entstehen des ursprünglichen Dramas aktuell ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gelbe Straße von Veza Canetti
- Veza Canetti: Leben und Werk
- Der Inhalt des Romans Die Gelbe Straße
- Gewalttheorien und Raumanalyse
- Räume im Roman
- Der Begriff der Gewalt
- Der Gewaltbegriff im deutschen Sprachgebrauch
- Der soziologische Gewaltbegriff
- Die strafrechtliche Definition von Gewalt
- Fazit und maßgeblicher Gewaltbegriff
- Gewalt und Raum in Veza Canettis Die Gelbe Straße
- Das Zugabteil und die Kutsche
- Majas Sozialraum: Die Straße selbst und ihre Bewohner
- Majas Intimraum: Die erste Wohnung
- Majas Intimraum: Die neue Wohnung
- Majas Flucht in sich selbst: Das Sanatorium - Der mentale Raum
- Der gesetzliche und soziale Raum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Zusammenhänge von Gewalt und Räumen in Veza Canettis Roman „Die Gelbe Straße" am Beispiel der Figur Maja und Herrn Iger im Kapitel „Der Oger".
- Die Darstellung von Gewalt in der Literatur
- Die Rolle von Räumen in der Konstruktion von Gewalt
- Die Darstellung von Machtverhältnissen in der Familie
- Die Auswirkungen von Gewalt auf die psychische Gesundheit
- Der Kampf um Autonomie und Würde unter patriarchalen Bedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Veza Canetti, ihr Leben und ihr Werk, sowie den Inhalt des Romans „Die Gelbe Straße" vor. Anschließend werden verschiedene Gewalttheorien und die Bedeutung von Raum in der Literaturwissenschaft erläutert.
Der Hauptteil befasst sich mit dem Kapitel „Der Oger" und untersucht die Beziehung zwischen Gewalt und Raum anhand der Figuren Maja und Herr Iger. Dabei werden verschiedene Räume wie das Zugabteil, Majas Sozialraum, ihre Wohnung und schließlich das Sanatorium analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gewalt, Raum, Patriarchat, Autonomie, Würde, psychische Gesundheit und literarische Analyse. Im Fokus steht die Analyse des Romans „Die Gelbe Straße" von Veza Canetti und die Figur Maja im Kapitel „Der Oger".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Veza Canettis Roman "Die Gelbe Straße"?
Der Roman beschreibt das Leben und die sozialen Missstände in einer Wiener Straße, wobei besonders die Unterdrückung von Frauen thematisiert wird.
Welche Rolle spielt der Raum in der Darstellung von Gewalt?
Räume wie die Wohnung (Intimraum) oder das Zugabteil werden als Orte der Einengung und Machtausübung analysiert, in denen patriarchale Gewalt stattfindet.
Wer ist die Figur Maja im Kapitel "Der Oger"?
Maja ist die Protagonistin, die um ihre Würde und Autonomie gegen den tyrannischen Herrn Iger kämpft.
Wie wird Gewalt in dieser literarischen Analyse definiert?
Die Analyse nutzt soziologische und psychologische Gewaltbegriffe, die über rein physische Gewalt hinausgehen und auch Demütigung und psychische Unterdrückung umfassen.
Was symbolisiert das Sanatorium für Maja?
Das Sanatorium stellt einen mentalen Fluchtraum dar, in dem Maja versucht, sich der Gewalt des häuslichen Umfelds zu entziehen.
- Citar trabajo
- Julia Egner (Autor), 2018, Die Analyse der Zusammenhänge von Gewalt in Räumen in Veza Canettis Roman "Die Gelbe Straße", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451842