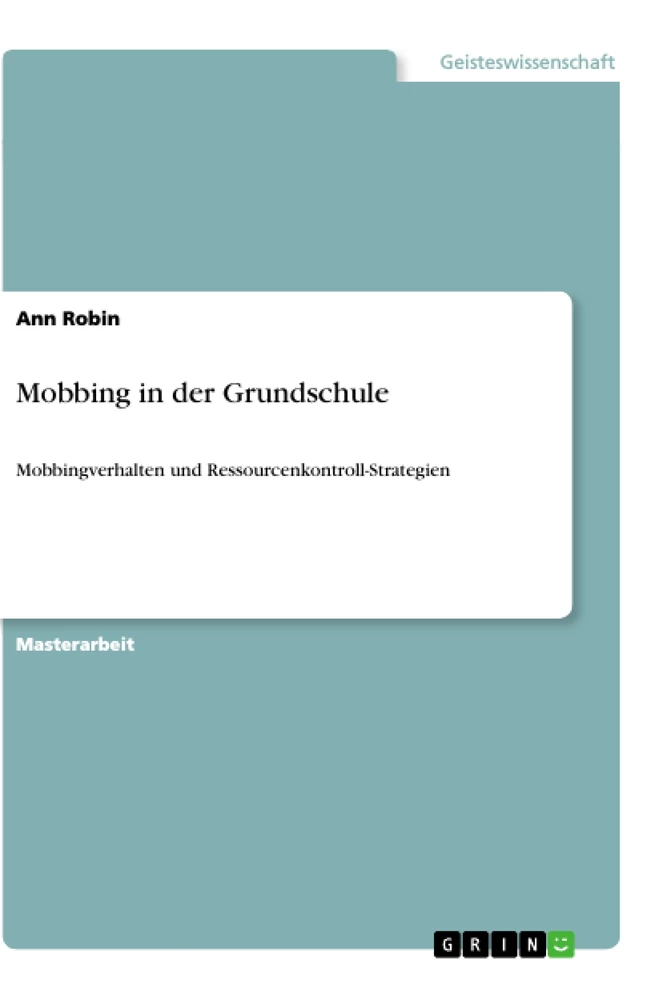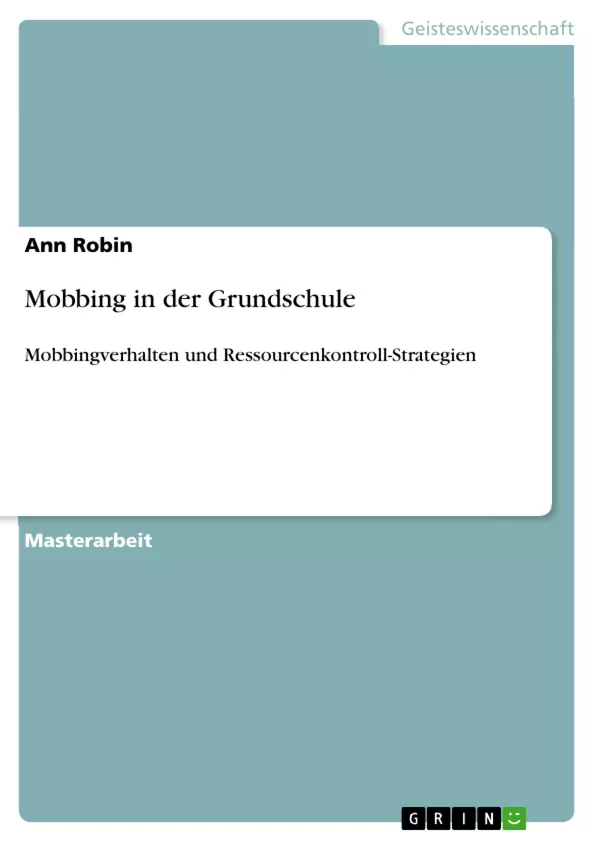Diese Arbeit untersucht das Gruppenphänomen Mobbing in Grundschulen, besonders in Zusammenhang mit den sozialen Ressourcenstrategien nach Hawley. Hierzu erfolgt eine Untersuchung von 331 Schülern einer Münchner Grundschule.
Insgesamt ist für 86 Prozent dieser Schüler eine eindeutige Rolle als Täter, Assistent, Verstärker, Verteidiger, Außenstehender oder Opfer identifizierbar. Es zeigt sich, dass Jungen eher aggressive Rollen einnehmen als Mädchen, die häufiger Verteidiger, Außenstehender oder Opfer sind. Bezüglich der Strategien zur Ressourcenkontrolle zeigt sich, dass es Dominanzunterschiede zwischen den Schülern gibt und dass sowohl prosoziale als auch coercive Strategien angewandt werden. Dabei zeigt sich, dass Mädchen häufiger prosozial agieren als Jungen, um ihren Willen durchzusetzen. Im Zusammenhang mit Mobbing lässt sich belegen, dass die Schüler ähnliche Verhaltenstendenzen im Mobbing zeigen wie in dem Kampf um Ressourcen. Außerdem kann aufgezeigt werden, dass Kinder, die sich aktiv am Mobbing beteiligen, besonders viel Macht innehaben. Insbesondere durch die Gruppe der Bistrategen, die über viel Macht verfügen und sich aktiv am Mobbing beteiligen, konnte der Zusammenhang noch stärker veranschaulicht werden.
Das Phänomen Mobbing ist ein Thema, das immer wieder in der aktuellen Presse diskutiert wird und viel Resonanz erfährt, da es immer wieder im Schulalltag vorkommt und weitreichende Folgen für die Beteiligten nach sich zieht. In der Forschung wurde Mobbing schon in den 60ern Jahren zum Forschungsgegenstand. Wenn Mobbing in der Schule stattfindet, handelt es sich dabei um einen Gruppenprozess, der viel mehr Kinder einbezieht als nur Opfer und Täter. Der Participant Role Ansatz von Salmivalli und Kollegen beschreibt verschiedene Rollen, die sich auch auf den Grundschulbereich übertragen lassen. Die verschiedenen Verhaltenstendenzen, die Kinder in einem Mobbingprozess zeigen, können nach unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel dem sozialen Status oder soziokognitiven Faktoren, differenziert werden. In dieser Arbeit wird ein weiterer sozialer Faktor, der Einfluss des Dominanzstrebens und der Strategien, die Kinder verwenden, um soziale Ressourcen zu kontrollieren, als sozialer Einflussfaktor von Mobbing untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Definition von Mobbing und Befunde zum Ausmaß
- 2.1.1. Zur Klärung des Begriffes Mobbing
- 2.1.2. Eine Definition von Mobbing
- 2.2. Mobbing als Gruppenphänomen
- 2.2.1. Gründe und Motive für Mobbing
- 2.2.2. Mobbing als gruppendynamischer Prozess
- 2.2.3. Die Entstehung des „Participant Role“ Ansatzes
- 2.2.4. Die Mitschülerrollen im Mobbingprozess
- 2.2.5. Die Sekundärrollen im Mobbingprozess
- 2.2.6. Geschlechtsunterschiede bei Mobbing
- 2.2.7. Altersunterschiede bei Mobbing
- 2.3. Die „Resource Control“ Theorie
- 2.3.1. Entwicklungspsychologische Grundlagen
- 2.3.2. Die „Resource Control Groups“
- 2.3.3. Geschlechterunterschiede in Bezug auf die Ressourcenkontrolle
- 2.4. Zum Zusammenhang zwischen Mobbing und Ressourcenkontrolle
- 2.5. Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit
- 3. Methode
- 3.1. Stichprobe
- 3.2. Durchführung
- 3.3. Erhebungsinstrument
- 3.3.1. Participant Role Questionaire
- 3.3.2. Ressourcenkontrolle
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Deskriptive Analyse der Mobbingrollen
- 4.1.1. Die Primärrollen
- 4.1.2. Die Sekundärrollen
- 4.1.3. Die Doppelrollen
- 4.2. Deskriptive Analyse der Ressourcenkontrolle
- 4.2.1. Prävalenz der Ressourcenkontroll-Gruppen
- 4.2.2. Ressourcenkontrolle in Abhängigkeit der Ressourcenkontroll-Gruppen
- 4.3. Der Zusammenhang zwischen den Participant Roles und der Ressourcenkontrolle
- 4.3.1. Verteilung der Ressourcenkontroll-Gruppen in Abhängigkeit der Primärrollen
- 4.3.2. Verteilung der Ressourcenkontroll-Gruppen in Abhängigkeit der Doppelrollen
- 4.3.3. Ressourcenkontrolle in Abhängigkeit der Mobbingrollen
- 4.3.4. Die Bistrategen
- 5. Zusammenfassung und Diskussion
- 5.1. Prävalenz der Mobbingrollen
- 5.1.1. Die Primärrollen
- 5.1.2. Die Konsistenz der Participant Roles
- 5.2. Die Ressourcenkontrollstrategien
- 5.2.1. Die Verteilung der Ressourcenkontroll-Gruppen
- 5.2.2. Die Ressourcenkontrolle der Ressourcenkontroll-Gruppen
- 5.3. Der Zusammenhang zwischen den Participant Roles und den Ressourcenkontrollstrategien
- 5.3.1. Die Ressourcenkontrolle der Participant Roles
- 5.3.2. Die Verteilung der Ressourcenkontroll-Gruppen in Bezug auf die Participant Roles
- 5.3.3. Die Bistrategen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mobbingverhalten und Ressourcenkontrollstrategien in der Grundschule. Ziel ist es, das Gruppenphänomen Mobbing unter Anwendung des „Participant Role Ansatzes“ und der „Resource Control“ Theorie zu analysieren und die Beziehung zwischen den beteiligten Rollen und den Strategien zur Ressourcenkontrolle aufzuzeigen.
- Mobbingrollen in der Grundschule und deren Verbreitung
- Ressourcenkontrollstrategien von Grundschulkindern
- Geschlechtsunterschiede im Mobbingverhalten und in der Anwendung von Ressourcenkontrollstrategien
- Zusammenhang zwischen Mobbingbeteiligung und dem Zugriff auf Ressourcen
- Analyse der Rolle der „Bistrategen“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik von Mobbing in der Grundschule ein und skizziert die Forschungsfragen der Arbeit. Es wird die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Mobbing und Ressourcenkontrolle hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit erläutert.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Studie. Es werden verschiedene Definitionen von Mobbing diskutiert und Befunde zum Ausmaß des Phänomens vorgestellt. Der „Participant Role Ansatz“ wird detailliert beschrieben, ebenso wie die „Resource Control“ Theorie. Der Fokus liegt auf der Erklärung von Mobbing als Gruppenphänomen und auf der Rolle von Ressourcenkontrolle als Motivator für Mobbingverhalten. Geschlechts- und Altersunterschiede im Mobbingkontext werden ebenfalls thematisiert.
3. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, inklusive der Stichprobenbeschreibung, der Durchführung der Datenerhebung und der verwendeten Erhebungsinstrumente (Participant Role Questionaire und Ressourcenkontrollfragebogen). Die Auswahl der Methodik und der Begründung für die gewählten Instrumente werden detailliert dargelegt.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden deskriptive Analysen der Mobbingrollen (Primär-, Sekundär- und Doppelrollen) und der Ressourcenkontrollstrategien vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Zusammenhangs zwischen den verschiedenen Mobbingrollen und den angewandten Ressourcenkontrollstrategien. Die Analyse der „Bistrategen“ wird ebenfalls detailliert dargestellt.
5. Zusammenfassung und Diskussion: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen und diskutiert diese im Kontext der bestehenden Literatur. Die Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis von Mobbing in der Grundschule wird beleuchtet und mögliche Implikationen für die Praxis werden diskutiert. Die Ergebnisse werden in Bezug auf Geschlechtsunterschiede und die Rolle der Ressourcenkontrolle interpretiert.
Schlüsselwörter
Mobbing, Grundschule, Ressourcenkontrolle, Participant Role Ansatz, Gruppenphänomen, Geschlechtsunterschiede, Aggression, Prosoziales Verhalten, Bistrategen, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Mobbing und Ressourcenkontrolle in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Mobbingverhalten und Ressourcenkontrollstrategien bei Grundschulkindern. Sie analysiert Mobbing als Gruppenphänomen und beleuchtet die Beziehung zwischen den Rollen der beteiligten Kinder und ihren Strategien zur Ressourcenkontrolle.
Welche Theorien bilden den theoretischen Rahmen der Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf den „Participant Role Ansatz“, der verschiedene Rollen im Mobbingprozess (Primär-, Sekundär- und Doppelrollen) beschreibt, und die „Resource Control“ Theorie, die die Bedeutung von Ressourcenkontrolle für das Verhalten von Kindern erklärt.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Verbreitung von Mobbingrollen in der Grundschule, die Ressourcenkontrollstrategien der Kinder, Geschlechtsunterschiede im Mobbingverhalten und in der Anwendung von Ressourcenkontrollstrategien, den Zusammenhang zwischen Mobbingbeteiligung und dem Zugriff auf Ressourcen sowie die Rolle der „Bistrategen“ (Kinder, die sowohl mobben als auch gemobbt werden).
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet den „Participant Role Questionaire“ zur Erfassung der Mobbingrollen und einen Fragebogen zur Erhebung der Ressourcenkontrollstrategien. Die Stichprobe, die Durchführung der Datenerhebung und die Begründung für die Wahl der Methoden werden detailliert im Methodenkapitel beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen deskriptive Analysen der Mobbingrollen (Primär-, Sekundär- und Doppelrollen) und der Ressourcenkontrollstrategien. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Zusammenhangs zwischen diesen Rollen und den angewandten Ressourcenkontrollstrategien. Die Analyse der „Bistrategen“ wird ebenfalls detailliert dargestellt.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Das Kapitel „Zusammenfassung und Diskussion“ fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, diskutiert diese im Kontext bestehender Literatur und beleuchtet die Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis von Mobbing in der Grundschule. Die Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt Geschlechtsunterschiede und die Rolle der Ressourcenkontrolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Grundschule, Ressourcenkontrolle, Participant Role Ansatz, Gruppenphänomen, Geschlechtsunterschiede, Aggression, Prosoziales Verhalten, Bistrategen, Entwicklungspsychologie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methode, Ergebnisse und Zusammenfassung und Diskussion. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Unterkapiteln ist im HTML-Code enthalten.
- Citar trabajo
- Ann Robin (Autor), 2010, Mobbing in der Grundschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452278