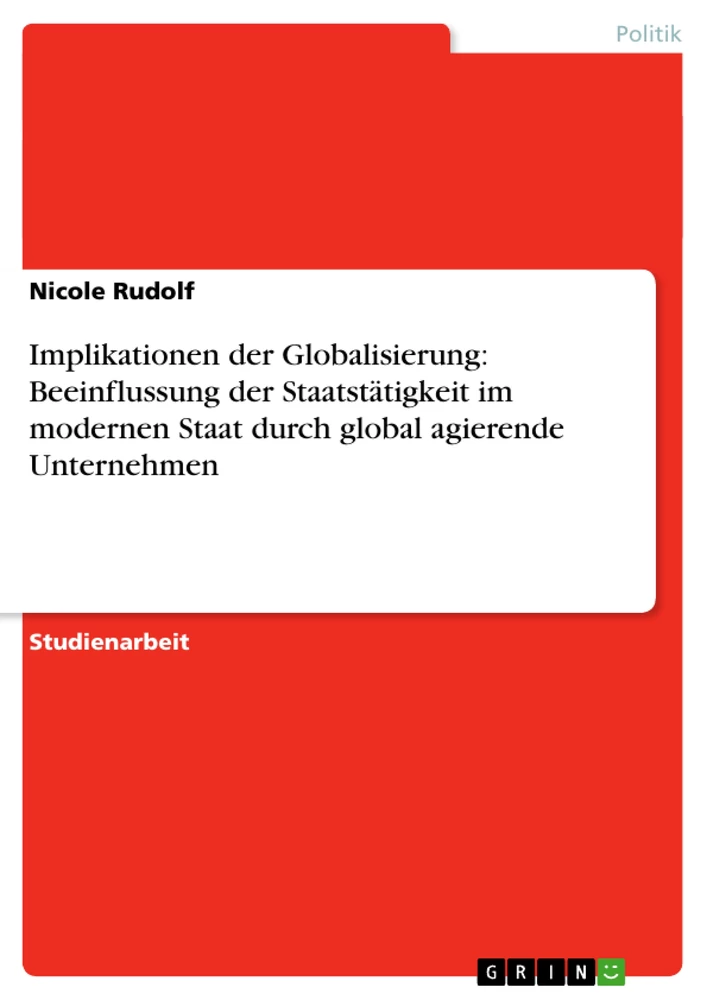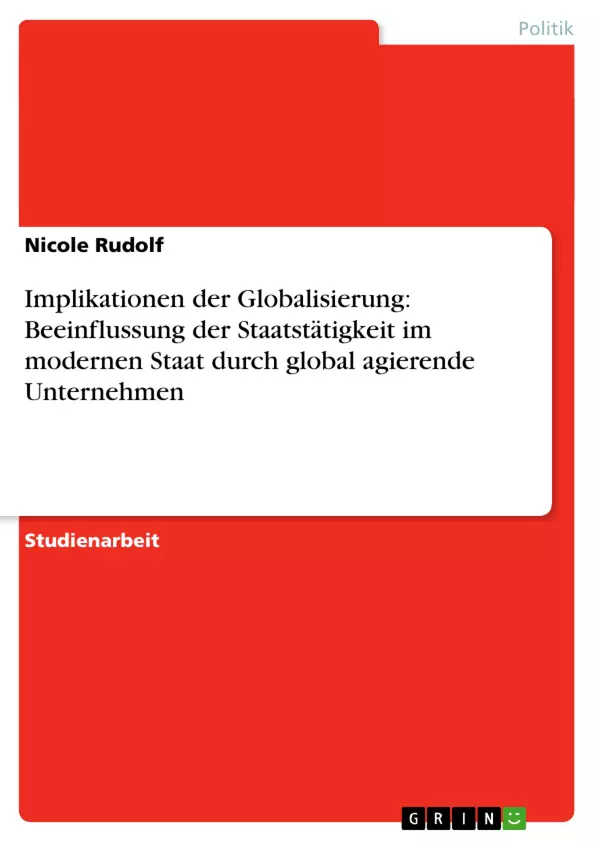Ganz gleich, ob mit Globalisierung ein neues Phänomen oder nur die Neuauflage eines bereits vor dem Ersten Weltkrieg erreichten weltwirtschaftlichen Integrationsgrades bezeichnet wird, der Begriff an sich taucht verstärkt im akademischen Sprachgebrauch und in der breiten Öffentlichkeit erst seit Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre auf. Globalisierung bezeichnet einen Prozess, der nahezu alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, so dass es nicht verwundert, wenn sich verschiedene Wissenschaftsdisziplinen seiner Analyse annehmen. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass ökonomische Entwicklungen den Prozess bestimmen, wohingegen die Auswirkungen der Globalisierung äußerst kontrovers diskutiert werden und sich nicht selten gegenläufige Auffassungen in der Literatur wiederfinden. Der Globalisierungsprozess tangiert neben anderen Gesellschaftsbereichen vor allem den Wirtschaftssektor selbst als auch die politische Sphäre. Offensichtlich ist, dass die Politik mit neuen globalen Herausforderungen konfrontiert wird, für deren Entstehung sie selbst mit verantwortlich ist. Hinsichtlich der Fragestellung, ob ihr Handlungsspielraum dadurch eingeengt, erweitert oder verändert wird, existieren konträre und differenzierte Auffassungen. Die vorliegende Arbeit greift einen Teilaspekt der Diskussion heraus und geht der Frage nach, in welcher Weise global agierende Unternehmen die Staatstätigkeit im modernen Staat beeinflussen.
Dabei soll zunächst Klarheit über die Begriffe der Globalisierung und der global agierenden Unternehmen geschaffen werden. Es folgt eine Darstellung der verschiedenen Positionen in der Globalisierungsdebatte. Diese vermittelt vor allem einen Überblick über die Auffassungen, die hinsichtlich des Globalisierungsausmaßes und der Auswirkungen des Globalisierungsprozesses auf den Staat existieren. Dabei wird argumentiert, dass die Extremszenarien der Hyperglobalisierer und der Globalisierungsskeptiker an der Wirklichkeit vorbeigehen und diese die Beeinflussung der Staatstätigkeit durch global agierende Unternehmen entweder über- oder unterschätzen. Ausgehend von dem Leitbild der Transformationalisten, die trotz eines tendenziellen Wandels der Staatstätigkeit auf den Fortbestand der staatlichen Handlungsfähigkeit vertrauen, wird in Kapitel fünf auf das eigentliche Hauptthema eingegangen: Die Beeinflussung der Staatstätigkeit durch global agierende Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GLOBALISIERUNG
- DEFINITORISCHE ANNÄHERUNG UND INHALT-LICHE ABGRENZUNG
- GLOBAL AGIERENDE UNTERNEHMEN: TRIEBKRÄFTE UND GETRIE-BENE DER GLOBALISIERUNG
- POSITIONEN IN DER GLOBALISIERUNGSDEBATTE
- Die Hyperglobalisierer
- Die Globalisierungsskeptiker
- Kritische Würdigung der Positionen der Hyperglobalisierer und der Globalisierungsskeptiker
- Die Transformationalisten
- BEEINFLUSSUNG DER STAATSTÄTIGKEIT IM MODERNEN STAAT DURCH GLOBAL AGIERENDE UNTERNEHMEN
- Zur Staatstätigkeit im modernen Staat
- Elementare staatliche Ordnungsprinzipien
- Grundlegende Aufgaben des Staates
- Steuerungs- und Regulierungsinstrumente des Staates
- Handlungsweisen global agierender Unternehmen und deren Auswirkungen auf die Staatstätigkeit
- Ausnutzen globaler Standortvorteile
- Ausnutzen des politischen Macht- und Drohpotentials
- Konsequenzen für die Staatstätigkeit
- Anmerkungen zur empirischen Überprüfbarkeit
- SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss global agierender Unternehmen auf die Staatstätigkeit im modernen Staat. Sie beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf den Globalisierungsprozess und analysiert die Handlungsweisen globaler Unternehmen im Kontext staatlicher Steuerungs- und Regulierungsmechanismen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der Globalisierung
- Analyse der verschiedenen Positionen in der Globalisierungsdebatte (Hyperglobalisierer, Globalisierungsskeptiker, Transformationalisten)
- Die Rolle von global agierenden Unternehmen als Triebkraft und Getriebene der Globalisierung
- Die Auswirkungen globaler Unternehmen auf die Staatstätigkeit
- Konsequenzen für die Handlungsfähigkeit des Staates im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einführung stellt den Kontext und die Relevanz des Themas "Beeinflussung der Staatstätigkeit durch global agierende Unternehmen" dar. Der Begriff der Globalisierung wird eingeführt, und die Problematik der unterschiedlichen Perspektiven und Auffassungen im Zusammenhang mit dem Globalisierungsprozess wird beleuchtet.
- Globalisierung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Globalisierung". Die verschiedenen Facetten des Phänomens werden untersucht, und es wird herausgestellt, dass es sich bei Globalisierung um einen dynamischen Prozess handelt, der alle Bereiche der Gesellschaft beeinflusst.
- Global agierende Unternehmen: Das Kapitel beleuchtet die Treiber und Getriebenen der Globalisierung, wobei der Fokus auf global agierenden Unternehmen liegt. Die Bedeutung dieser Unternehmen als Akteure im Globalisierungsprozess wird diskutiert, und es werden die Faktoren analysiert, die ihre transnationalen Aktivitäten antreiben.
- Positionen in der Globalisierungsdebatte: Hier werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Globalisierung präsentiert, wie z.B. die Sichtweisen der Hyperglobalisierer, Globalisierungsskeptiker und Transformationalisten. Die verschiedenen Argumentationslinien werden erläutert, und es wird herausgestellt, dass die Extremszenarien nicht die gesamte Komplexität des Globalisierungsprozesses abbilden.
- Beeinflussung der Staatstätigkeit: Dieses Kapitel widmet sich der Kernfrage der Arbeit: Wie beeinflussen global agierende Unternehmen die Staatstätigkeit? Zuerst werden die grundlegenden Elemente des Staates und seiner Handlungsfähigkeit beschrieben, um anschließend die konkreten Handlungsweisen globaler Unternehmen und deren Auswirkungen auf die Staatsfunktionen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Global agierende Unternehmen, Staatstätigkeit, moderne Staat, Politik, Ökonomie, Hyperglobalisierung, Globalisierungsskeptiker, Transformationalisten, Standortvorteile, Machtpotential, Steuerungs- und Regulierungsinstrumente.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen globale Unternehmen die Staatstätigkeit?
Durch die Nutzung globaler Standortvorteile und ihr politisches Machtpotential können Unternehmen Druck auf nationale Gesetzgebungen und Steuersysteme ausüben.
Wer sind die „Hyperglobalisierer“?
Vertreter dieser Position glauben, dass der Nationalstaat durch die Globalisierung seine Macht verliert und durch einen globalen Markt ersetzt wird.
Was unterscheidet Globalisierungsskeptiker von Transformationalisten?
Skeptiker halten Globalisierung für einen Mythos oder übertrieben; Transformationalisten sehen einen realen Wandel der Staatstätigkeit, aber keinen Machtverlust des Staates.
Was ist das „Drohpotential“ globaler Unternehmen?
Unternehmen können mit dem Abzug von Kapital oder der Verlagerung von Arbeitsplätzen drohen, um günstigere politische Rahmenbedingungen zu erzwingen.
Verliert der Staat durch Globalisierung seine Handlungsfähigkeit?
Die Arbeit zeigt, dass sich der Handlungsspielraum verändert und neue Regulierungsformen notwendig werden, der Staat aber weiterhin eine zentrale Rolle spielt.
- Quote paper
- Nicole Rudolf (Author), 2005, Implikationen der Globalisierung: Beeinflussung der Staatstätigkeit im modernen Staat durch global agierende Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45239