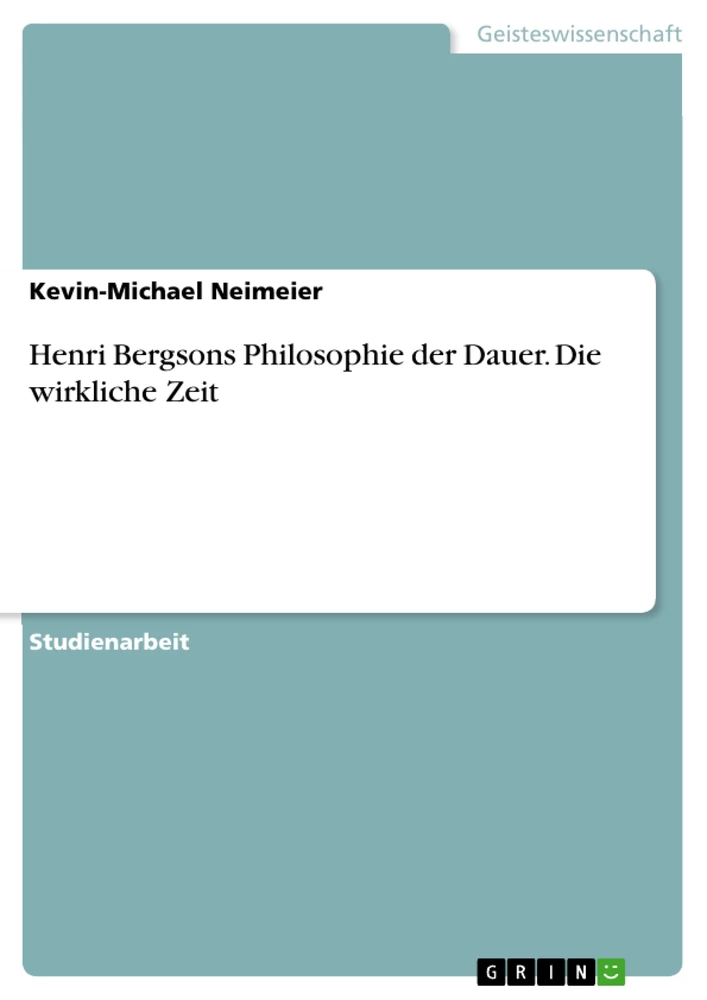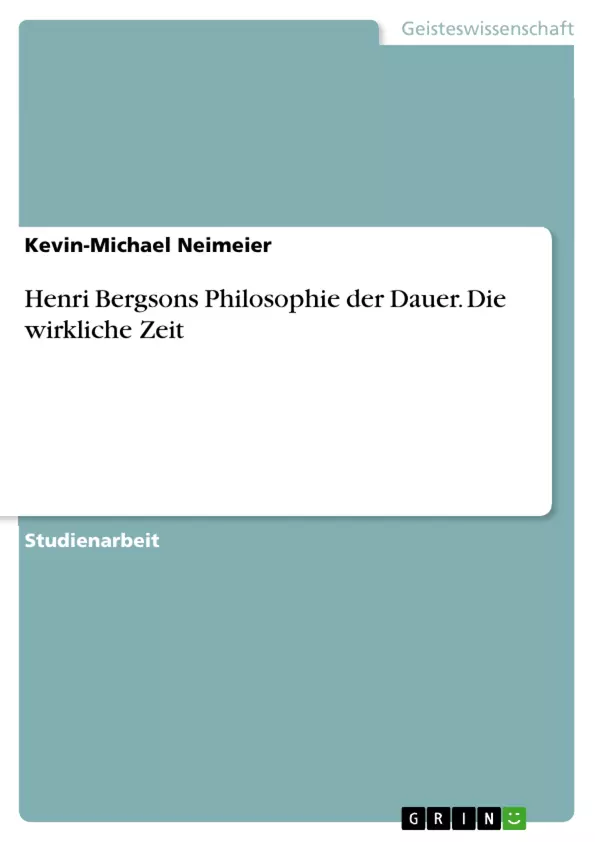Diese wissenschaftliche Arbeit hat die Zeitphilosophie Henri Bergsons zum Gegenstand und wird versuchen, von dieser ein möglichst klares Bild abzulichten. Insbesondere soll hierbei die Differenz zwischen zwei gegensätzlichen Arten der Zeitwahrnehmung herausgearbeitet werden: zum einen unser alltägliches Verständnis der Zeit, welche eine abstrakte, mathematische Form der Zeit ist, sowie zum anderen die von Bergson dargestellten Dauer, welche von ihm als die wirkliche Zeit konzipiert ist und die Schichten unserer Wirklichkeit entfaltet.
Die Philosophie Bergsons hat wohl keine Veränderung der Art und Weise der menschlichen Sinneswahrnehmung, wie sie Walter Benjamin im anfänglichen Zitat beschreibt, mit sich gebracht, jedoch kann diese als eine Antwort auf die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert veränderte Daseinsweise in der entstehenden modernen Gesellschaft verstanden werden. Sein Gesamtwerk ist eine Art der Lebensphilosophie, welche eine optimistische Erklärung der Wirklichkeit bietet: einen Ausbruch aus der mechanischen, utilitaristischen und rationalistischen Moderne. Seine Philosophie eröffnet eine Kritik an der Assoziationspsychologie, der materialistischen Theorie des Geistes, der mechanischen Konzeption der Evolution sowie der soziologischen Interpretation der Religion.
Obgleich weder seiner Philosophie noch seiner Person an sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts größere Bedeutung beigemessen wurde, ist die Wirkung, die er auf seine Zeitgenossen auslöste, kaum zu unterschätzen. Der als Dichterphilosoph bekannte Nobelpreisträger löste eine Sogwirkung aus, die in der modernen Wissenschaft lediglich mit der des Jean-Paul Sartre vergleichbar ist. Sein poetischer Stil erschafft wirkmächtige Bilder, die versuchen die Wirklichkeit abzubilden und anhand dieser eine Analyse zu ermöglichen. So werden exempli causa Ideen, welchen Bergson keinen Wahrheitswert zuschreibt, als Illusionen dargestellt: Trugbilder, die die Wirklichkeit verschleiern.
Diese Arbeit folgt hinsichtlich der Betrachtung der Zeitphilosophie maßgeblich dem Werk "Philosophie der Dauer" von Henri Bergson, welches von Gilles Deleuze ausgewählte Texte enthält, dem Werk Bergson zur Einführung von Gilles Deleuze sowie Henri Bergson- Ein Dichterphilosoph von Leszek Kolakowski.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung in die Zeit
- Zeit und Raum
- Der Fluss der Zeit
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Zeitphilosophie Henri Bergsons und versucht, ein klares Bild seiner Ideen zu zeichnen. Dabei soll die Differenz zwischen der alltäglichen, abstrakten Zeitwahrnehmung und Bergsons "Dauer" als der "wirklichen Zeit" herausgearbeitet werden. Bergsons Philosophie kann als Antwort auf die Veränderungen der Daseinsweise in der entstehenden modernen Gesellschaft gesehen werden. Sein Werk bietet eine optimistische Kritik an den mechanistischen, utilitaristischen und rationalistischen Strömungen der Zeit und eröffnet einen Ausbruch aus der modernen Lebensweise.
- Die Unterscheidung zwischen abstrakter Zeit und Bergsons "Dauer" als der "wirklichen Zeit"
- Kritik an den mechanistischen, utilitaristischen und rationalistischen Strömungen der Zeit
- Bergsons Philosophie als eine Art der Lebensphilosophie
- Die Bedeutung von Bergsons Philosophie für die gesellschaftliche Wirklichkeit des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts
- Bergsons Kritik an der Assoziationspsychologie, der materialistischen Theorie des Geistes und der mechanischen Konzeption der Evolution
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Gegenstand der Arbeit vor und beschreibt die Intention, ein klares Bild von Henri Bergsons Zeitphilosophie zu zeichnen. Dabei wird die Unterscheidung zwischen der alltäglichen Zeitwahrnehmung und Bergsons "Dauer" als der "wirklichen Zeit" hervorgehoben. Die Arbeit betrachtet Bergsons Philosophie als eine Antwort auf die Veränderungen der Daseinsweise in der entstehenden modernen Gesellschaft und stellt seinen optimistischen Ansatz gegenüber den mechanistischen, utilitaristischen und rationalistischen Strömungen der Zeit dar.
Einordnung in die Zeit
Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen Gegebenheiten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die zur Popularität von Bergsons Ideen führten. Es werden die Veränderungen des Kapitalismus, die Aufkommens des Liberalismus, die utilitaristische und empiristische Betrachtung der Wirklichkeit und die evolutionstheoretischen Anschauungen der Zeit beleuchtet. Bergsons Philosophie wird als eine Antwort auf diese Strömungen dargestellt, die eine "Befreiung" vom mechanistischen und rationalistischen Denken bot.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Zeitphilosophie Henri Bergsons, die Unterscheidung zwischen abstrakter Zeit und "Dauer", die Kritik an der mechanistischen und rationalistischen Sichtweise der Welt, die Lebensphilosophie und die gesellschaftlichen Veränderungen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Unterschied in Bergsons Zeitwahrnehmung?
Bergson unterscheidet zwischen der abstrakten, mathematischen Zeit des Alltags und der „Dauer“ (durée) als der wirklichen, gelebten Zeit.
Warum wird Bergson als „Dichterphilosoph“ bezeichnet?
Aufgrund seines poetischen Stils und der Verwendung wirkmächtiger Bilder versucht er, die Wirklichkeit abzubilden, statt sie nur rein rationalistisch zu analysieren.
Gegen welche Strömungen richtet sich Bergsons Philosophie?
Sein Werk ist eine Kritik am Mechanismus, Utilitarismus und Rationalismus der Moderne sowie an der materialistischen Theorie des Geistes.
Welche Rolle spielt die „Dauer“ in Bergsons Lebensphilosophie?
Die Dauer entfaltet die Schichten der Wirklichkeit und bietet einen Ausbruch aus der mechanischen Taktung der modernen Gesellschaft.
Welche wissenschaftliche Bedeutung hat Bergson heute?
Obwohl seine Bedeutung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abnahm, war sein Einfluss auf Zeitgenossen und die moderne Wissenschaft (vergleichbar mit Sartre) immens.
- Quote paper
- Kevin-Michael Neimeier (Author), 2017, Henri Bergsons Philosophie der Dauer. Die wirkliche Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452444