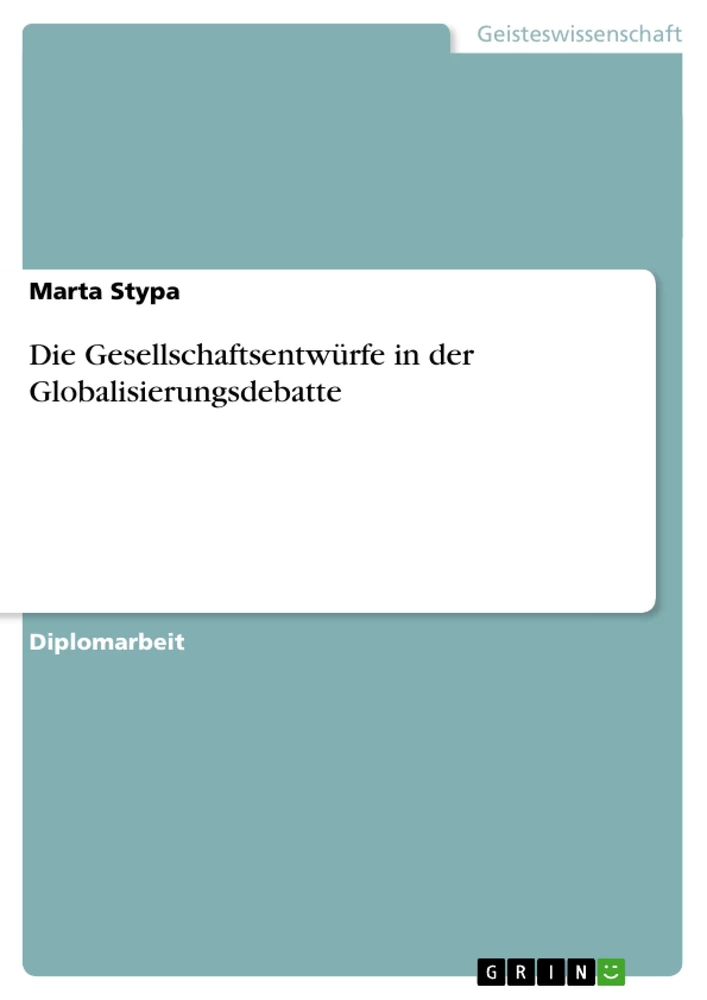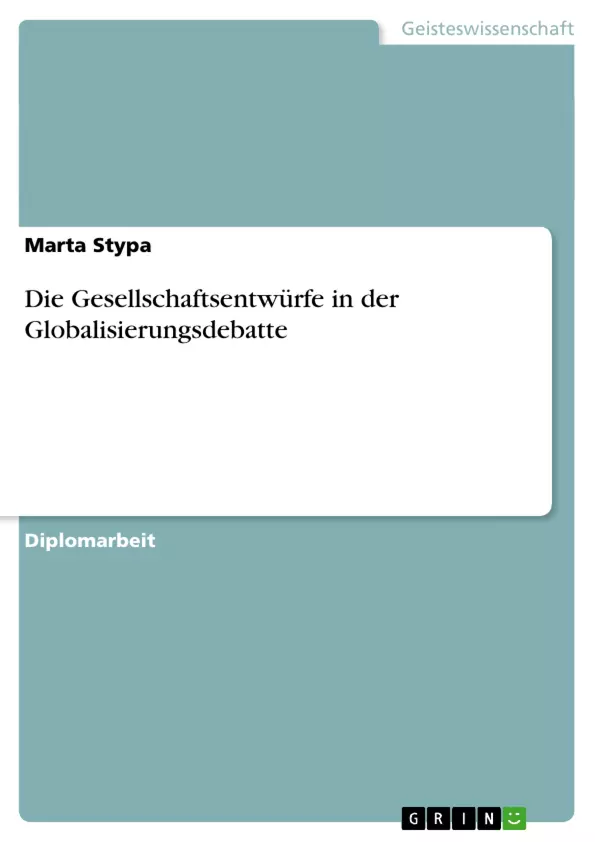War das Wort „Globalisierung“ in den sechziger Jahren noch in keinem Lexikon zu finden (vgl. Winter 20001), so hat es mittlerweile einen Schlagwortstatus in der öffentlichen Diskussion erreicht und wird zur Beschreibung unterschiedlichster Phänomene in den sozial-, politik-, und wirtschaftswissenschaftlichen Debatten verwendet: „Es gibt wohl kaum einen diskursiven Kontext, in dem das Wort nicht schon in irgendeiner Weise gefallen wäre und debattiert wurde. Alles ist global geworden, von der Weltwirtschaft, den Menschenrechten, den Umweltproblemen bis zum Tourismus oder unserem Lebensstil. Globalisierung ist irgendwie immer mit im Spiel.“ (Dürrschmidt 2002:5). Globalisierung ist daher, wie von vielen Beobachtern festgestellt wird, zu einem „Modewort mit vagem Inhalt“ (Rothschild 2000:25) avanciert.
Spätestens jedoch seit den Protesten gegen die Welthandelsorganisation [WTO] in Seattle [1999] wird in der öffentlichen Debatte sowie in Kreisen vieler Wirtschafts- und Politikwissenschaftler unter „Globalisierung“, zumeist ein ökonomischer sowie politischer Prozess verstanden, welcher je nach Deutung und Interesse entweder als Chance oder als Bedrohung gesehen wird:
So folge, nach Meinung der Kritiker, die von WTO, Weltbank und internationalem Währungsfond vertretene Politik einer neoliberalen, ökonomischen Ideologie. Diese Politik eröffne mit der Deregulierung und Privatisierung nationalstaatlicher Märkte den wachsenden transnationalen Unternehmen und dem Finanzkapital neue Strategien für die Kapitalakkumulation, sie sei jedoch blind gegenüber globalen Ungleichheiten und der Degradierung der Umwelt, ja verschärfe diese gar. Wolle man den destruktiven Kräften des „Kasino-Kapitalismus“ Einhalt gewähren so erfordere dies einschneidende Reformen. Anders sehen die so genannten Befürworter, wie zum Beispiel Jagdish Bhagwati, Ökonom und berühmter Kritiker der Globalisierungsgegner, die ökonomische Globalisierung und die Deregulierungs- und Privatisierungsprozessen als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems und in der internationalen Arbeitsteilung den Schlüssel zur Steigerung der Wohlfahrt: „globalizational ready has profound ethical dimensions“ (Bhagwati 2003:221). So sieht Bhagwati die Notwendigkeit Unternehmen gegen ignorante, ideologische und strategische Angriffe zu schützen, da sie generell Gutes und kein Schaden anrichten würden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Teil: Die Globalisierung aus ökonomischer Perspektive
- 1.1 Ursachen wirtschaftlicher Globalisierung - Die Herausbildung globaler Märkte
- 1.1.1 Weltwirtschaftliche Entwicklungen nach 1945
- 1.1.2 Das Ende von Bretton Woods
- 1.1.3 Das „neoliberale Projekt“
- 1.1.4 Neue Technologien
- 1.1.5 Das Ende des Ost-West-Konflikts
- 1.1.6 Ungleiche Integration
- 1.2 Die neue Dimension globaler Märkte
- 1.2.1 Globale Produktion und Investitionsströme
- 1.2.2 Globaler Handel
- 1.2.3 Globale Finanzmärkte
- 1.3 Das Primat globaler Märkte - Die Folgen
- 1.3.1 Die Instabilität des globalen Geldmarktes und die Finanzkrisen
- 1.3.2 Veränderte Rolle der Nationalstaaten
- 1.3.3 Kleiner Exkurs zu internationalen Beziehungen
- 1.3.4 „Gewinner“ und „Verlierer“ der Globalisierung
- 1.3.5 Zusammenfassung
- 2. Teil: Die ideologische Globalisierungsdebatte - Gesellschaftsentwürfe
- 2.1 Divergierende Verständnisse wirtschaftlicher Globalisierung
- 2.1.1 Die globalisierungskritische Bewegung
- 2.1.2 Globalisierung: Chance oder Katastrophe ?
- 2.2 Die Kritiker der Globalisierung
- 2.2.1 Kritik an der neoliberalen Ideologie
- 2.3 Perspektiven auf die wirtschaftliche Globalisierung
- 2.3.1 Wirtschaftliche Globalisierung als „Raubtierkapitalismus“
- 2.3.2 Wirtschaftliche Globalisierung als geopolitisches Instrument
- 2.3.3 Wirtschaftliche Globalisierung - Sozialdemokratische Perspektive
- 2.4 Die Antwort der Befürworter
- 2.4.1 Wirtschaftliche Globalisierung - liberale Perspektive
- 2.5. Einschätzung der Perspektiven
- 2.6. Die Gesellschaftsentwürfe
- 2.6.1 Die „Marktskeptiker“
- 2.6.2 Was der Markt kann…
- 2.6.3 und was der Markt nicht kann
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Die Gesellschaftsentwürfe in der Globalisierungsdebatte“ befasst sich mit den verschiedenen Perspektiven auf die wirtschaftliche Globalisierung und ihren Einfluss auf die Gestaltung von Gesellschaften. Die Arbeit analysiert die ökonomischen Ursachen der Globalisierung sowie die damit verbundenen Folgen für die Weltwirtschaft und die Rolle der Nationalstaaten.
- Die Entstehung globaler Märkte und ihre Ursachen
- Die Folgen der Globalisierung für die Weltwirtschaft, die Rolle der Nationalstaaten und das Entstehen von „Gewinnern“ und „Verlierern“
- Die divergierenden Perspektiven von Kritikern und Befürwortern der Globalisierung
- Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung und die daraus resultierenden Gesellschaftsentwürfe
- Die Rolle der neoliberalen Ideologie in der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas „Globalisierung“ in der heutigen Zeit herausstellt und die verschiedenen Perspektiven auf den Begriff einführt. Anschließend widmet sich der erste Teil der Arbeit der ökonomischen Perspektive auf die Globalisierung. Hier werden die Ursachen für die Herausbildung globaler Märkte anhand der weltwirtschaftlichen Entwicklungen seit 1945 betrachtet. Dabei werden das Ende des Bretton-Woods-Systems, das „neoliberale Projekt“, neue Technologien, das Ende des Ost-West-Konflikts und die ungleiche Integration in die Weltwirtschaft analysiert.
Im weiteren Verlauf des ersten Teils werden die neuen Dimensionen globaler Märkte in den Bereichen Produktion, Investitionsströme, Handel und Finanzmärkte beleuchtet. Schließlich werden die Folgen des Primats globaler Märkte, insbesondere die Instabilität des globalen Geldmarktes und die Finanzkrisen, die veränderte Rolle der Nationalstaaten und das Problem der „Gewinner“ und „Verlierer“ der Globalisierung, analysiert.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der ideologischen Globalisierungsdebatte und den daraus resultierenden Gesellschaftsentwürfen. Hier werden die divergierenden Verständnisse von Kritikern und Befürwortern der Globalisierung in Bezug auf deren Chancen und Risiken vorgestellt. Die Kritik an der neoliberalen Ideologie und die daraus resultierenden Perspektiven, wie die „machtorientierte“ Perspektive oder die „liberal-sozialdemokratische“ Perspektive, werden detailliert dargestellt.
Des Weiteren werden die Perspektiven der Befürworter der Globalisierung, insbesondere die „liberale Perspektive“, vorgestellt und die jeweiligen Argumente beider Seiten gegenübergestellt. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der diskutierten Perspektiven und einer Analyse der daraus resultierenden Gesellschaftsentwürfe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der Globalisierung, den Ursachen und Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung, der neoliberalen Ideologie, den Perspektiven von Kritikern und Befürwortern der Globalisierung, den gesellschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung, den Gesellschaftsentwürfen, der Rolle des Staates, den internationalen Beziehungen und den globalen Finanzmärkten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen der wirtschaftlichen Globalisierung?
Wichtige Ursachen sind das Ende des Bretton-Woods-Systems, technologische Innovationen, das „neoliberale Projekt“ (Deregulierung) und das Ende des Ost-West-Konflikts.
Warum wird die Globalisierung oft mit Neoliberalismus gleichgesetzt?
Weil Institutionen wie die WTO und der IWF eine Politik der Privatisierung und Marktöffnung verfolgen, die auf neoliberalen Ideologien zur Maximierung der Kapitalakkumulation basiert.
Wer sind die „Gewinner“ und „Verlierer“ der Globalisierung?
Gewinner sind oft transnationale Unternehmen und hochqualifizierte Arbeitskräfte, während Verlierer häufig Nationalstaaten mit geringer Verhandlungsmacht und Geringqualifizierte sind.
Was ist die „liberale Perspektive“ auf die Globalisierung?
Befürworter wie Jagdish Bhagwati sehen in der internationalen Arbeitsteilung und freien Märkten den Schlüssel zur weltweiten Wohlstandssteigerung und ethischen Entwicklung.
Was versteht man unter „Kasino-Kapitalismus“?
Es beschreibt die Instabilität der globalen Finanzmärkte, auf denen spekulative Investitionen wichtiger geworden sind als die reale Produktion von Gütern.
- Quote paper
- Marta Stypa (Author), 2005, Die Gesellschaftsentwürfe in der Globalisierungsdebatte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45247