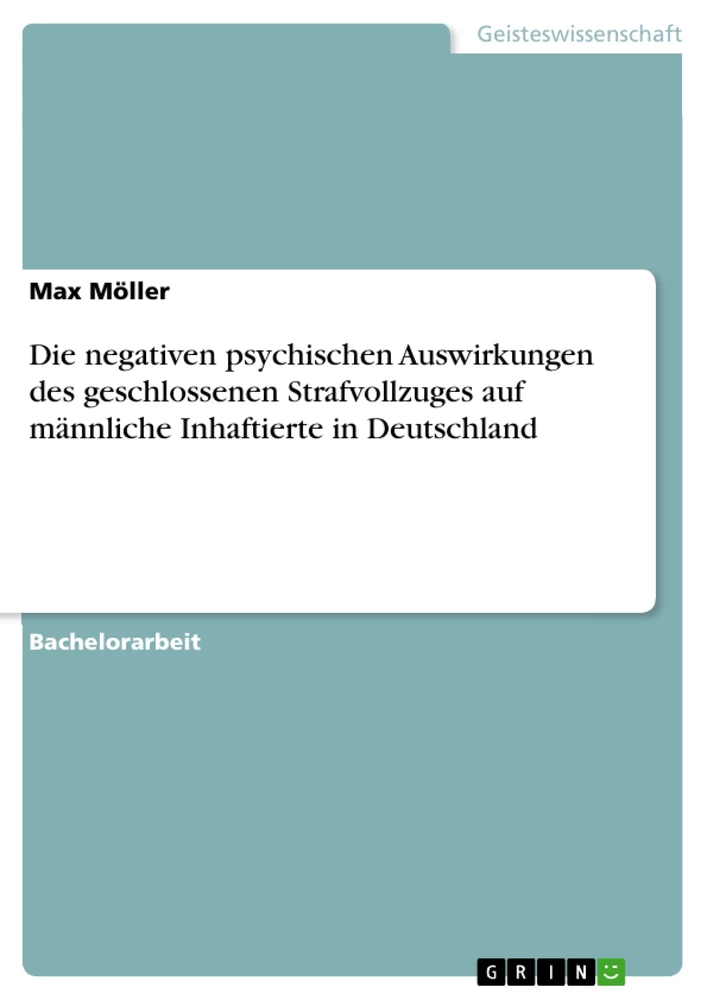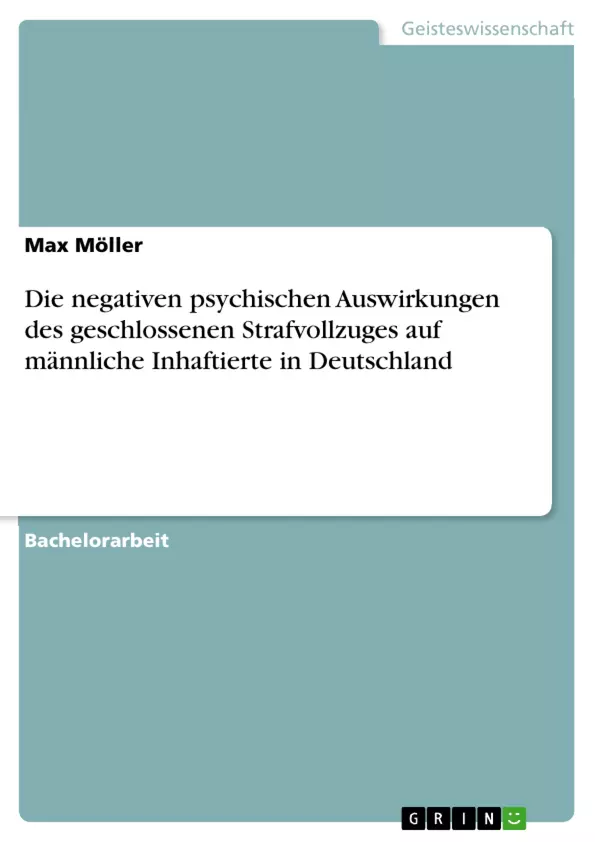Wie kommt es zu den negativen Auswirkungen in deutschen Gefängnissen? Welche Auswirkungen lassen sich konkret feststellen? Gibt es auch Maßnahmen, den Gefangenen den Weg zur Resozialisierung zu erleichtern und ihn dadurch vor weiteren Straftaten präventiv zu bewahren?
Zur Einführung und dem Erlangen gewisser Vorkenntnisse werde ich zu Beginn erläutern, wie sich der Strafvollzug bis zu seiner heutigen Form entwickelt hat. Daher beginnt die wissenschaftliche Arbeit mit der Geschichte des Gefängnisses. Es soll zunächst dargestellt werden, wie die heutige Form der Inhaftierung zustande gekommen ist. Dabei wird ein fließender Übergang zu den geltenden gesetzlichen Regelungen, das Strafvollzugsgesetz, vorgenommen. Anschließend wird auf die Begrifflichkeit des Strafvollzuges eingegangen, da sie Inhalt des Arbeitstitels darstellt, für den weiteren Verlauf relevant ist und das Ergebnis dieser Entwicklung verkörpert. Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem geschlossenen Strafvollzug. Es soll verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen und Gegebenheiten der eigentliche Untersuchungsgegenstand der Psyche analysiert wird.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Schrift liegt auf den Kapiteln 4. und 5. Begonnen wird hierbei mit „Der Vollzugsablauf und dessen psychische Folgen“. Aus diesem Kapitel soll hervorgehen, wie das Verbüßen der Freiheitsstrafe chronologisch aufgebaut ist. Die verschiedenen Haftphasen können bei den Betroffenen unterschiedliche psychische Auswirkungen verursachen. Diese sollen anhand von ausgewählten Beispielen untersucht und erklärt werden. Darauf folgt in Kapitel 5. „Die Prävalenz psychisch Erkrankter im geschlossenen Strafvollzug“. Es gilt darin festzustellen, ob im Gefängnis tatsächlich vermehrt psychische Störungen zu beobachten sind. Darauf folgt eine Erklärung, was man unter psychischen Störungen versteht. Inhaltlich unterschieden werden in diesem Kapitel solche, die vor der Inhaftierung vorhanden waren und solche, die während der Inhaftierung entstehen können.
Zum Schluss ziehe ich unter Berücksichtigung meiner erlangten Erkenntnisse ein Fazit sowie einen Ausblick. Dafür ist es unentbehrlich, eine Gegenüberstellung der negativen psychischen Auswirkungen des Strafvollzuges mit dessen Notwendigkeit und Zielen vorzunehmen.
Aufgrund meiner persönlichen Begegnung und der Expertenmeinung lege ich den Fokus dieser Arbeit auf die negativen psychischen Folgen des geschlossenen Strafvollzuges in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des heutigen Strafvollzuges
- Die Geschichte des Gefängnisses
- Die Entwicklung vom Kerker zum Zuchthaus
- Die ersten Reformen
- Der totale Vollzug
- Der neue Vollzug
- Das Strafvollzugsrecht
- Die Begrifflichkeit ,,Strafvollzug"
- Der geschlossene Strafvollzug
- Zahlen in Deutschland
- Justizvollzugsanstalten
- Das Gefängnis als totale Institution
- Der Vollzugsablauf und dessen psychischen Folgen
- Strafantritt
- Stress
- Stigmatisierung
- Das Aufnahmeverfahrenn- Entpersonalisierungsprozess
- Das Leben im geschlossenen Strafvollzug
- Isolation
- Subkulturen, Prisonisierung und Sozialstrukturen
- Die Entlassung
- Stigmatisierung
- Soziale Isolation
- Prisonisierung
- Resozialisierung
- Rückfall
- Die Prävalenz psychisch Erkrankter im geschlossenen Strafvollzug
- Psychische Störungen und Beeinträchtigungen
- Mögliche Störungen der Inhaftierten- vor Antritt der Strafe
- Schizophrenie
- Abhängigkeitserkrankungen
- Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Mögliche Störungen der Inhaftierten-Genese in Haft
- Unipolare Depressionen
- Anpassungsstörungen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den negativen psychischen Auswirkungen des geschlossenen Strafvollzugs auf männliche Inhaftierte in Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung des Strafvollzuges und beleuchtet die spezifischen Bedingungen und Folgen des geschlossenen Vollzugs. Die Arbeit soll die besonderen Herausforderungen und Belastungen für die Betroffenen aufzeigen und die Prävalenz psychischer Erkrankungen im geschlossenen Strafvollzug beleuchten.
- Die Entwicklung des Strafvollzuges und dessen Bedeutung für die heutige Situation
- Die psychischen Folgen des geschlossenen Strafvollzugs auf Inhaftierte
- Das Leben in der "totalen Institution" und die Folgen der Isolation und Entpersonalisierung
- Die Prävalenz psychischer Erkrankungen im geschlossenen Strafvollzug
- Die Relevanz der Resozialisierung und die Herausforderungen bei der Entlassung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der negativen psychischen Auswirkungen des geschlossenen Strafvollzugs auf männliche Inhaftierte ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung des Strafvollzuges in Deutschland und stellt die verschiedenen Vollzugsformen und deren Bedeutung für die heutige Situation dar. Kapitel 3 konzentriert sich auf den geschlossenen Strafvollzug und seine Besonderheiten. Es beleuchtet die Zahlen in Deutschland, die verschiedenen Justizvollzugsanstalten und das Gefängnis als "totale Institution". Kapitel 4 befasst sich mit den psychischen Folgen des Vollzugsablaufs, vom Strafantritt über die Aufnahme bis hin zur Entlassung. Es analysiert die Rolle von Stress, Stigmatisierung und Isolation im geschlossenen Vollzug und beleuchtet die Entstehung von Subkulturen und Prisonisierung. Kapitel 5 untersucht die Prävalenz psychischer Erkrankungen im geschlossenen Strafvollzug und analysiert verschiedene Störungsbilder, die vor Antritt der Strafe und während der Haft auftreten können.
Schlüsselwörter
Geschlossener Strafvollzug, psychische Auswirkungen, männliche Inhaftierte, Gefängnis, totale Institution, Isolation, Entpersonalisierung, Stigmatisierung, Prisonisierung, Resozialisierung, Rückfall, psychische Störungen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depressionen, Anpassungsstörungen.
- Arbeit zitieren
- Max Möller (Autor:in), 2018, Die negativen psychischen Auswirkungen des geschlossenen Strafvollzuges auf männliche Inhaftierte in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452494