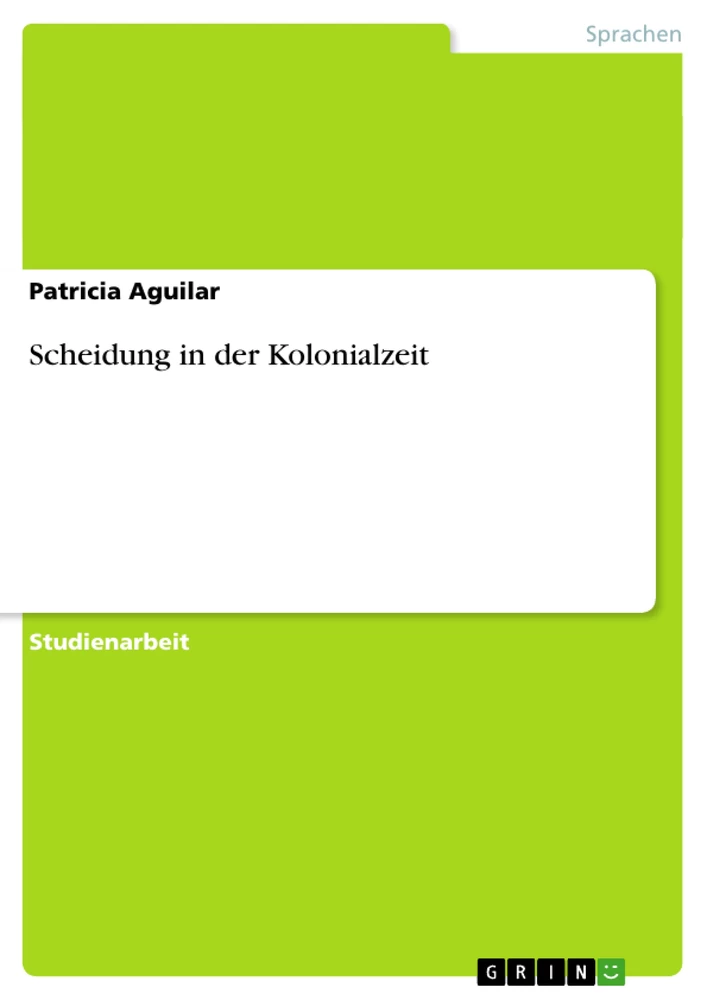Mit der Eroberung Lateinamerikas, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts abgeschlossen war, nahm das portugiesische Recht in Brasilien und das spanische Recht in den übrigen Gebieten eine Vorrangstellung ein. Im Hinblick auf die Ehegesetzgebung spielte insbesondere die katholische Kirche eine erhebliche Rolle. Die Ehe galt als die grundlegende Institution innerhalb der politischen und der gesellschaftlichen Ordnung.
Die Geschichtsschreibung beschäftigt sich zunehmend mit Familien- und Geschlechtergeschichte und lässt die Konfliktfälle innerhalb der Ehe und der Familie nicht außer Acht, die sich in den reichen Scheidungsakten aus der Kolonialzeit wiederspiegeln.
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Scheidung in der Kolonialzeit in Hispanoamerika, jedoch zieht sich die Untersuchung bis ins 19. Jahrhundert hinein, da zwischen der Kolonialzeit und der Epoche der Nationalstaaten (fast) fließende Übergänge existierten. Geografisch behandelt diese Arbeit hauptsächlich die Länder Mexiko, Peru und Costa Rica.
Ein Schwerpunkt dieser Arbeit bilden nicht nur die Scheidungsprozesse und -klagen, sondern auch die Aufdeckung der Hintergründe von Scheidungen, die wir nur mit Hilfe der Gegenüberstellung von Theorie und Praxis der Scheidung sichtbar machen können. Auch sollen die Schwierigkeiten, die der Begriff des divorcio mit sich bringt, aufgeklärt werden. Im Mittelpunkt stehen ebenso die Ehescheidungs- und Ehetrennungsgründe, sowie die Folgen einer Ehescheidung für das Ehepaar und die Mitglieder der Familie.
Das Thema der Scheidung lässt einen Einblick in die Mentalitätsgeschichte der hispanoamerikanischen Gesellschaften jener Zeit zu. Daher ist es wichtig, sich mit der Perzeption der Öffentlichkeit über die Ehescheidung auseinander zu setzen, um die Moral des sozialen Umfeldes zu verstehen. Scheidung wird in dieser Arbeit also nicht nur geschlechtsspezifisch sondern auch gesellschaftsspezifisch betrachtet.
Zum Schluss soll die Frage beantwortet werden, ob das Mittel der Scheidung eher ein Instrument der Ehefrauen oder aber der Ehemänner repräsentierte, und welche Rolle die Scheidung innerhalb einer patriarchalen Ordnung spielte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs divorcio
- Der divorcio eclesiástico und der divorcio civil
- Das Prozessverfahren
- Der depósito
- Die Folgen einer Scheidung
- Ehescheidungs- und Ehetrennungsgründe
- Die Annullierung der Ehe
- Ursachen für Ehescheidungen bzw. Ehetrennungen
- Statistische Untersuchung und Fallanalyse
- Scheidung im gesellschaftlichen Kontext
- Schichtspezifische Scheidung und Trennung
- Die praxis judicial und das Stigma der Scheidung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Scheidung in der Kolonialzeit in Hispanoamerika und verfolgt dabei die Entwicklung bis ins 19. Jahrhundert, da zwischen diesen Epochen fließende Übergänge existierten. Der Fokus liegt dabei auf den Ländern Mexiko, Peru und Costa Rica. Die Arbeit beleuchtet nicht nur die Scheidungsprozesse und -klagen, sondern auch die Hintergründe dieser Konflikte sowie die Schwierigkeiten, die der Begriff divorcio mit sich bringt. Im Mittelpunkt stehen außerdem die Ehescheidungs- und Ehetrennungsgründe sowie deren Folgen für das Ehepaar und die Familie. Die Arbeit betrachtet Scheidung sowohl geschlechtsspezifisch als auch gesellschaftsspezifisch und analysiert die Rolle der Scheidung in der patriarchalen Ordnung.
- Die rechtliche und soziale Bedeutung der Scheidung in der Kolonialzeit
- Die Unterschiede zwischen divorcio eclesiástico und divorcio civil
- Die Gründe für Ehescheidungen und Ehetrennungen
- Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Scheidung
- Die Rolle der Scheidung in der patriarchalen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Scheidung in der Kolonialzeit ein und beleuchtet die historischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs divorcio und unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Ehetrennung. Kapitel 3 analysiert die rechtlichen Prozesse der Scheidung, das Prozessverfahren, die Rolle des depósito und die Folgen für die Ehepartner. Kapitel 4 untersucht die Gründe für Ehescheidungen und Ehetrennungen, darunter die Annullierung der Ehe, die Ursachen für Trennungen und statistische Daten aus Lima. Schließlich widmet sich Kapitel 5 der Scheidung im gesellschaftlichen Kontext, betrachtet schichtspezifische Unterschiede und das Stigma der Scheidung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Scheidung in der Kolonialzeit in Hispanoamerika und konzentriert sich auf die rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte dieser Institution. Wichtige Schlüsselwörter sind: divorcio, divorcio eclesiástico, divorcio civil, Ehescheidung, Ehetrennung, Annullierung, Ehebruch, gesellschaftlicher Wandel, patriarchalische Ordnung, geschlechtsspezifische Unterschiede.
- Citar trabajo
- Patricia Aguilar (Autor), 2005, Scheidung in der Kolonialzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45251