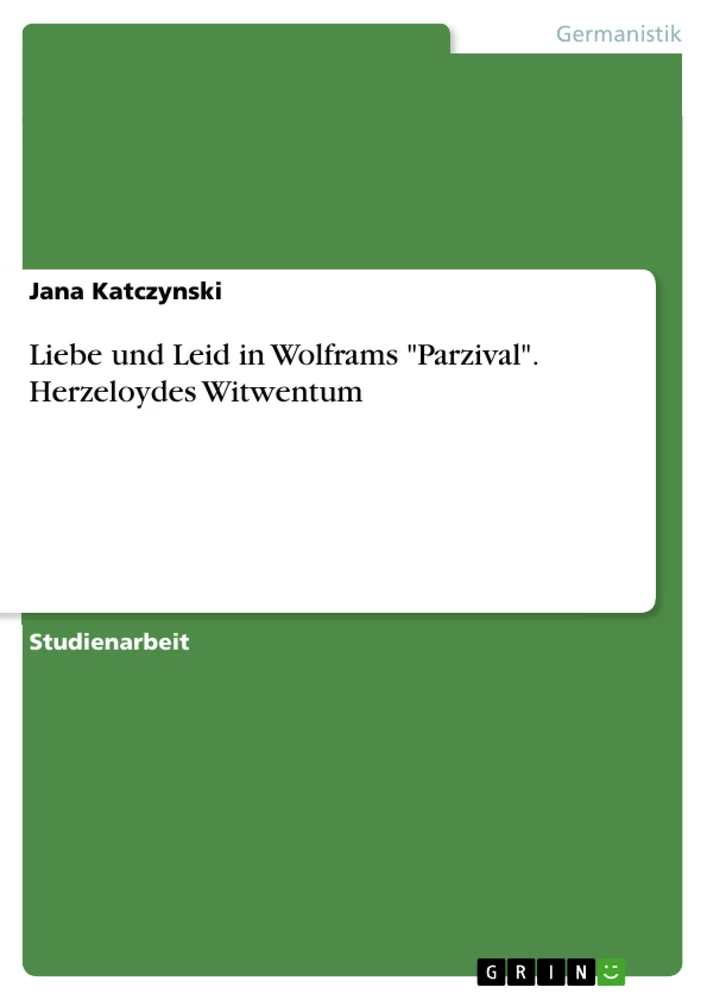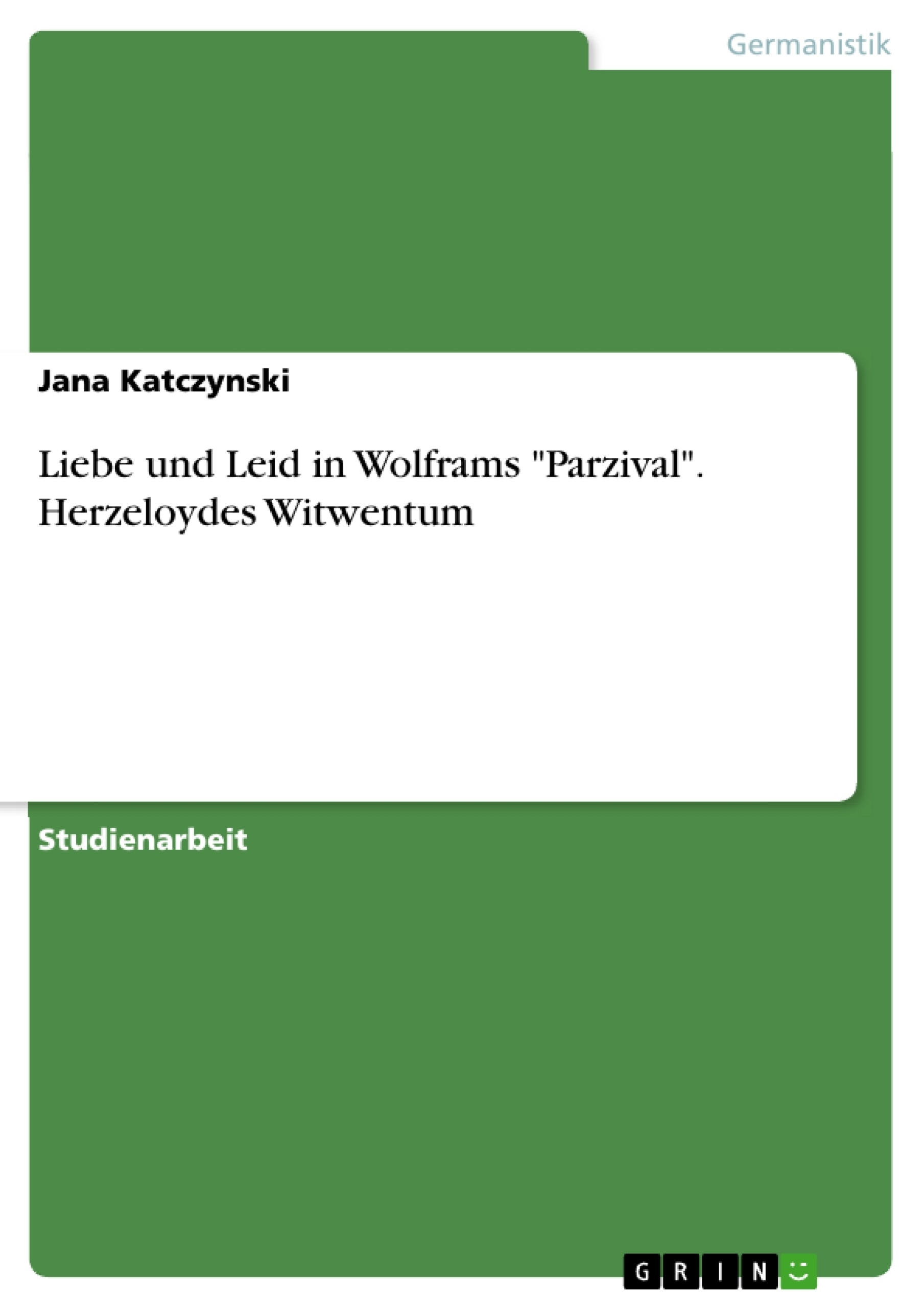Bei Wolframs "Parzival" handelt es sich um einen Mehrgenerationenroman, wobei die Elterngeschichte, insbesondere der Gahmuret-Teil, zunächst im Fokus steht. Dabei ist es zu einseitig gedacht, die Handlungen dieser Figuren bloß anhand deren Bedeutung für den Protagonisten zu betrachten. So ist Herzeloyde nicht allein Parzivals Mutter, welche ihn mit dem Gralsgeschlecht verbindet, sondern nimmt vielfältige Rollen mit teils verschiedensten Eigenschaften ein. Im Fokus dieser Arbeit steht dabei ihre Rolle als zweifache Witwe. Insbesondere der Verlust ihres zweiten Ehemannes Gahmuret prägt ihr Dasein und somit ihr Handeln im Roman. Dabei soll keine Bewertung dieser Handlungen vorgenommen werden, wie es häufig in der Forschungsliteratur geschieht. Es gilt vielmehr herauszustellen, was ihre Witwenschaft ausmacht bzw. wie Herzeloyde als Witwe dargestellt und funktionalisiert wird.
Hierfür wird zunächst auf den historischen Hintergrund, die Entstehung des Witwenstandes im Mittelalter und dessen Merkmale, eingegangen, bevor dieser in Bezug zu Liebe und Leid, Trauer und Tod in der höfischen Erzählliteratur gesetzt wird. Dabei soll insbesondere auf die verschiedenen Witwenfiguren im „Parzival“ eingegangen werden. In der anschließenden Analyse wird sich in diesem Zusammenhang explizit mit der Herzeloyde-Figur beschäftigt. Zunächst gilt es, die Besonderheit der Beziehung Herzeloydes zu Gahmuret herauszustellen. Hierbei wird auf den Einfluss ihrer ersten Witwenschaft, den Entstehungsprozess der Ehe als auch auf das Eheleben selbst eingegangen. Das darauf folgende Kapitel steht unter dem Aspekt des Rollenwechsels der Figur, von der höfischen Ehefrau zur verwitweten Mutter. Hier stehen der prophetische Traum Herzeloydes, ihr Ohnmachtserlebnis als auch die Umfunktionierung der Witwenklage im Fokus der Überlegungen. Im letzten Analysekapitel werden die Folgen von Herzeloydes erneuter Witwenschaft herausgestellt, wobei auf ihren Auszug nach Soltane, die Erziehung Parzivals sowie ihren Tot aus Mutterliebe eingegangen wird. Abschließend werden die Ergebnisse nochmals zusammenfassend dargestellt als auch mit der Lebensrealität im Mittelalter sowie mit der Darstellung der Witwe in der höfischen Literatur und in Wolframs Werk in Bezug gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Entstehung des Witwenstandes
- Witwentum im „Parzival“
- Analyse
- Herzeloydes Beziehung zu Gahmuret
- Rollenwechsel der Herzeloyde-Figur
- Die Mutter-Sohn-Beziehung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Herzeloyde-Figur in Wolframs „Parzival“ als zweifache Witwe und beleuchtet den Einfluss ihrer Witwenschaft auf ihr Handeln und ihre Darstellung im Roman. Die Arbeit vermeidet eine Bewertung ihrer Handlungen und konzentriert sich stattdessen auf die Darstellung ihrer Witwenschaft und die Funktionsweise ihrer Rolle im Werk.
- Die historische Entwicklung des Witwenstandes im Mittelalter und dessen Merkmale
- Witwenfiguren in der höfischen Literatur und deren Darstellung von Liebe, Leid, Trauer und Tod
- Die besondere Beziehung zwischen Herzeloyde und Gahmuret, einschließlich ihrer ersten Witwenschaft, der Entstehung und Durchführung ihrer Ehe
- Der Rollenwechsel der Herzeloyde-Figur von der höfischen Ehefrau zur verwitweten Mutter, einschließlich ihrer prophetischen Träume, ihres Ohnmachtserlebnisses und der Umfunktionierung der Witwenklage
- Die Folgen von Herzeloydes erneuter Witwenschaft, einschließlich ihres Auszugs nach Soltane, der Erziehung Parzivals und ihres Todes aus Mutterliebe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und präsentiert den Forschungskontext sowie die Forschungsfrage. Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entstehung des Witwenstandes im Mittelalter und seine Bedeutung in der damaligen Gesellschaft. Es werden die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Witwe“ in unterschiedlichen Epochen betrachtet und die Entwicklung des Witwenstandes im Kontext der mittelalterlichen Theologie und Moral beschrieben. Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung von Witwenfiguren in der höfischen Erzählliteratur, wobei der Fokus auf Liebe, Leid, Trauer und Tod liegt. Dieses Kapitel bildet den Kontext für die Analyse der Herzeloyde-Figur im „Parzival“. Die Analyse der Herzeloyde-Figur gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt untersucht die Beziehung zwischen Herzeloyde und Gahmuret, wobei auf die Besonderheiten dieser Beziehung sowie auf die Rolle der ersten Witwenschaft, die Entstehung der Ehe und das Eheleben eingegangen wird. Der zweite Abschnitt betrachtet den Rollenwechsel der Herzeloyde-Figur von der höfischen Ehefrau zur verwitweten Mutter und analysiert ihre prophetischen Träume, ihr Ohnmachtserlebnis und die Umfunktionierung der Witwenklage im „Parzival“. Der dritte Abschnitt widmet sich den Folgen von Herzeloydes erneuter Witwenschaft, darunter ihr Auszug nach Soltane, die Erziehung Parzivals und ihr Tod aus Mutterliebe. Der Schluss fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt diese in Bezug zur Lebensrealität im Mittelalter und zur Darstellung der Witwe in der höfischen Literatur sowie in Wolframs Werk.
Schlüsselwörter
Witwentum, Herzeloyde, Gahmuret, Parzival, Wolfram von Eschenbach, höfische Literatur, mittelalterliche Gesellschaft, Ehe, Trauer, Liebe, Tod, Mutterrolle, Rollenwechsel.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Herzeloyde in Wolframs „Parzival“?
Sie ist die Mutter des Protagonisten Parzival und wird im Roman vor allem in ihrer Rolle als zweifache Witwe und deren Einfluss auf ihr Handeln dargestellt.
Was charakterisiert den Witwenstand im Mittelalter?
Witwen hatten eine rechtliche Sonderstellung; ihr Stand war geprägt von Trauer, aber auch von neuen Pflichten und oft dem Rückzug aus der höfischen Gesellschaft.
Warum zieht Herzeloyde nach Soltane?
Nach dem Tod ihres Mannes Gahmuret will sie Parzival vor dem Rittertum schützen, um ihn nicht auch durch den Tod im Kampf zu verlieren.
Wie wird Herzeloydes Beziehung zu Gahmuret beschrieben?
Die Beziehung ist von tiefer Liebe und Leid geprägt; ihr prophetischer Traum kündigt bereits den schmerzhaften Verlust des geliebten Ehemannes an.
Was bedeutet ihr „Tod aus Mutterliebe“?
Als Parzival sie verlässt, um Ritter zu werden, stirbt Herzeloyde vor Herzeleid, was ihre totale Aufopferung für den Sohn unterstreicht.
- Quote paper
- B.A. Jana Katczynski (Author), 2017, Liebe und Leid in Wolframs "Parzival". Herzeloydes Witwentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452630