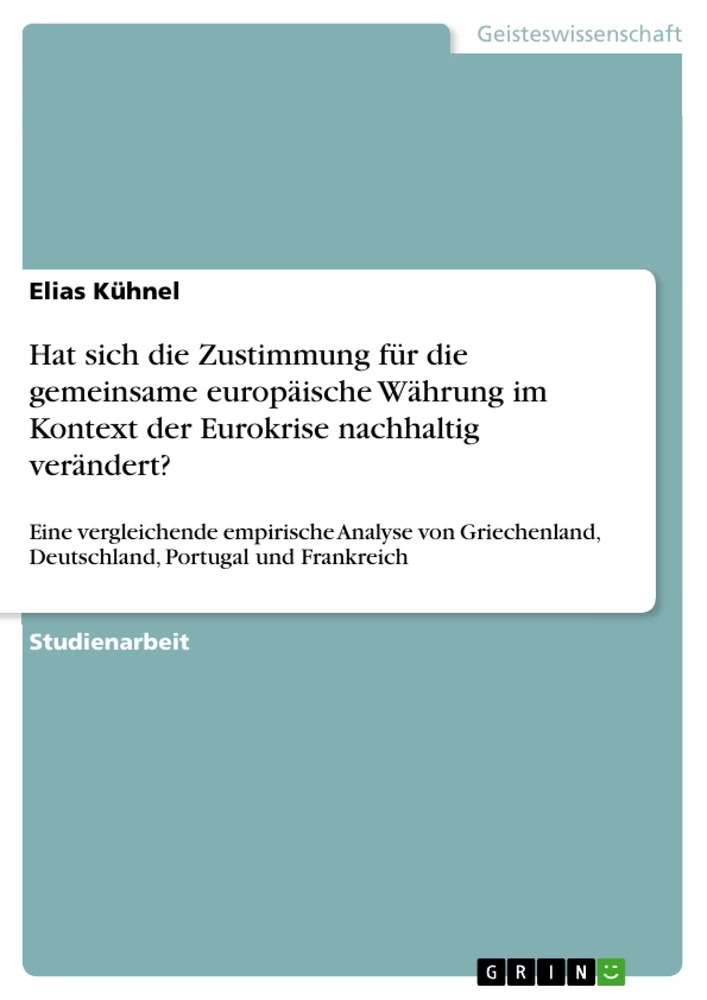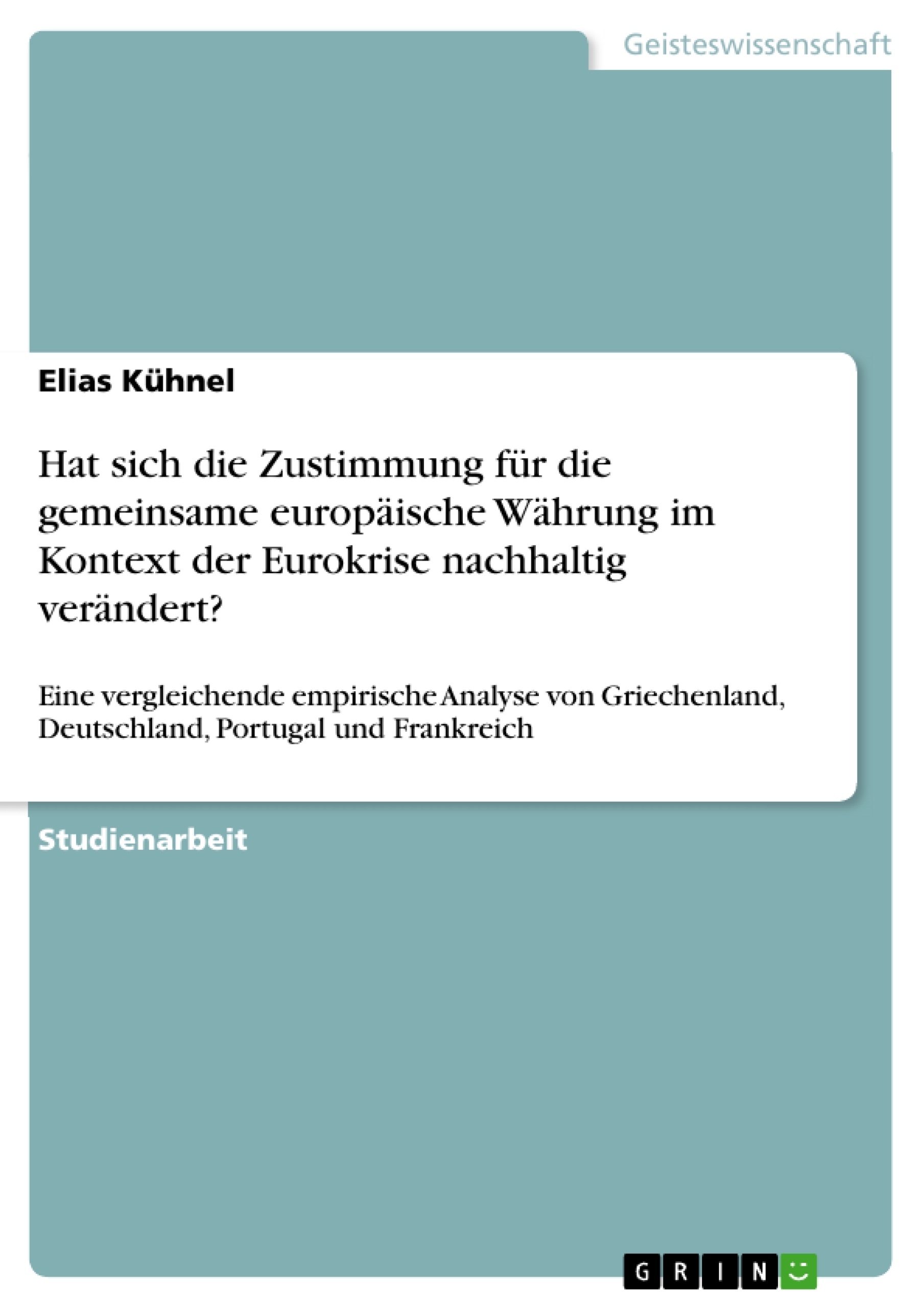In dieser Arbeit soll empirisch untersucht werden, inwieweit sich die Zustimmung für den Euro im Kontext der Eurokrise verändert hat. Ziel ist eine vergleichende Analyse zwischen den Hauptkrisenstaaten, die in dieser Untersuchung durch die zwei Staaten Griechenland und Portugal repräsentiert werden und den weniger von der Krise betroffenen Staaten Deutschland
und Frankreich.
Dabei sollen drei Zeitpunkte in einem Intervall von insgesamt zehn Jahren untersucht werden, nämlich das Jahr 2007, also noch vor Beginn der Eurokrise, das Jahr 2012, als die Krise ihren Höhepunkt erreicht hat sowie das Jahr 2017. Als Datenbasis fungiert der Eurobarometer aus eben diesen Jahren, mithilfe dessen logistische Regressionen durchgeführt werden sollen, die die zeitlichen Entwicklungen der Chancenverhältnisse für eine Zustimmung des Euros in den einzelnen Staaten aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Krisenbegriff
- Die Entwicklung der Eurokrise
- Hypothesen
- Operationalisierung und Methodologie
- Ergebnisse
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht empirisch, ob sich die Zustimmung zum Euro im Kontext der Eurokrise verändert hat. Der Fokus liegt auf einem Vergleich zwischen Hauptkrisenstaaten (Griechenland und Portugal) und weniger betroffenen Ländern (Deutschland und Frankreich). Die Analyse betrachtet drei Zeitpunkte: 2007 (vor der Krise), 2012 (Höhepunkt der Krise) und 2017. Der Eurobarometer dient als Datenbasis für logistische Regressionen, die die zeitliche Entwicklung der Zustimmung zum Euro in den einzelnen Ländern aufzeigen.
- Die Auswirkungen der Eurokrise auf die Zustimmung zum Euro
- Vergleichende Analyse der Zustimmungsraten in verschiedenen europäischen Ländern
- Untersuchung der zeitlichen Entwicklung der Zustimmungsraten
- Analyse der Chancenverhältnisse für eine Zustimmung zum Euro
- Identifizierung von Mustern und Trends in der Zustimmungsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Eurokrise und deren Einfluss auf die Zustimmung zum Euro ein. Sie stellt die Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit dar.
- Das Kapitel über den Krisenbegriff definiert den Begriff "Krise" im Kontext der Eurokrise und beleuchtet die verschiedenen Dimensionen des Krisenbegriffs.
- Das Kapitel über die Entwicklung der Eurokrise beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Eurokrise, einschließlich der wichtigsten Ereignisse und Phasen.
- Das Kapitel über die Hypothesen formuliert die zentralen Annahmen der Arbeit über die Auswirkungen der Eurokrise auf die Zustimmung zum Euro in den untersuchten Ländern.
- Das Kapitel über Operationalisierung und Methodologie erläutert die Forschungsmethodik und die verwendeten Daten, insbesondere den Eurobarometer und die logistische Regression.
Schlüsselwörter
Eurokrise, Eurobarometer, Zustimmung, logistische Regression, Vergleichende Analyse, Griechenland, Portugal, Deutschland, Frankreich, Zeitliche Entwicklung, Chancenverhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Zustimmung zum Euro während der Eurokrise verändert?
Die Arbeit untersucht empirisch die Veränderung der Zustimmung in den Jahren 2007, 2012 und 2017, wobei insbesondere die Unterschiede zwischen Krisenstaaten und weniger betroffenen Ländern analysiert werden.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Der Vergleich erfolgt zwischen den Hauptkrisenstaaten Griechenland und Portugal sowie den wirtschaftlich stabileren Ländern Deutschland und Frankreich.
Welche Datenbasis wird für die Analyse verwendet?
Als primäre Datenquelle dient der Eurobarometer aus den Untersuchungsjahren 2007, 2012 und 2017.
Welche statistische Methode kommt zum Einsatz?
Die zeitliche Entwicklung der Chancenverhältnisse für eine Zustimmung zum Euro wird mithilfe von logistischen Regressionen berechnet.
Was ist das Ziel der vergleichenden Analyse?
Ziel ist es, Muster und Trends in der Zustimmungsentwicklung zu identifizieren und aufzuzeigen, ob die Eurokrise einen nachhaltigen Einfluss auf die Akzeptanz der Währung hatte.
Was wird unter dem Begriff "Krisenstaaten" in dieser Arbeit verstanden?
In dieser Untersuchung werden Griechenland und Portugal als Repräsentanten für die Hauptkrisenstaaten der Eurozone herangezogen.
- Citation du texte
- Elias Kühnel (Auteur), 2018, Hat sich die Zustimmung für die gemeinsame europäische Währung im Kontext der Eurokrise nachhaltig verändert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452638