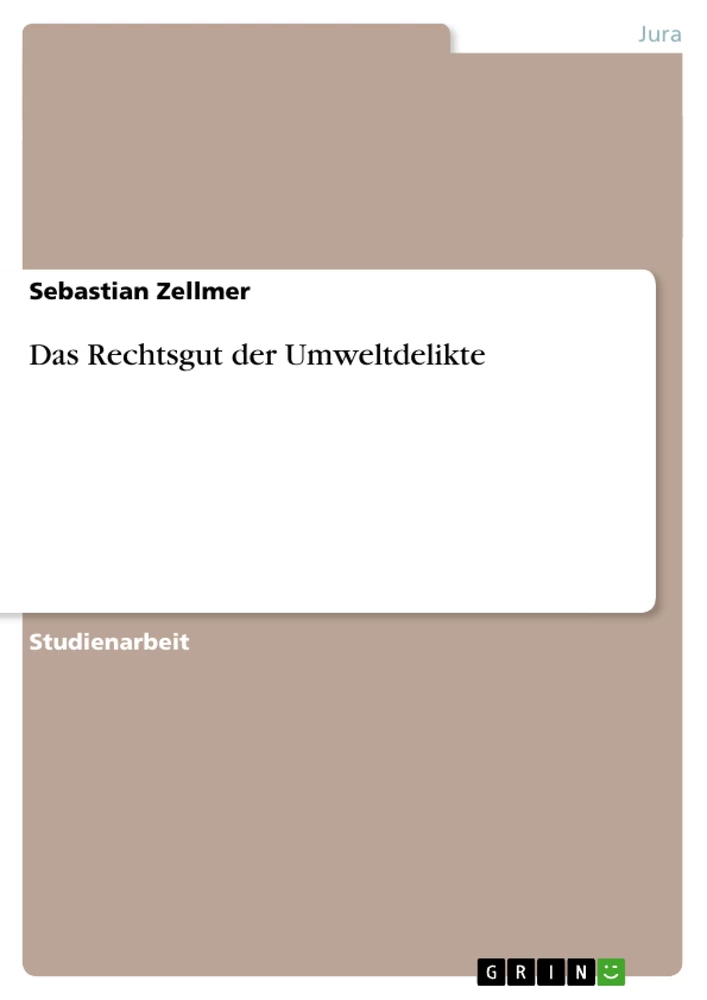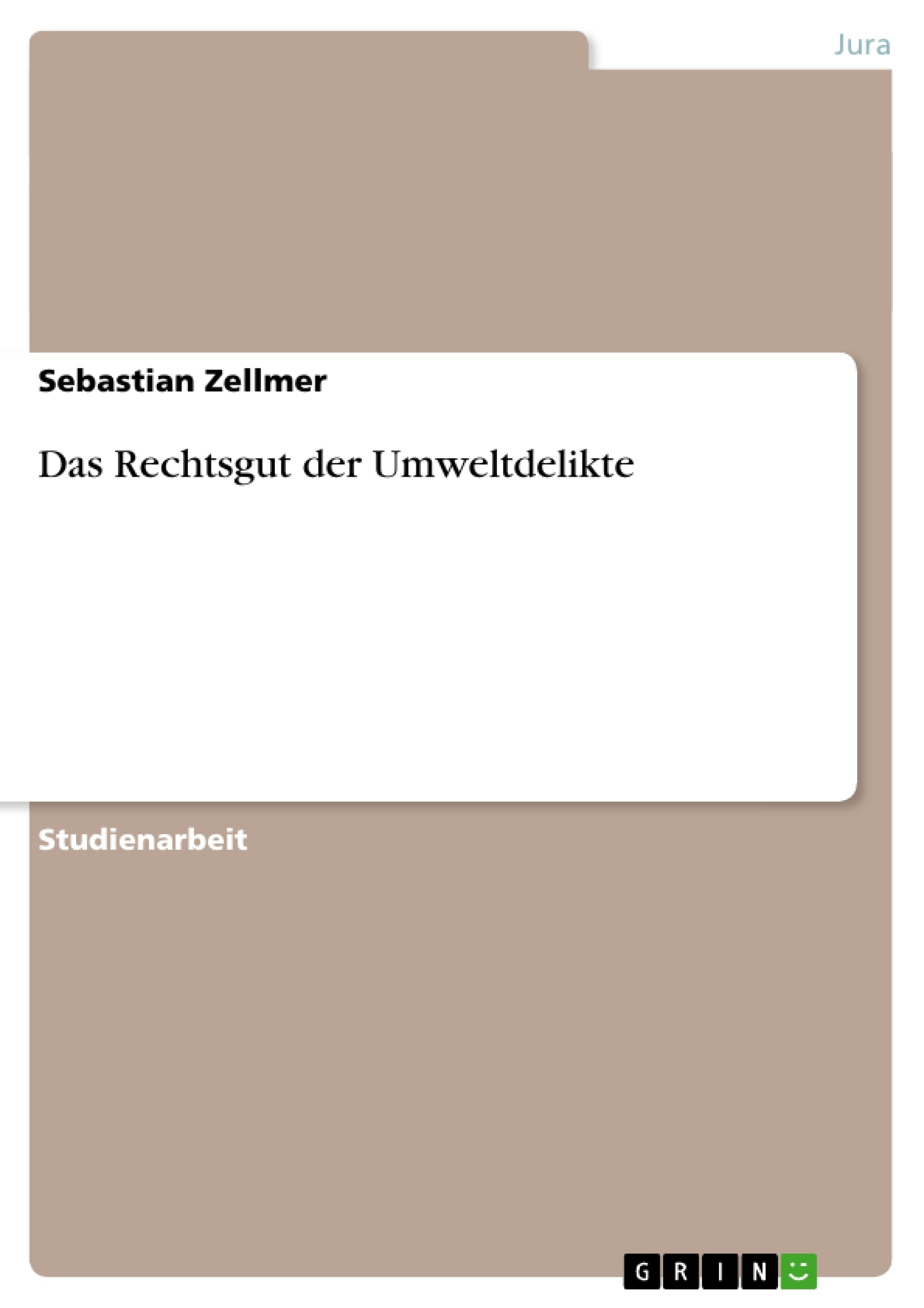Die Umweltdelikte bildeten ursprünglich reines Nebenstrafrecht, jedoch wurden mit dem 18. StÄG die wichtigsten Vorschriften in erweiterter Form ins StGB (29. Abschnitt) übernommen. Es folgten, insbesondere in den Jahren 1994 und 1998, weitere Reformen und Verschärfungen, die zu den Vorschriften in ihrer jetzigen Gestalt führten. Häufig wird das Rechtsgut der wesentlichen Tatbestände des 29. Abschnitts folgendermaßen bestimmt. Geschützt ist die Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen, in ihren verschiedenen Medien (Boden, Wasser, Luft) und sonstigen Erscheinungsformen (Pflanzen, Tiere). Diese Definition ist jedoch umstritten (s.u.). Ferner entzieht sich die nähere Konkretisierung des Umweltguts einer einheitlichen Definition, da die einzelnen Delikte des Umweltstrafrechts sehr heterogener Natur sind. In der Diskussion um die Bestimmung der Rechtsgüter im Umweltstrafrecht finden sich allerdings wiederkehrende Grundmuster.
Inhaltsverzeichnis
- A. Positionen zur Bestimmung der Rechtsgüter
- I. Ökologisch-anthropozentrische Sichtweise
- II. Ökologische Sichtweise
- III. Anthropozentrische Sichtweise
- IV. Administrative Sichtweise
- B. Die Rechtsgutsbestimmung bei einzelnen Delikten
- I. Gewässerverunreinigung, § 324 StGB
- 1. Konkretisierung des Schutzguts Gewässer
- 2. Auslegung des Schutzguts
- 3. Stellungnahme
- II. Bodenverunreinigung, § 324a StGB
- III. Luftverunreinigung, § 325 StGB
- IV. Verursachen von Lärm, Erschütterungen und Strahlen, § 325a StGB
- V. Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen, § 326 StGB
- VI. Unerlaubtes Betreiben von Anlagen, § 327 StGB
- VII. § 328 und § 329 StGB
- VIII. Naturschutzstrafrecht
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rechtsgüter, die durch Umweltdelikte geschützt werden. Sie analysiert verschiedene juristische Positionen zur Bestimmung dieser Rechtsgüter und beleuchtet deren Bedeutung für die Sanktionierung von Umweltstraftaten und -ordnungswidrigkeiten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung dieser verschiedenen Ansätze auf konkrete Delikte des Strafgesetzbuches (StGB).
- Analyse verschiedener Rechtsgutsbestimmungen im Umweltstrafrecht
- Untersuchung der ökologisch-anthropozentrischen, ökologischen und anthropozentrischen Sichtweise
- Bewertung der Rolle des Verwaltungsrechts im Umweltstrafrecht
- Deliktspezifische Betrachtung der Rechtsgutsbestimmung an ausgewählten Beispielen aus dem StGB
- Zusammenführung der verschiedenen Ansätze und deren Bedeutung für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
A. Positionen zur Bestimmung der Rechtsgüter: Dieses Kapitel untersucht verschiedene juristische Positionen bezüglich der Bestimmung der Rechtsgüter, die im Umweltstrafrecht geschützt werden. Es werden die ökologisch-anthropozentrische, die ökologische, die anthropozentrische und die administrative Sichtweise dargestellt und miteinander verglichen. Dabei wird die historische Entwicklung des Umweltstrafrechts berücksichtigt und die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Ansätze herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Umwelt an sich oder der Mensch als Nutznießer der Umwelt im Mittelpunkt des Schutzes steht, und wie sich diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Straftatbestände auswirken.
B. Die Rechtsgutsbestimmung bei einzelnen Delikten: Dieser Abschnitt wendet die im vorherigen Kapitel dargestellten Rechtsgutsbestimmungen auf konkrete Delikte des Umweltstrafrechts an. Anhand von Beispielen aus dem StGB (§§ 324, 324a, 325, 325a, 326, 327, 328, 329) werden die spezifischen Probleme und Herausforderungen der Rechtsgutsbestimmung in der Praxis veranschaulicht. Die Analyse der einzelnen Delikte zeigt auf, wie die unterschiedlichen theoretischen Ansätze in der konkreten Anwendung zum Tragen kommen und welche Auswirkungen dies auf die Strafzumessung hat. Der Schwerpunkt liegt auf der konkreten Auslegung der Schutzgüter und der Schwierigkeiten bei deren Abgrenzung.
Schlüsselwörter
Umweltdelikte, Rechtsgüter, ökologisch-anthropozentrische Sichtweise, ökologische Sichtweise, anthropozentrische Sichtweise, administrative Sichtweise, Gewässerverunreinigung, Bodenverunreinigung, Luftverunreinigung, Lärm, gefährliche Abfälle, Anlagenbetreiben, Naturschutzstrafrecht, Strafgesetzbuch (StGB), Sanktionierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Rechtsgüter im Umweltstrafrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rechtsgüter, die durch Umweltdelikte geschützt werden. Sie untersucht verschiedene juristische Positionen zur Bestimmung dieser Rechtsgüter und deren Bedeutung für die Sanktionierung von Umweltstraftaten und -ordnungswidrigkeiten. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Ansätze auf konkrete Delikte des Strafgesetzbuches (StGB).
Welche juristischen Positionen zur Bestimmung der Rechtsgüter werden untersucht?
Die Arbeit untersucht vier Hauptpositionen: die ökologisch-anthropozentrische, die ökologische, die anthropozentrische und die administrative Sichtweise. Diese werden verglichen und ihre jeweiligen Schwerpunktsetzungen und Auswirkungen auf die Auslegung und Anwendung von Straftatbeständen herausgearbeitet.
Welche Delikte des StGB werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Rechtsgutsbestimmung an ausgewählten Beispielen aus dem StGB, einschließlich der §§ 324 (Gewässerverunreinigung), 324a (Bodenverunreinigung), 325 (Luftverunreinigung), 325a (Lärm, Erschütterungen und Strahlen), 326 (Umgang mit gefährlichen Abfällen), 327 (unerlaubtes Betreiben von Anlagen), 328 und 329 sowie das Naturschutzstrafrecht.
Wie werden die verschiedenen Rechtsgutsbestimmungen auf konkrete Delikte angewendet?
Der Abschnitt "Die Rechtsgutsbestimmung bei einzelnen Delikten" wendet die im vorherigen Kapitel dargestellten Positionen auf die genannten StGB-Paragraphen an. Es werden die spezifischen Probleme und Herausforderungen der Rechtsgutsbestimmung in der Praxis veranschaulicht und die Auswirkungen der verschiedenen theoretischen Ansätze auf die Strafzumessung gezeigt. Die Analyse konzentriert sich auf die Auslegung der Schutzgüter und deren Abgrenzung.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Kapitel C) fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Bedeutung der verschiedenen Ansätze für die Praxis der Strafverfolgung und Rechtsanwendung im Umweltstrafrecht. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in diesem FAQ-Abschnitt nicht explizit wiedergegeben, da er nicht im Ausgangstext enthalten ist).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Umweltdelikte, Rechtsgüter, ökologisch-anthropozentrische Sichtweise, ökologische Sichtweise, anthropozentrische Sichtweise, administrative Sichtweise, Gewässerverunreinigung, Bodenverunreinigung, Luftverunreinigung, Lärm, gefährliche Abfälle, Anlagenbetreiben, Naturschutzstrafrecht, Strafgesetzbuch (StGB), Sanktionierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel A. Positionen zur Bestimmung der Rechtsgüter, B. Die Rechtsgutsbestimmung bei einzelnen Delikten und C. Fazit. Kapitel A untersucht verschiedene juristische Positionen zur Bestimmung der Rechtsgüter im Umweltstrafrecht. Kapitel B wendet diese auf konkrete Delikte an. Kapitel C bietet ein Fazit.
- Quote paper
- Sebastian Zellmer (Author), 2005, Das Rechtsgut der Umweltdelikte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45366