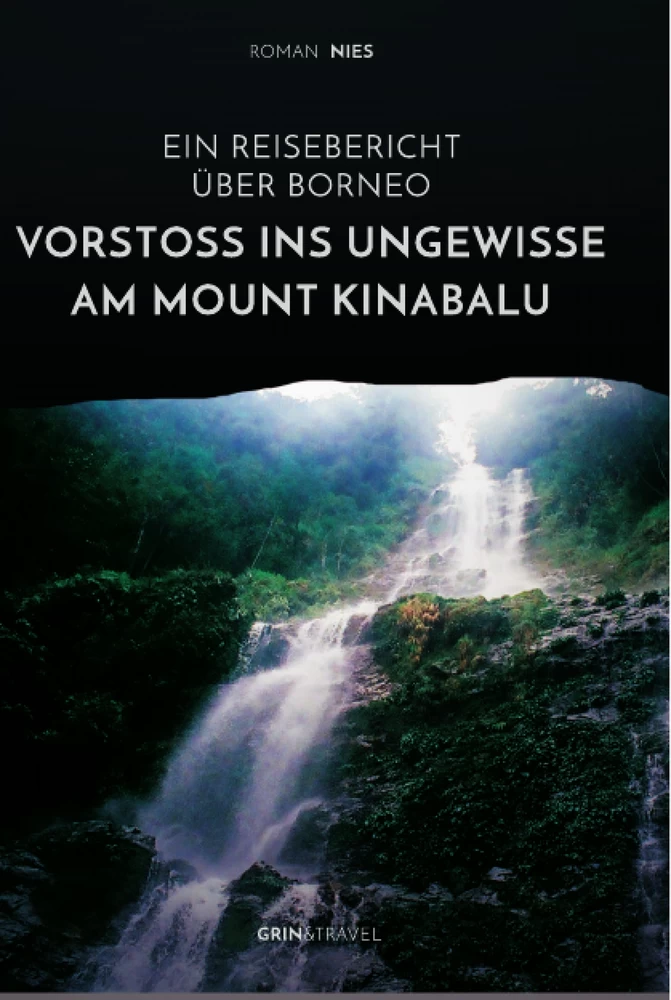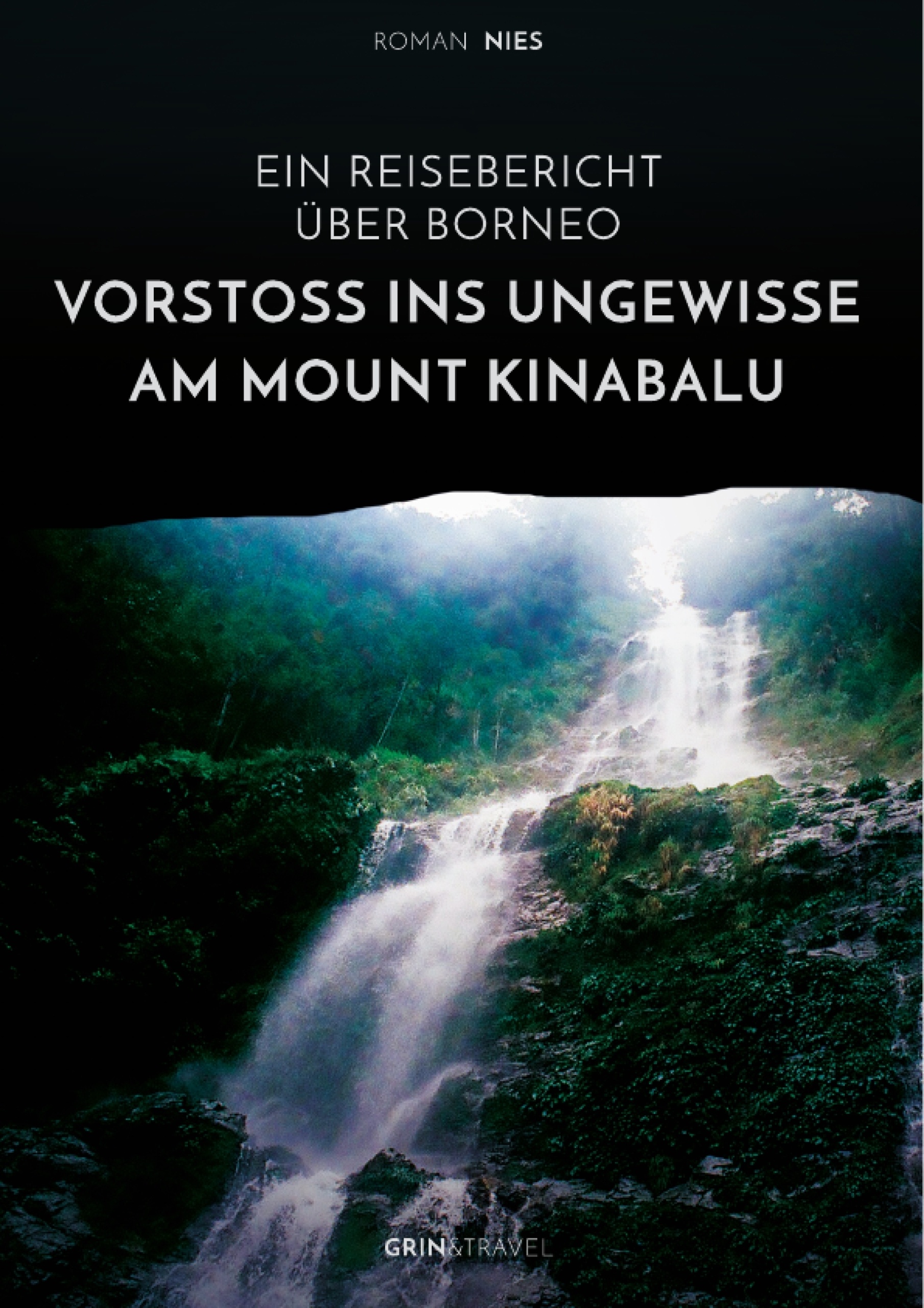Eigentlich wollte der Autor den Kinabalu, den höchsten Berg in Südostasien, besteigen. Doch dann stößt er auf die Spur einer neuen Herausforderung. Er stellt fest, zwischen Anspruch und Wirklichkeit – da liegt das Abenteuer. Und darum geht es in dieser Geschichte, die sehr real und doch überaus seltsam ist.
Zeitgleich unternimmt eine britische Militärexpedition einen Abstieg in die größte unbekannte Schlucht der Erde auf der Rückseite des Berges. Der Versuch scheitert. Die Expedition gerät in Bergnot. Ein Teil der Expedition kann sich mit Müh und Not unter allergrößten Schwierigkeiten bis zu den Urwalddörfern durchschlagen. Ein anderer Teil bleibt auf halber Höhe in der Schlucht stecken. Entkräftung und schlechtes Wetter zwingen sie zur Handlungsunfähigkeit. Der Autor unternimmt mit einem britischen Kletterer den Versuch, zu Hilfe zu kommen.
Der Reisebericht beschreibt das Ausmaß des menschlichen Dramas und beurteilt die Psychologie des Scheiterns. Er zeigt, dass es gerade im Scheitern nicht nur eine wertvolle Ausweitung des Erfahrungshorizonts geben kann, sondern auch die Chance, in der Persönlichkeit zu reifen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Kapitel: Der mystische Berg
- 2. Kapitel: Grotesken des Auf und Ab
- 3. Kapitel: Die unheimliche Schlucht
- 4. Kapitel: Das Suchen beginnt
- 5. Kapitel: Sich rettende Retter....
- 6. Kapitel: Das Drama nimmt seinen Lauf
- 7. Kapitel: Von nun an ging`s bergab.....
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Reisebericht "Vorstoss ins Ungewisse am Mount Kinabalu" zeichnet die Erfahrungen des Autors auf Borneo nach, einschließlich der Begegnung mit der mystischen Landschaft, den Herausforderungen des Aufstiegs und den abenteuerlichen Momenten. Er bietet dem Leser einen Einblick in die unberührte Natur, die Gefahren und die Faszination des Bergwanderns.
- Begegnung mit der Natur und ihren Herausforderungen
- Das Abenteuer des Bergwanderns
- Die Faszination des Unbekannten
- Die menschliche Verletzlichkeit in der Natur
- Die Begegnung mit der eigenen inneren Stärke
Zusammenfassung der Kapitel
1. Kapitel: Der mystische Berg
Das erste Kapitel führt den Leser in die faszinierende Landschaft von Borneo ein. Der Autor beschreibt die dichten Regenwälder, die unberührte Natur und die einzigartige Atmosphäre des mystischen Berges.
2. Kapitel: Grotesken des Auf und Ab
Dieses Kapitel beschreibt den Beginn der Bergtour und die ersten Herausforderungen, die der Autor bewältigen muss. Die steilen Hänge und die unwegsamen Pfade stellen seine Fitness und sein Durchhaltevermögen auf die Probe.
3. Kapitel: Die unheimliche Schlucht
In diesem Kapitel schildert der Autor seine Begegnung mit einer unheimlichen Schlucht. Die tiefe Dunkelheit, die unheimlichen Geräusche und die ungewisse Gefahr erzeugen eine beklemmende Atmosphäre.
4. Kapitel: Das Suchen beginnt
Das vierte Kapitel beschreibt die Suche nach dem Weg nach oben. Der Autor kämpft mit den rauen Bedingungen und der unvorhersehbaren Natur des Berges.
5. Kapitel: Sich rettende Retter....
Dieses Kapitel erzählt von einem unvorhergesehenen Ereignis, das den Autor in eine gefährliche Situation bringt. Glücklicherweise findet er Hilfe und wird gerettet.
6. Kapitel: Das Drama nimmt seinen Lauf
Das sechste Kapitel berichtet von einer dramatischen Wendung der Ereignisse. Der Autor muss sich einer neuen Herausforderung stellen, die seine Fähigkeiten und sein Durchhaltevermögen auf die Probe stellt.
7. Kapitel: Von nun an ging`s bergab.....
Dieses Kapitel beschreibt den Abstieg vom Berg und die Reflexionen des Autors über seine Erlebnisse. Er beschreibt die überwältigende Natur und die tiefgreifenden Eindrücke, die er gewonnen hat.
Schlüsselwörter
Borneo, Mount Kinabalu, Regenwald, Bergwandern, Abenteuer, Natur, Herausforderung, Gefahr, Faszination, Verletzlichkeit, Stärke, Reisebericht, Mystik, Unberührtheit
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Reisebericht über den Mount Kinabalu?
Der Bericht schildert eine Bergtour auf Borneo, die durch eine Rettungsaktion für eine verunglückte britische Militäre expedition zum Abenteuer wird.
Welches menschliche Drama wird beschrieben?
Es geht um das Scheitern einer Expedition in einer unbekannten Schlucht und den Kampf ums Überleben unter extremen Bedingungen.
Was lernt der Autor durch das Scheitern?
Die Geschichte zeigt, dass Scheitern eine Chance zur persönlichen Reifung und zur Erweiterung des Erfahrungshorizonts sein kann.
Wo liegt der Mount Kinabalu?
Der Mount Kinabalu ist der höchste Berg Südostasiens und befindet sich auf der Insel Borneo.
Welche Atmosphäre vermittelt der Text?
Der Text vermittelt eine Mischung aus der Faszination für unberührte Natur und der Beklemmung angesichts unheimlicher Schluchten und Gefahren.
- Quote paper
- Roman Nies (Author), 2019, Vorstoß ins Ungewisse am Mount Kinabalu. Ein Reisebericht über Borneo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453724