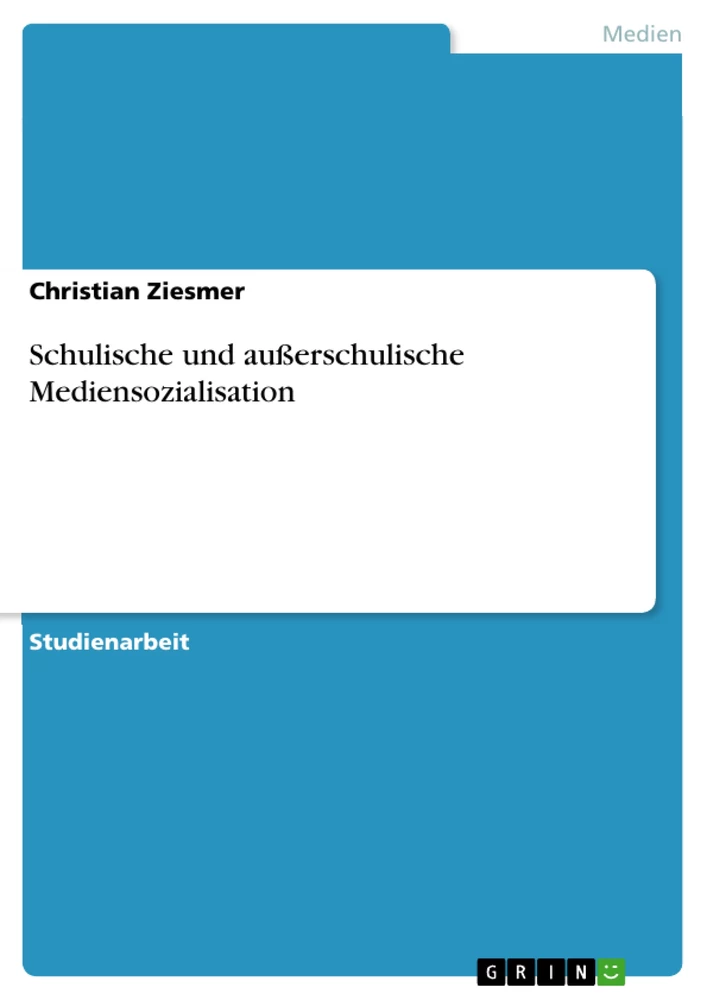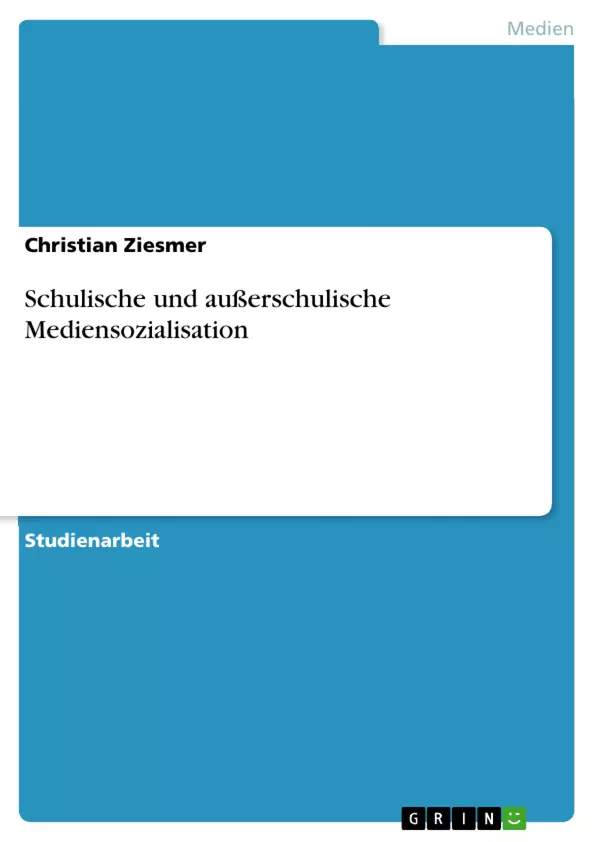Ein Großteil der Sozialisation findet heutzutage durch die Medien statt. Auch im schulischen Bereich wird der Medieneinsatz ständig erweitert. Dadurch entstehen einige Problematiken, wie zum Beispiel der stete Wandel neuer Medien und die daraus schwer einzuhaltende Aktualität, sowie die weite Bandbreite des Internets als Kommunikationsmedium. Inwieweit lassen sich Medien also wirklich in den Schulalltag integrieren?
Um diese Fragen zu klären werden die Begrifflichkeiten Sozialisation, Medien, Mediensozialisation und Medienkompetenz definiert. Um die schulische Dimension zu Medien herzustellen, folgt eine kurze Erklärung innerhalb des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg. Darauf aufbauend wird die "Shell Jugendstudie 2015" und die Studie "Generation What?" von 2016 vorgestellt und ausgewertet. Beide Studien dienen der Darlegung, inwieweit neue Medien in den Jugendalltag integriert sind. Schließlich werden die Ergebnisse der Studie genutzt, um den schulischen Mediensozialisationsprozess unter Bezugnahme der aktuellen Forschungsliteratur nachzuzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Sozialisation
- Medien
- Mediensozialisation
- Medienkompetenz
- Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg
- Shell Jugendstudie 2015
- Erklärung der Studie
- Auswertung des relevanten Studienabschnittes
- Generation What?
- Erklärung der Studie
- Auswertung des relevanten Studienabschnittes
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, wie das Feld der Medien in den Schulalltag integriert werden kann. Die Integration von Medien im Schulalltag ist eine Herausforderung, da sich neue Medien ständig weiterentwickeln und das Internet eine sehr breite Palette an Möglichkeiten bietet. Diese Arbeit fokussiert sich auf die schulische Mediensozialisation und verwendet die These von Süss und Hipeli als Leitfaden: Medien beeinflussen den Menschen, indem sie ihn manipulieren, erziehen, Identitäten und Meinungen formen und letztendlich sozialisieren.
- Definition der Begriffe Sozialisation, Medien, Mediensozialisation und Medienkompetenz im Kontext der Leitthese.
- Präsentation des Rahmens des Berliner-Brandenburger Lehrplans im Hinblick auf Medien.
- Analyse der Shell Jugendstudie 2015 und der Studie Generation What? aus dem Jahr 2016, um zu verstehen, wie neue Medien in den Alltag junger Menschen integriert sind.
- Schlussfolgerungen aus den Studien, die den schulischen Mediensozialisationsprozess unter Berücksichtigung der aktuellen Forschungsliteratur aufzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Mediensozialisation im schulischen Kontext ein und stellt die zentrale These der Arbeit vor.
- Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Sozialisation, Medien, Mediensozialisation und Medienkompetenz und setzt sie in Beziehung zur Leitthese der Arbeit.
- Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Medien im Rahmenlehrplan von Berlin-Brandenburg.
- Shell Jugendstudie 2015: Dieses Kapitel stellt die Shell Jugendstudie 2015 vor und analysiert relevante Abschnitte der Studie im Hinblick auf die Integration neuer Medien in den Alltag junger Menschen.
- Generation What?: Dieses Kapitel präsentiert die Studie Generation What? aus dem Jahr 2016 und analysiert relevante Abschnitte der Studie im Hinblick auf die Integration neuer Medien in den Alltag junger Menschen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Mediensozialisation, schulische Integration von Medien, Medienkompetenz, neue Medien, Jugendforschung, Shell Jugendstudie 2015, Generation What? und den Einfluss von Medien auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Mediensozialisation?
Mediensozialisation beschreibt den Prozess, in dem Medien die Identitätsbildung, Meinungsformung und das soziale Verhalten von Menschen beeinflussen und prägen.
Was ist Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien kritisch, reflektiert und verantwortungsbewusst zu nutzen, Inhalte zu bewerten und eigene Medienbeiträge zu gestalten.
Was sagt die Shell Jugendstudie 2015 aus?
Die Studie belegt die tiefe Integration digitaler Medien in den Alltag von Jugendlichen und zeigt auf, wie diese zur Kommunikation und Information genutzt werden.
Wie sieht die Medienbildung im Lehrplan Berlin-Brandenburg aus?
Der Rahmenlehrplan sieht vor, Medien fächerübergreifend zu integrieren, um Schülern den kompetenten Umgang mit digitalen Werkzeugen und Informationen zu vermitteln.
Welche Probleme gibt es bei Medien in der Schule?
Herausforderungen sind der schnelle technische Wandel, die Schwierigkeit, Lehrinhalte aktuell zu halten, und die Überforderung durch die enorme Informationsflut des Internets.
- Arbeit zitieren
- Christian Ziesmer (Autor:in), 2017, Schulische und außerschulische Mediensozialisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453806