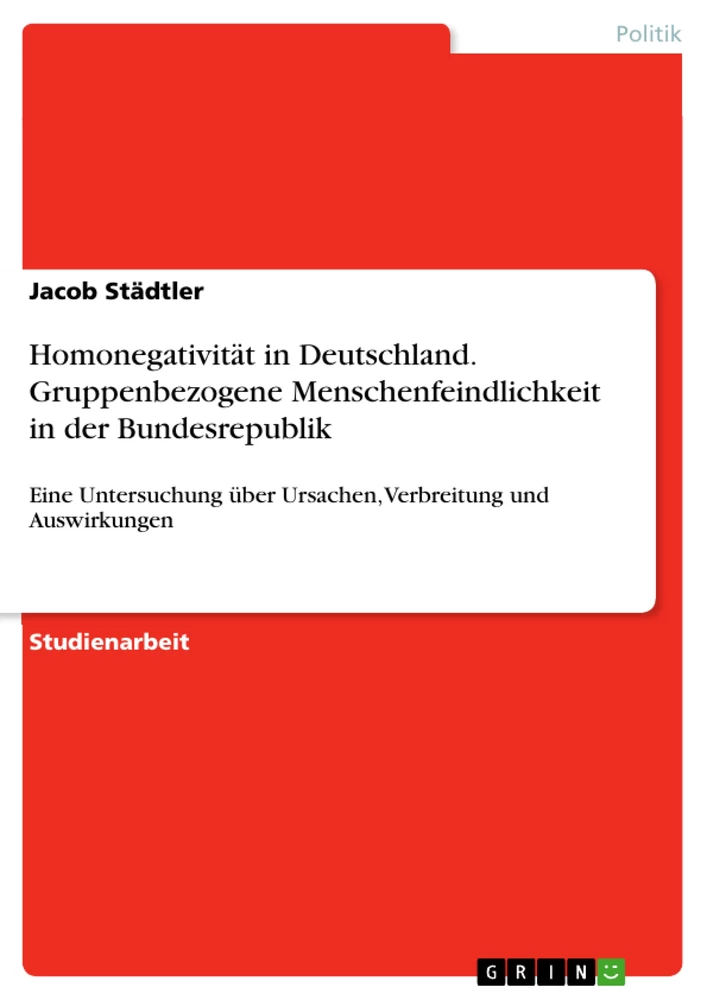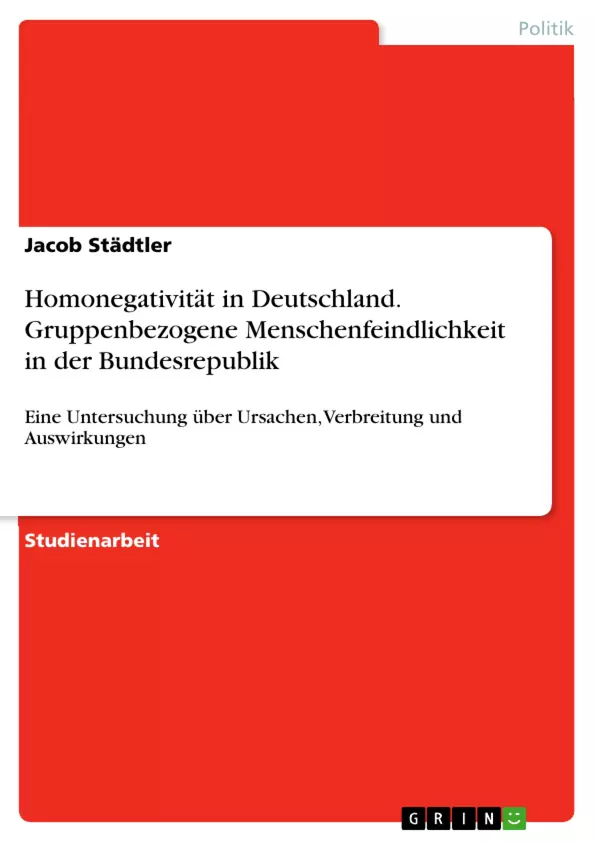Welche Ursachen und Determinanten hat Homonegativität und welche Auswirkungen kann sie für die Opfer haben? Wie stark ist dieses Phänomen in Deutschland heute wirklich noch verbreitet? Diese Problematiken zu untersuchen, einzuordnen und zu bewerten ist das Ziel dieser Arbeit.
Am 1.Oktober 2017 feierte die deutsche LGBTQ-Gemeinde ein historisches Ereignis. Mit der Verabschiedung der Ehe für Alle wurden gleichgeschlechtlichen Paaren dieselben Privilegien wie ihren heterosexuellen Pendants zugestanden, wenn sie sich für eine Eheschließung entscheiden. Damit endete in Deutschland oberflächlich eine jahrhundertelang dauernde Episode staatlicher Repression und Diskriminierung von Homosexuellen.
Doch wer daraus eine einheitliche gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz von nicht-heterosexuellen Menschen ableitet, der irrt. Schließlich kam die Abstimmung nur zustande, weil die potentiellen Koalitionspartner der Union (Die Grünen, FDP und SPD) erklärten, dass sie lediglich eine Regierung mit einer Partei bilden würden, welche die Ehe für Alle gesetzlich verankert. Daraufhin erklärte die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Abstimmung zu einer Gewissensfrage und befreite ihre Partei damit vom Fraktionszwang. Trotz dessen stimmten drei Viertel der Unionsabgeordneten gegen den Gesetzentwurf, sowie die gesamte Alternative für Deutschland. Insgesamt votierten damit mehr als ein Drittel der Abgeordneten gegen die Ehe für Alle.
Da die Parteienpositionen bis zu einem gewissen Grad auch immer auch ein Abbild der gesellschaftlichen Stimmung sind, kann man davon ausgehen, dass die Gleichstellung von nicht-heterosexuellen Menschen immer noch von vielen Bürgern abgelehnt wird bzw. sie Vorurteile oder negative Einstellungen gegenüber dieser Gruppe haben. Bedenkt man, dass Homonegativität tief in der deutschen Geschichte verwurzelt ist und erst 1994 endgültig als Strafbestand aus dem Gesetzbuch entfernt wurde, ist diese Erkenntnis nicht verwunderlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Homophobie - ein inadäquater Begriff? Definition, Problematik und Alternativen
- 2.2. Historische Wurzeln von Homonegativität
- 2.3. Soziale und psychologische Determinanten von Homonegativität
- 3. Empirischer Teil
- 3.1. Ausprägung und Verbreitung von Homonegativität in der deutschen Bevölkerung
- 3.2. Soziale und individuelle Auswirkungen von Homonegativität auf nicht-heterosexuelle Menschen
- 4. Konklusion
- 4.1. Fazit
- 4.2. Lösungsvorschläge und Möglichkeiten zur Besserung der Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Homonegativität in Deutschland. Das Ziel ist es, die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von ablehnenden Einstellungen gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen zu untersuchen.
- Definition und Problematik des Begriffs Homophobie
- Historische Wurzeln von Homonegativität in Deutschland
- Soziale und psychologische Determinanten von Homonegativität
- Ausprägung und Verbreitung von Homonegativität in der deutschen Bevölkerung
- Soziale und individuelle Auswirkungen von Homonegativität auf nicht-heterosexuelle Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie die Verabschiedung der Ehe für Alle als Ausgangspunkt nimmt und die weiterhin bestehende Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen in Deutschland beleuchtet. Es wird die Notwendigkeit einer Untersuchung des Phänomens der Homonegativität in Deutschland aufgezeigt und die Forschungsfragen der Arbeit formuliert.
2. Theoretischer Rahmen
In diesem Kapitel wird der Begriff Homonegativität definiert und die Problematik des Begriffs Homophobie diskutiert. Es werden alternative Bezeichnungen und deren Bedeutung erläutert. Anschließend werden die historischen, sozialen und psychologischen Ursachen des Phänomens Homonegativität dargestellt, wobei internationale Befunde aus vergleichbaren Ländern einbezogen werden.
3. Empirischer Teil
Dieser Abschnitt beleuchtet die Ausprägung und Verbreitung von Homonegativität in der deutschen Bevölkerung. Es werden relevante Studien vorgestellt, die das Ausmaß des Phänomens analysieren. Zusätzlich werden die sozialen und individuellen Auswirkungen von Homonegativität auf Betroffene dargestellt.
4. Konklusion
In der Konklusion werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und bewertet. Es werden Lösungsvorschläge für spezifische Problematiken sowie allgemeine Möglichkeiten zur Besserung der Situation aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Homonegativität, Homophobie, nicht-heterosexuelle Menschen, Diskriminierung, LGBTQ, Ursachen, Verbreitung, Auswirkungen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Homophobie und Homonegativität?
Der Begriff Homophobie wird oft als inadäquat kritisiert, da er eine pathologische Angst suggeriert. Homonegativität beschreibt hingegen allgemeiner ablehnende Einstellungen und Vorurteile gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen.
Wie verbreitet ist Homonegativität in Deutschland heute?
Trotz rechtlicher Meilensteine wie der „Ehe für alle“ zeigen Abstimmungsergebnisse und Studien, dass Vorurteile weiterhin tief in der Gesellschaft verwurzelt sind und von einem signifikanten Teil der Bevölkerung geteilt werden.
Welche historischen Wurzeln hat die Diskriminierung in Deutschland?
Homosexualität war in Deutschland über Jahrhunderte staatlich repressiert und wurde erst 1994 endgültig als Straftatbestand aus dem Gesetzbuch entfernt.
Welche Auswirkungen hat Homonegativität auf die Opfer?
Die Auswirkungen reichen von sozialer Ausgrenzung bis hin zu individuellen psychischen Belastungen durch Diskriminierungserfahrungen im Alltag.
Spiegeln politische Parteien die gesellschaftliche Toleranz wider?
Ja, Parteipositionen gelten oft als Abbild der gesellschaftlichen Stimmung. Dass beispielsweise ein Drittel der Abgeordneten gegen die Ehe für alle stimmte, deutet auf fortbestehende Vorbehalte in der Bevölkerung hin.
- Quote paper
- Jacob Städtler (Author), 2018, Homonegativität in Deutschland. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Bundesrepublik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453812