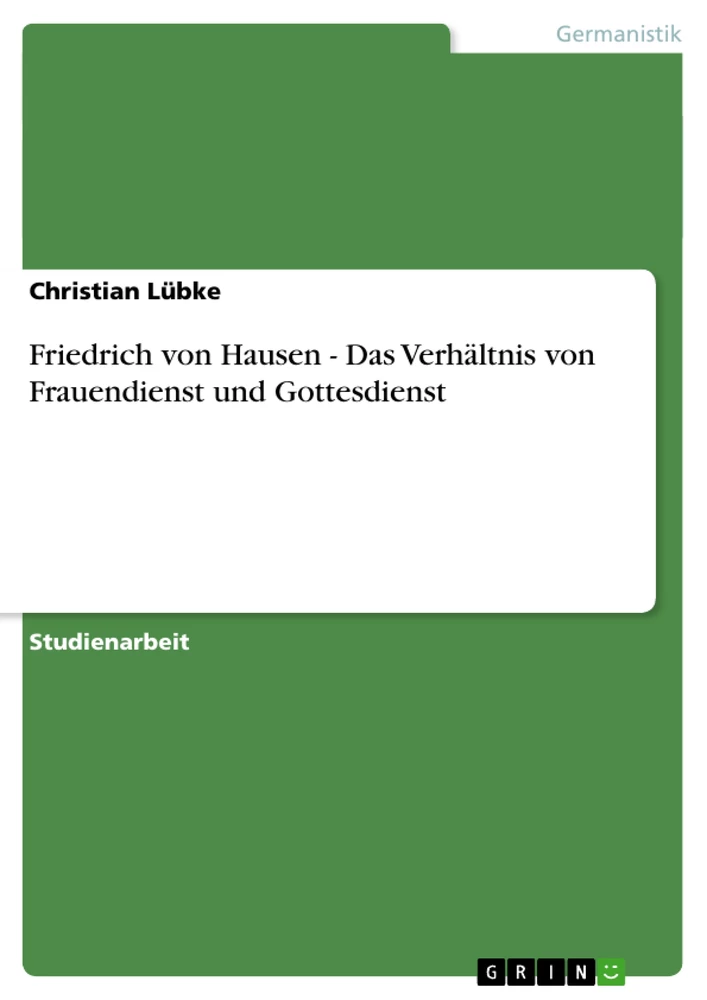Mit Friedrich von Hausen begegnet man dem Hauptvertreter der „rheinischen Minnelyrik“. Unter diesem Begriff fasst man eine Gruppe von Sängern zusammen, die geographisch und stilistisch sehr eng zusammengehören.
Auch das Lied „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“, das zur Kreuzzugslyrik gehört, wird ihm zugeschrieben.
Dieses wird ziemlich genau vor dem Aufbruch zum 3. Kreuzzug, Friedrichs von Hausen, also auf 1188/1189 datiert.
Somit gehört es unter den zahlreichen Kreuzliedern der mittelhochdeutschen Literatur zu den frühsten. Es vertritt den Typ des Keuzzug-Abschiedliedes, welches den Konflikt zwischen Gottesminne und Frauenminne zum Inhalt hat, besonders deutlich.
Im Folgenden wird zunächst eine kurze, urkundlich belegte Biographie Friedrichs von Hausen vorgestellt und sein Werk in der hohen Minne erklärt.
Danach folgt eine Analyse des wohl bekanntesten Kreuzzugliedes „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ und abschließend der schon angekündigte Konflikt zwischen Gottesdienst und Frauendienst, der hier sehr deutlich ausgeprägt ist und ein eindeutiges Ende nimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Darlegung der Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Hauptteil: Analyse des Liedes „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ von Friedrich von Hausen
- Der Minnesänger Friedrich von Hausen
- Biographie
- Sein Werk
- Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden
- Der Inhalt
- Der formale Aufbau
- Reimform und Metrik
- Frauendienst und Gottesdienst zur Zeit der Kreuzzüge
- Der Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst
- Die Trennung von herze und lîp und die Entscheidung für Gott
- Der Minnesänger Friedrich von Hausen
- Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Lied „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ von Friedrich von Hausen, wobei das Verhältnis von Frauendienst und Gottesdienst im Zentrum steht. Es wird die Biographie des Minnesängers beleuchtet und sein Werk im Kontext der rheinischen Minnelyrik eingeordnet. Das Lied selbst wird inhaltlich und formal untersucht.
- Biographie und Werk Friedrichs von Hausen
- Inhaltliche Analyse des Liedes „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“
- Formale Aspekte des Liedes (Aufbau, Metrik, Reim)
- Der Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst im Hochmittelalter
- Die Entscheidung des lyrischen Ichs im Kontext des Kreuzzugs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Darlegung der Fragestellung und Aufbau der Arbeit: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Friedrich von Hausen als Hauptvertreter der rheinischen Minnelyrik vor. Das Lied „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ wird als frühstes Kreuzlied mit dem zentralen Konflikt zwischen Gottesminne und Frauenminne vorgestellt. Die Arbeit skizziert den Aufbau: Biographie und Werk Hausens, Analyse des Liedes und schließlich die Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst.
Hauptteil: I. Der Minnesänger Friedrich von Hausen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Biographie Friedrichs von Hausen anhand von urkundlichen Zeugnissen, die ihn als hoch angesehenen Ministeriale am Stauferhof ausweisen. Sein Werk wird als eigenständige Synthese heimischer und provenzalisch-altfranzösischer Minnelyrik beschrieben, wobei die Kreuzzugslieder als besonders datierbar und thematisch relevant hervorgehoben werden – sie behandeln den Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst.
Hauptteil: II. Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden: Die Analyse des Liedes „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ behandelt den zentralen Konflikt zwischen der Liebe zur Frau und dem Dienst an Gott. Der inhaltliche Aufbau der vier Strophen wird dargestellt, wobei die Spannung zwischen dem Leid des lyrischen Ichs und der Bitte um göttliche Intervention, der unausweichlichen Trennung von Herz und Leib und der letztlichen Entscheidung für Gott herausgearbeitet wird. Der formale Aufbau mit seinen gleich langen Strophen und dem Wechsel zwischen einfachem und komplexeren Satzbau wird ebenfalls beschrieben.
Hauptteil: III. Frauendienst und Gottesdienst zur Zeit der Kreuzzüge: Dieser Abschnitt vertieft den im Lied dargestellten Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst im Kontext der Kreuzzüge. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung der Entscheidung für Gott als Ausdruck der persönlichen Haltung des Dichters, die sich auch in seinem Tod während des Dritten Kreuzzuges widerspiegelt. Der Abschnitt ordnet den inneren Konflikt in die historische und gesellschaftliche Situation des Hochmittelalters ein.
Schlüsselwörter
Friedrich von Hausen, rheinische Minnelyrik, Kreuzzugslyrik, Gottesminne, Frauenminne, „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“, Hochmittelalter, Konflikt, Entscheidung, Biographie, Werkanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden" von Friedrich von Hausen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Lied „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ von Friedrich von Hausen mit besonderem Fokus auf den Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst im Hochmittelalter. Die Analyse umfasst die Biographie des Autors, eine detaillierte Inhalts- und Formaanalyse des Liedes sowie die Einordnung des Werks in den historischen Kontext der Kreuzzüge.
Wer war Friedrich von Hausen?
Friedrich von Hausen war ein bedeutender Minnesänger des Hochmittelalters. Die Arbeit beschreibt ihn als hoch angesehenen Ministeriale am Stauferhof. Sein Werk wird als eigenständige Synthese heimischer und provenzalisch-altfranzösischer Minnelyrik charakterisiert, wobei seine Kreuzzugslieder als besonders wichtig für das Verständnis seines Werks hervorgehoben werden.
Worüber handelt das Lied "Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden"?
Das Lied beschreibt den inneren Konflikt des lyrischen Ichs zwischen der Liebe zu einer Frau (Frauenminne) und dem Dienst an Gott (Gottesminne). Der zentrale Konflikt wird in vier Strophen dargestellt, die die Spannung zwischen Leid, Bitte um göttliche Intervention, Trennung von Herz und Leib und der endgültigen Entscheidung für Gott zeigen.
Welche formalen Aspekte des Liedes werden untersucht?
Die Analyse umfasst den inhaltlichen Aufbau der vier Strophen, den Wechsel zwischen einfachen und komplexeren Satzbauten sowie die Metrik und Reimform des Liedes. Der gleichmäßige Aufbau der Strophen wird ebenfalls beschrieben.
Wie wird der Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst im Kontext der Kreuzzüge dargestellt?
Die Arbeit untersucht die Entscheidung des lyrischen Ichs für Gott als Ausdruck der persönlichen Haltung des Dichters und ordnet diesen inneren Konflikt in die historische und gesellschaftliche Situation des Hochmittelalters und den Kontext der Kreuzzüge ein. Der Tod des Dichters während des Dritten Kreuzzuges wird ebenfalls in Bezug auf diesen Konflikt gesetzt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich von Hausen, rheinische Minnelyrik, Kreuzzugslyrik, Gottesminne, Frauenminne, „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“, Hochmittelalter, Konflikt, Entscheidung, Biographie, Werkanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu Friedrich von Hausen, dem Lied selbst und dem Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst) und einen Schluss mit Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit dar. Der Hauptteil bietet eine detaillierte Analyse, und der Schluss fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Lied „Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden“ von Friedrich von Hausen im Kontext der rheinischen Minnelyrik und der Kreuzzüge zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Konflikt zwischen Frauendienst und Gottesdienst und der Entscheidung des lyrischen Ichs.
- Citar trabajo
- Christian Lübke (Autor), 2005, Friedrich von Hausen - Das Verhältnis von Frauendienst und Gottesdienst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45397