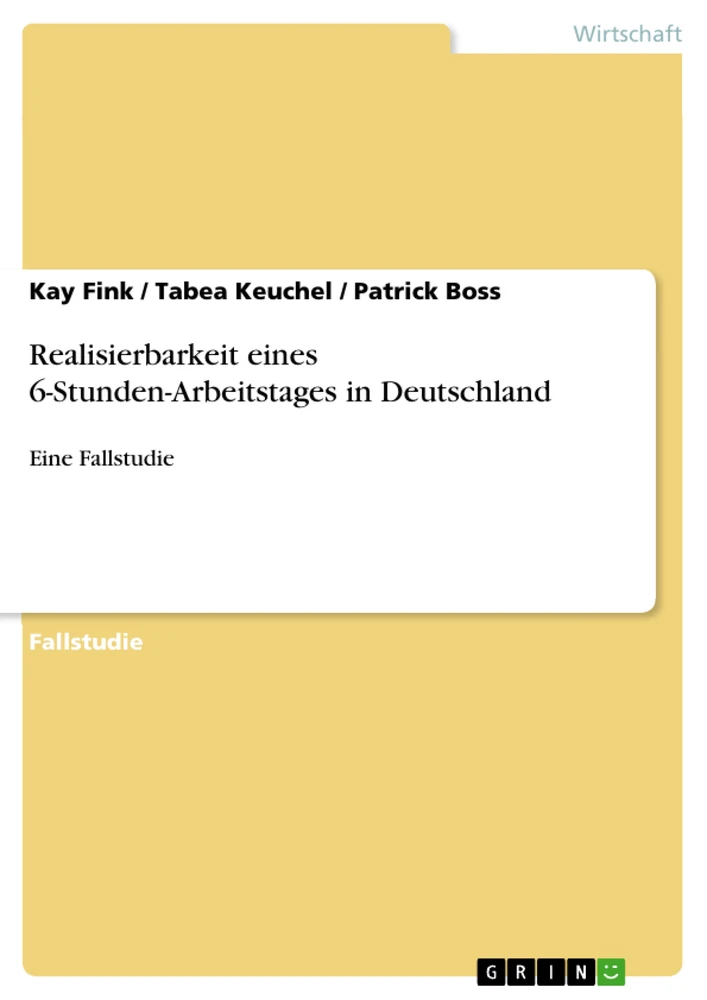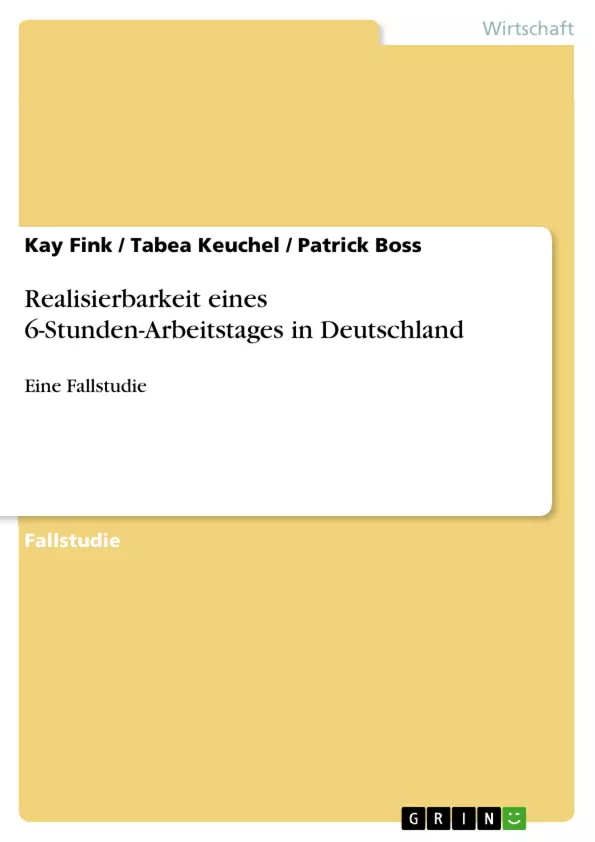Die deutsche Wirtschaft wird aktuell immer wieder mit dem Wunsch nach kürzeren Arbeitstagen konfrontiert. Das Thema löst große Diskussionen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften aus. Das Management der Unternehmen steht zunehmend vor der Frage, wie es zukünftig motiviertes Fachpersonal, welches eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche unternehmerische Tätigkeiten bildet, für sich gewinnen kann.
Diese Hausarbeit thematisiert die Position der deutschen Wirtschaft zu einem möglichen zukünftigen 6-Stunden-Arbeitstag. Hierfür werden alle Argumentationsseiten beschrieben: Auf der einen Seite stehen die Arbeitnehmer, die bekanntlich nach einer ausgewogenen Work-Live-Balance streben. Auf der anderen Seite stehen die Arbeitgeber, die ihre Unternehmen möglichst produktiv und rentabel gestalten wollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das deutsche Arbeitssystem
- Historische Entwicklung der Arbeitszeit
- Gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit
- Statistiken zum aktuellen Arbeitssystem in Deutschland
- Der 6-Stunden-Arbeitstag
- Vorstellung des 6-Stunden-Arbeitstages
- Abwägung Arbeitnehmer
- Chancen für den Arbeitnehmer
- Die Risiken für den Arbeitnehmer
- Abwägung Arbeitgeber
- Chancen für den Arbeitgeber
- Risiken für den Arbeitgeber
- Praxisbeispiele
- Schweden als Vorreiter
- Positive Erfahrungen
- Negative Erfahrungen
- Berliner Start-Up Tandemploy
- Industriegewerkschaft Metall
- Schweden als Vorreiter
- Empirische Umfrage
- Allgemeine Informationen
- Auswertung
- Arbeitgeber, Angestellte in Führungspositionen und Selbstständige
- Vergleich Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Schlussfolgerung
- Kritische Betrachtung
- Realisierbarkeit des 6-Stunden-Arbeitstages
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Realisierbarkeit eines 6-Stunden-Arbeitstages in Deutschland. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Arbeitszeit, die aktuellen gesetzlichen Regelungen und die Statistiken zum deutschen Arbeitssystem. Darüber hinaus werden die Chancen und Risiken eines kürzeren Arbeitstages für Arbeitnehmer und Arbeitgeber analysiert und anhand von Praxisbeispielen aus Schweden und Deutschland veranschaulicht. Eine empirische Umfrage liefert zusätzliche Erkenntnisse zur Akzeptanz und Realisierbarkeit des Modells in der Praxis.
- Historische Entwicklung der Arbeitszeit in Deutschland
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Arbeitszeitregelungen
- Vorteile und Nachteile eines 6-Stunden-Arbeitstages für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Praxisbeispiele und Erfahrungen mit dem 6-Stunden-Arbeitstag in Schweden und Deutschland
- Realisierbarkeit und Akzeptanz des 6-Stunden-Arbeitstages in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Thematik des 6-Stunden-Arbeitstages in Deutschland vor und erläutert die Ziele der Arbeit.
- Kapitel 2 befasst sich mit dem deutschen Arbeitssystem, einschließlich seiner historischen Entwicklung, der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und den relevanten Statistiken.
- Kapitel 3 präsentiert den 6-Stunden-Arbeitstag und untersucht die Chancen und Risiken für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
- Kapitel 4 beleuchtet eine empirische Umfrage zum Thema, die Einblicke in die Akzeptanz des 6-Stunden-Arbeitstages in Deutschland bietet.
- Kapitel 5 analysiert die Realisierbarkeit des 6-Stunden-Arbeitstages im deutschen Kontext.
Schlüsselwörter
6-Stunden-Arbeitstag, Arbeitszeit, Arbeitssystem, Deutschland, Schweden, Tandemploy, Industriegewerkschaft Metall, Empirische Umfrage, Realisierbarkeit, Chancen, Risiken, Arbeitnehmer, Arbeitgeber
- Arbeit zitieren
- Kay Fink (Autor:in), Tabea Keuchel (Autor:in), Patrick Boss (Autor:in), 2018, Realisierbarkeit eines 6-Stunden-Arbeitstages in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454064