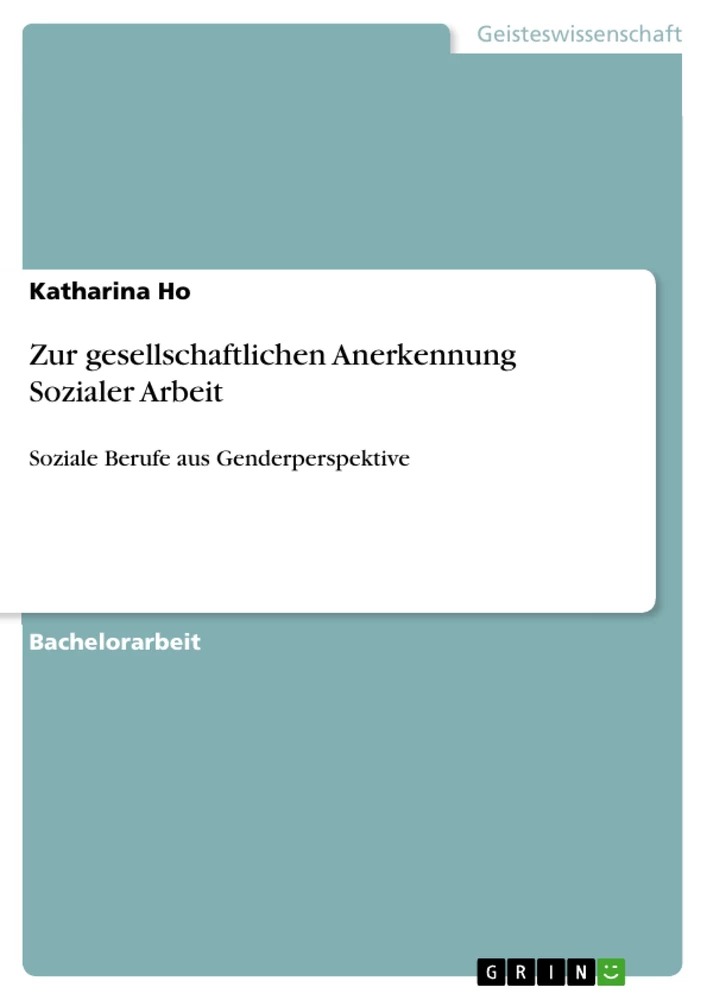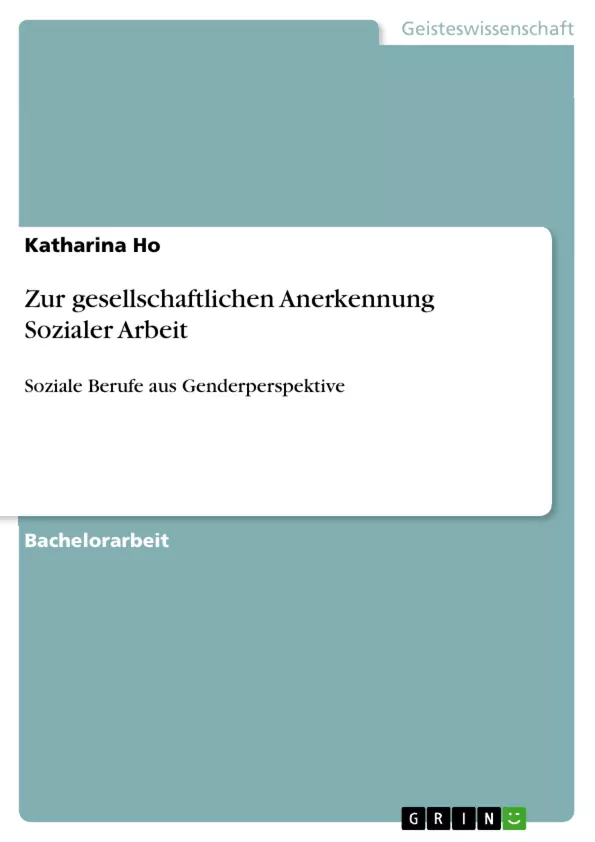Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, durch welche Kategorisierungen und Zuschreibungen Berufe Anerkennung innerhalb der Gesellschaft erfahren.
In Deutschland gibt es Berufe, die ein hohes Ansehen und Einkommen erzielen und Berufe wie die Soziale Arbeit, bei denen beides verhältnismäßig gering ausfällt. Doch was sind Faktoren, nach denen Berufe bewertet und anerkannt werden? Wie wirkt sich der Status eines "Frauenberufes" auf die Anerkennung aus? Daher liegt ein besonderer Fokus der Arbeit auf Genderaspekten: Welchen Einfluss hat die weibliche Prägung der Profession auf berufspolitische, ökonomische und gesellschaftliche Strukturen? Die Arbeit gliedert sich in zwei große Teile: Im ersten Teil der Arbeit werden relevante historische sowie aktuelle Prozesse und Entwicklungen analysiert, welche wesentlich sind, um die heutige Situation verstehen zu können. Nach diesen Faktoren, kann der daraus resultierende, heutige Ist-Zustand erklärt werden. Dies ist der zweite große Teil der Arbeit.
Es handelt sich demnach um eine komplexe Verzahnung von Gegebenheiten, deren Wirken miteinander betrachtet werden sollte. Es werden Antworten auf die Frage gefunden, warum die Soziale Arbeit, verglichen mit anderen Professionen, verhältnismäßig geringe Anerkennung und Löhne verzeichnet: Hierarchien von Anerkennung, begründet durch Wertmuster und kulturelle Zuschreibungen, äußern sich in einer geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung. So teilen diese zum einen in Reproduktions- und Produktionsarbeit. Zum anderen aber teilen sie innerhalb der Erwerbsarbeit die Segregationsentwicklungen in weiblich-codierte, naturalisierte, fürsorglich-soziale und relativ schlecht bezahlte Tätigkeiten sowie in männlich zugeschriebene, produktive, effiziente und leistungsstarke, besser bezahlte Tätigkeiten. Eine wichtige Entwicklung, um die gesellschaftliche Anerkennung professioneller Sozialer Arbeit erreichen zu können, wäre es, fürsorgliche Aufgaben von ihrer traditionell weiblichen Zuschreibung zu entkoppeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Prozess/Entwicklung
- 1.1 Historische Entwicklungen der Sozialen Arbeit als Profession
- 1.1.1 Frauenbewegungen
- 1.1.2 Konfessioneller Einfluss auf die Profession.
- 1.2 Gesellschaftliche Strukturen
- 1.2.1 Geschlecht als Strukturkategorie
- 1.2.2 Hegemoniale Männlichkeit als überlegenes Prinzip
- 1.3 Strukturierung von Erwerbsarbeit in Deutschland: Einordnung Sozialer Arbeit in den Arbeitsmarkt
- 2. Gegenwärtige Situation: Die Besonderheiten der helfenden Profession.
- 2.1 Soziale Arbeit als Frauenberuf
- 2.2 Status und Löhne
- 2.2.1 Einfluss der Kirche
- 2.2.2 Einfluss der Care-Debatte
- 2.2.3 Einfluss von Ehrenamt
- 2.3 Gewerkschaftliches Engagement.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die gesellschaftliche Anerkennung der Sozialen Arbeit unter Berücksichtigung von Genderaspekten. Sie analysiert, wie Kategorisierungen und Zuschreibungen die Wertschätzung von Berufen innerhalb der Gesellschaft beeinflussen. Dabei werden Faktoren beleuchtet, die zur geringen Anerkennung und den niedrigen Einkommen in der Sozialen Arbeit im Vergleich zu anderen Berufsgruppen beitragen.
- Die geschichtliche Entwicklung der Sozialen Arbeit im Kontext von Frauenbewegungen und konfessionellen Einflüssen
- Die Bedeutung von Geschlecht als Strukturkategorie und die Rolle hegemonialer Männlichkeit in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung
- Der Einfluss von Genderstereotypen auf die Berufswahl und die Strukturierung des Arbeitsmarktes, insbesondere in Bezug auf die Soziale Arbeit
- Die Auswirkungen von Genderstereotypen auf den Status und die Bezahlung in der Sozialen Arbeit
- Die Rolle von Gewerkschaften und Berufsverbänden in der Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil wird die historische und aktuelle Entwicklung der Sozialen Arbeit als Profession analysiert. Kapitel 1.1 beleuchtet die Entstehung der Sozialen Arbeit innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung und die Einflüsse weiterer sozialer Bewegungen. Kapitel 1.2 erläutert, wie die deutsche Gesellschaft anhand der Kategorie Geschlecht strukturiert ist und wie die Hegemoniale Männlichkeit diese Asymmetrie zugunsten der Männer bekräftigt. Kapitel 1.3 befasst sich mit der Strukturierung von Erwerbsarbeit in Deutschland und der Einordnung der Sozialen Arbeit in den Arbeitsmarkt.
Der zweite Teil der Arbeit untersucht die gegenwärtige Situation der Sozialen Arbeit. Kapitel 2.1 analysiert, warum die Soziale Arbeit als Frauenberuf bezeichnet werden kann. Kapitel 2.2 untersucht die Unterschiede in Status und Löhnen, die sich aufgrund der geschlechtlichen Prägung der Profession ergeben. Kapitel 2.3 behandelt das gewerkschaftliche Engagement in der Sozialen Arbeit und die Rolle von Berufsverbänden in der Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der gesellschaftlichen Anerkennung von Berufen, insbesondere der Sozialen Arbeit. Die Analyse berücksichtigt die Bedeutung von Genderaspekten und untersucht die Rolle von Frauenbewegungen, konfessionellen Einflüssen, hegemonialer Männlichkeit und der Strukturierung des Arbeitsmarktes. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen von Genderstereotypen auf den Status, die Bezahlung und das gewerkschaftliche Engagement in der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Katharina Ho (Author), 2018, Zur gesellschaftlichen Anerkennung Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454088