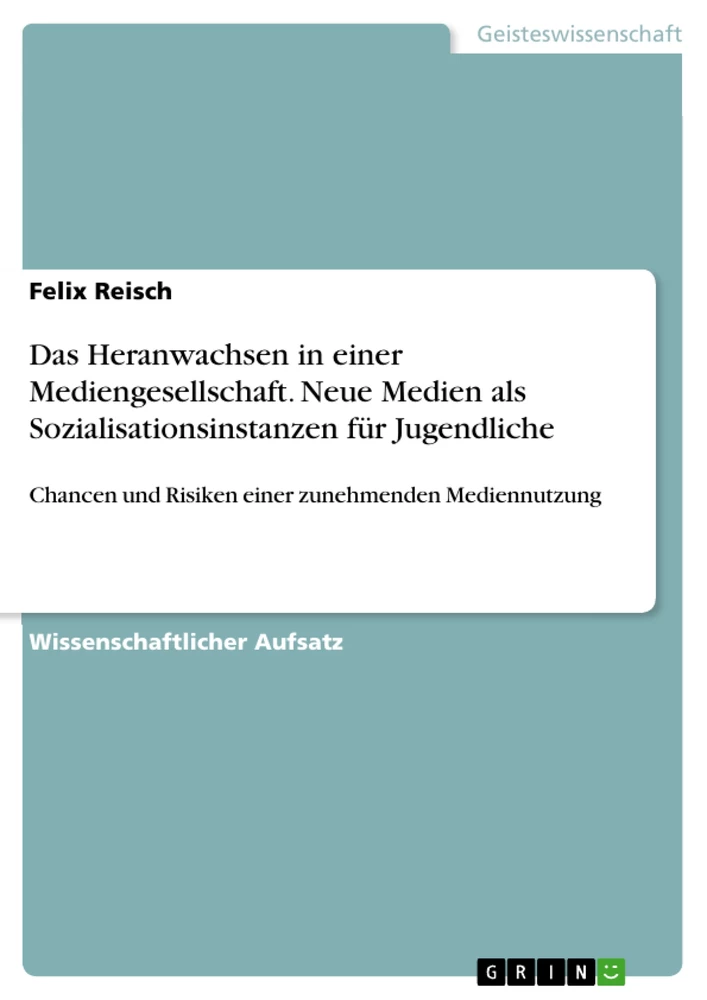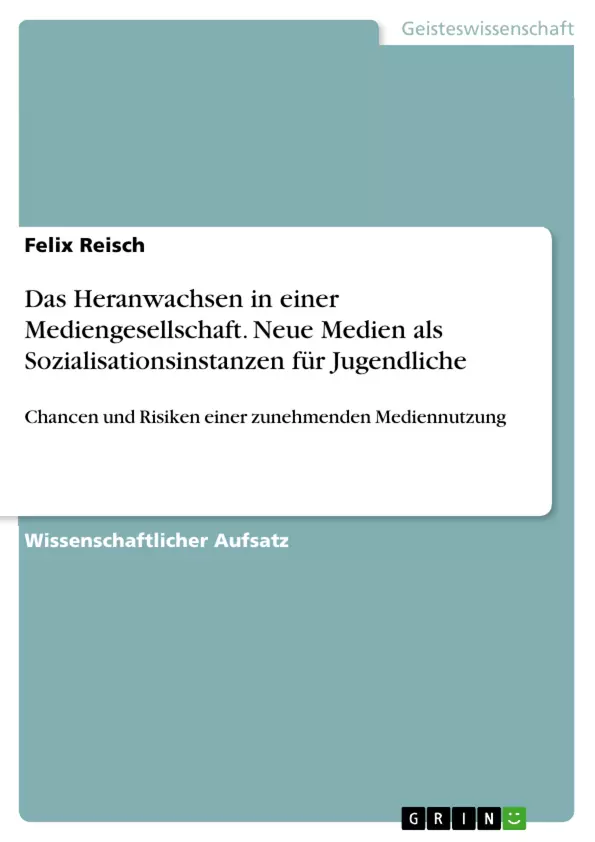Neue Medien sind innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem wichtigen Bestandteil unseres Alltags geworden und haben sich in nahezu jedem Teil der Erde etabliert. Gerade Kinder und Jugendliche wachsen in der heutigen Zeit unter Einfluss von vielen verschiedenen Medienformen auf. Vor allem Internet und Smartphones ermöglichen für die Heranwachsenden, aber auch für ältere Generationen, eine sehr vielfältige Nutzungsweise. Neben der Kommunikation mit Freunden und Bekannten bietet das Internet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Viele Jugendliche verfügen heutzutage über zahlreiche Medien (z.B. Smartphones, Internet und Computer), die wie selbstverständlich zu ihrem Alltag gehören. Zwar scheint der Einfluss des Internets und anderer neuer Medien auf das Heranwachsen von Kinder und Jugendlichen unabdingbar, jedoch ist bisher wenig darüber bekannt, wie dieser Prozess stattfindet und welche Folgen dies für andere Sozialisationsinstanzen (z.B. Familie, Peers oder Schule) haben kann.
Die nachfolgende Arbeit soll sich sowohl mit der Beeinflussung der Jugendlichen durch das umfangreiche Medienangebot auseinandersetzen als auch über die Wichtigkeit der Familie im Kontext der Medienerziehung berichten. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der Einfluss neuer Medien auf die heutige Jugend haben kann und ob diese für die Zukunft der Gesellschaft als positiv oder negativ zu bewerten sind. Welche Chancen bieten sich durch eine zunehmende Digitalisierung unserer heranwachsenden Generationen? Welche Risiken nehmen Eltern, Schule und vor allem die Jugendlichen selbst damit in Kauf? Das Hauptziel der Arbeit soll in der Beantwortung dieser beiden Fragen liegen. Dabei soll versucht werden verschiedene Folgen des zunehmenden Medienkonsums (z. B. einerseits die Möglichkeiten der sozialen Vernetzung durch das Internet aber auch die sich auftuenden Suchtgefahren) darzustellen und in die abschließende Auswertung einfließen zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Neue Medien
- Sozialisationsinstanz
- Hauptteil
- Medienvielfalt und die indirekte Beeinflussung Heranwachsender
- Auswirkungen der neuen Medien auf den jugendlichen Alltag
- Familiales Zusammenleben
- Freizeitgestaltung
- Schulische Leistung
- Chancen im Umgang mit neuen Medien
- Sozialisation
- Soziale Vernetzung
- Schulische und berufliche Fertigkeiten
- Risiken im Umgang mit neuen Medien
- Anonymität
- Sexuelle, gewaltverherrlichende und extremistische Darstellungen
- Datenmissbrauch und Cybermobbing
- Mediensucht
- Die Ausbildung von Medienkompetenz durch Medienerziehung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von neuen Medien auf das Heranwachsen von Jugendlichen und analysiert die Chancen und Risiken einer zunehmenden Mediennutzung. Ziel ist es, die Auswirkungen der neuen Medien auf den jugendlichen Alltag in verschiedenen Bereichen wie Familie, Freizeit und Schule zu beschreiben und zu bewerten.
- Der Einfluss von neuen Medien auf die Sozialisation Jugendlicher
- Die Chancen und Risiken der digitalen Vernetzung
- Die Bedeutung von Medienkompetenz in der heutigen Zeit
- Die Rolle der Familie in der Medienerziehung
- Die Auswirkungen des Medienkonsums auf das familiäre Zusammenleben, die Freizeitgestaltung und die schulische Leistung von Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der neuen Medien und die Rolle von Sozialisationsinstanzen in der Entwicklung des Individuums vor. Sie führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfragen der Arbeit dar.
Im Hauptteil wird zunächst die heutige Medienvielfalt und die damit verbundene indirekte Beeinflussung von Jugendlichen beschrieben. Es werden die Auswirkungen der neuen Medien auf das familiäre Zusammenleben, die Freizeitgestaltung und die schulische Leistung von Jugendlichen beleuchtet. Anschliessend werden Chancen und Risiken im Umgang mit neuen Medien, wie die Förderung von Sozialisation, soziale Vernetzung und schulische und berufliche Fertigkeiten, aber auch Anonymität, sexuelle, gewaltverherrlichende und extremistische Darstellungen, Datenmissbrauch, Cybermobbing und Mediensucht, dargestellt.
Das Kapitel über die Ausbildung von Medienkompetenz durch Medienerziehung befasst sich mit der Bedeutung einer frühzeitigen Erziehung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Medien.
Schlüsselwörter
Neue Medien, Sozialisation, Mediennutzung, Jugendliche, Chancen, Risiken, Medienkompetenz, Medienerziehung, Familie, Schule, Internet, Smartphone, digitale Vernetzung, Digitalisierung, Cybermobbing, Mediensucht.
- Quote paper
- Felix Reisch (Author), 2018, Das Heranwachsen in einer Mediengesellschaft. Neue Medien als Sozialisationsinstanzen für Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454140