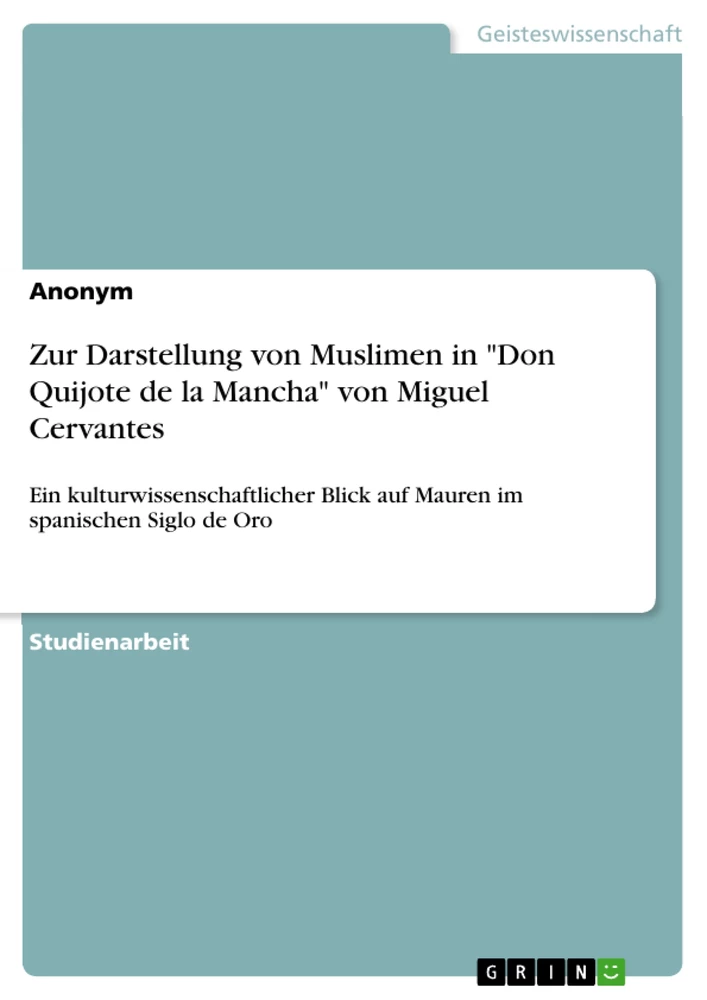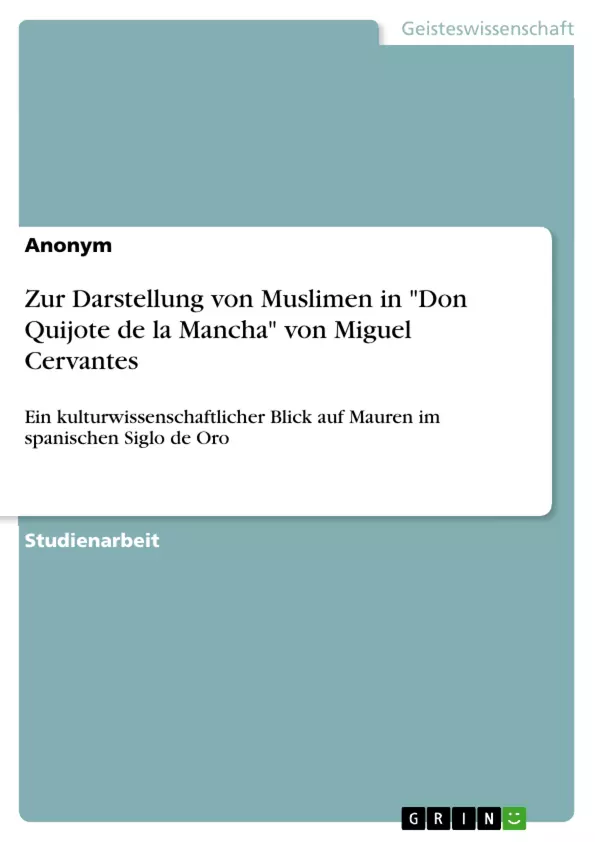Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Muslime im literarischen Werk von Miguel Cervantes dargestellt werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf seinem Roman "Don Quijote de la Mancha".
Muslime spielten eine sehr große Rolle in der Geschichte Spaniens. Jahrhundertelang hielten sie die Oberhand über die Iberische Halbinsel und hinterließen deutliche Spuren. In vielen Städten Spaniens befinden sich heute noch unzählige eindrucksvolle Bauten, die aus den Jahren der muslimischen Herrschaft stammen. Des Weiteren ist der Einfluss der arabischen Sprache auf die spanische Sprache wiederzufinden. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Arabismen, die dort enthalten sind.
Die Auseinandersetzung mit der Präsenz der Muslime in Spanien und deren Herrschaft wurden besonders in der spanischen Literatur wiedergespiegelt. Ob in Romanen, Gedichten oder in anderen literarischen Gattungen, die Rolle der Muslime wurde sehr oft beschrieben. Selbst im wohl bekanntesten Roman der spanischen Literatur, dem "Don Quijote" des spanischen Nationaldichters Miguel de Cervantes Saavedra, sind viele muslimische Figuren wiederzufinden. Im Folgenden wird in dieser Arbeit untersucht, inwiefern die Darstellung der Muslime in Cervantes' Werk auf eine alte schiitische Lehre, die "taqiyya", zurückzuführen ist. Zu Beginn wird die Eroberung Spaniens kurz erläutert und dessen Rückeroberung dargestellt, in der Muslime eine große Rolle spielten. Im Anschluss folgen Definitionen für die Begriffe "moriscos" und "taqiyya", die in der späteren Analyse eine zentrale Rolle spielen. Vor der eigentlichen Analyse wird der Inhalt des Werkes zusammengefasst. Abschließend werden die Ergebnisse angeführt und ein möglicher Ausblick skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die islamische Welt in Spanien
- Muslime erobern Spanien
- Die Reconquista
- Von mudéjares zu moriscos
- Die taqiyya
- Don Quijote von Miguel de Cervantes
- Informationen zum Roman
- Inhalt
- Der muslimische Lügner im Werk von
- Cide Hamete Benengeli
- Die Verstellung des Chronisten Benengeli
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Muslimen im Roman „Don Quijote de la Mancha“ von Miguel de Cervantes Saavedra im Hinblick auf die schiitische Lehre der Taqiyya. Sie untersucht die historischen Hintergründe der muslimischen Präsenz in Spanien, die Rolle der Taqiyya in diesem Kontext und deren mögliche Auswirkungen auf die Darstellung muslimischer Figuren in Cervantes' Werk.
- Die historische Präsenz der Muslime in Spanien
- Die Lehre der Taqiyya und ihre Bedeutung für die muslimische Identität
- Die Darstellung muslimischer Figuren in „Don Quijote“
- Die Rolle der Taqiyya als möglicher Einflussfaktor auf die Darstellung muslimischer Figuren
- Die Beziehung zwischen Fiktion und Realität in der Darstellung von Muslimen in literarischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die historische Rolle der Muslime in Spanien und die Bedeutung der Taqiyya im Kontext der muslimischen Präsenz. Das zweite Kapitel beleuchtet die Eroberung Spaniens durch die Muslime und die Reconquista, welche die muslimische Bevölkerung Spaniens stark beeinflusste.
Kapitel 3 beschreibt die Lehre der Taqiyya und ihre Bedeutung für die muslimische Identität, während Kapitel 4 sich mit dem Roman „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes auseinandersetzt und Informationen zu Inhalt und Kontext liefert.
Kapitel 5 analysiert die Darstellung des muslimischen Lügners im Werk Cervantes, insbesondere die Rolle des Chronisten Benengeli und die Frage, inwiefern die Taqiyya Einfluss auf diese Darstellung hatte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Muslime in der spanischen Literatur, Taqiyya, „Don Quijote de la Mancha“, Miguel de Cervantes Saavedra, moriscos, islamische Geschichte Spaniens, muslimische Identität, Fiktion und Realität, sowie die Darstellung von Religion und Kultur in literarischen Werken.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Zur Darstellung von Muslimen in "Don Quijote de la Mancha" von Miguel Cervantes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454158