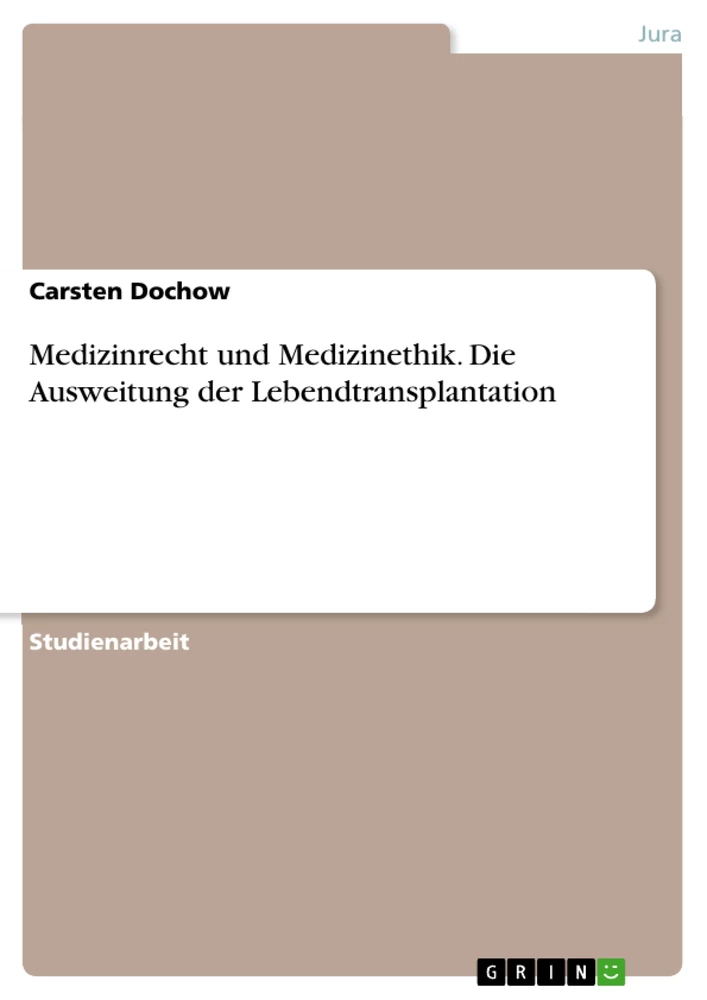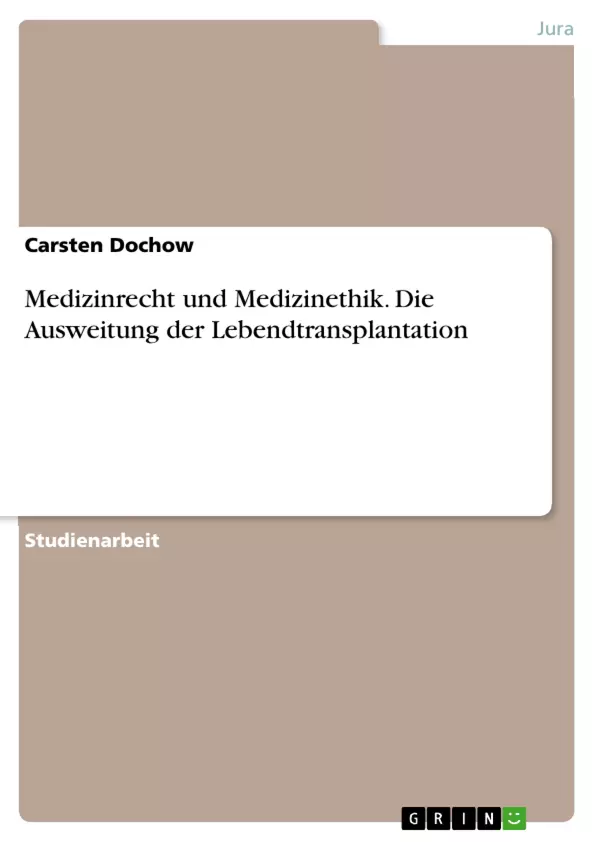Die vorliegende Arbeit vom Mai 2005 befasst sich mit dem nicht nur im Medizinrecht, sowie der Medizinethik brisanten und stets aktuellen Thema der Transplantationsmedizin, die sich insbesondere – bedingt durch das Fortschreiten der medizinischen Möglichkeiten – durch einen hohen Bedarf an Organen auszeichnet. Um dem eklatanten Organmangel entgegenzuwirken, werden verschiedene Ansätze immer wieder in den Fokus des Interesses gerückt. So erhielt nicht zuletzt im Jahre 2007 durch den jüngsten Vorstoß des Nationalen Ethikrates die Diskussion um die Modelle zur sog. postmortalen Organspende neue Aufmerksamkeit, bei der erneut die Frage über die der Selbstbestimmung des Einzelnen nachteilige sog. Widerspruchslösung gestellt wurde. Auch andere Lösungsmöglichkeiten wie bspw. verschiedene Allokationsmodelle, die sog. Xenotransplantation, Substitutionstechnologien, aber auch im Reproduktionsmedizin(rechts)bereich: das sog. therapeutische Klonen mit dem Ziel Organe als körpereigene „Ersatzteile“ zu züchten, werden nicht erst seit Kürzerem diskutiert.
Die Arbeit befasst sich mit einem daher wohl nur kleinen Ausschnitt im umfassenden Themenspektrum der/ des Transplantationsmedizin/rechts, nämlich der Möglichkeiten der Ausweitung der Lebendtransplantation als eine Lösungskonzeption, die sich ihrerseits jedoch wiederum in zahlreiche einzelne rechtliche, medizinische und ethische Frage- und Problemstellungen untergliedert.
Zunächst werden (A.) die Problemlage des Organmangels in der Bundesrepublik Deutschland und die medizinischen Voraussetzungen mit ihren Risiken erläutert. Neben der kurzen Darstellung der Rechtslage in Europa (B.), wird umfassend auf die rechtlichen Voraussetzungen der Lebendorganspende in der Bundesrepublik Deutschland (C.) eingegangen. Dabei werden u.a. die einfachgesetzlichen Voraussetzungen, neben deren verfassungsrechtlicher Einordnung dargestellt.
Lösungsmöglichkeiten werden in der vom Autor herangezogenen Literatur in ausgewählten Bereichen der Lebendorganspende gesehen (D.): unter kritischer Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht, werden die sog. Cross-Over-Spende, verschiedene sog. Austausch- und Poolmodelle, die Anonyme Altruistische Lebendspende beleuchtet, aber auch Möglichkeiten der nicht zuletzt moralisch problematischen Kommerzialisierung der Lebendspende beleuchtet, wobei der sog. regulierte Organhandel vor dem Aufzeigen möglicher Alternativen (E.) in der abschließenden Bewertung (F.) eine tendenziell positive Bewertung erfährt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Sachstand in der Bundesrepublik Deutschland
- II. Medizinische Voraussetzungen
- III. Risiken
- B. Rechtslage in Europa
- C. Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland
- I. Gesetzliche Voraussetzungen der Lebendorganspende
- 1.) Volljährigkeit
- 2.) Einwilligungsfähigkeit
- 3.) Freiwillige Einwilligung
- 4.) Aufklärung
- 5.) Geeignetheit des Spenders und des Organs
- 6.) Erforderlichkeit der Spende - Subsidiarität gem. §8 I 1 Nr. 3 TPG
- 7.) Spenderkreisbegrenzung des §8 I S. 2 TPG
- 8.) Ärztlicher Eingriff
- 9.) Nachbetreuung
- 10.) Gutachterkommission
- II. Handelsverbot und Strafvorschriften
- III. Verfassungsrechtliche Einordnung unter Berücksichtigung der Bestätigung der Regelung des §8 I 2 TPG durch das BVerfG
- 1.) Verfassungsrechtliche Aspekte des § 8 I S. 2 TPG
- a.) Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatzes und dem Gesetzlichkeitsprinzip des Art. 103 II GG
- b.) Vereinbarkeit mit Art. 2 II 1 GG (Empfänger)
- (1.) Betroffenheit und Eingriff
- (2.) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- c.) Vereinbarkeit mit Art. 3 I GG (Empfänger)
- d.) Vereinbarkeit mit Art. 2 I GG (Spender)
- e.) Vereinbarkeit mit Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG (Spender)
- f.) Vereinbarkeit mit Art. 3 I GG (Spender)
- g.) Vereinbarkeit mit Art. 4 IGG
- h.) Weitere mögliche Grundrechtsbeeinträchtigungen
- 2.) Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Subsidiaritäsklausel
- 3.) Gebot des Schuldangemessenen Strafens und Übermaßverbot
- D. Ausweitung der Regelungen zur Lebendspende?
- I. Problemfälle der Voraussetzungen zur Lebendspende
- 1.) Spenderkreis
- a.) Cross-Over-Spende
- b.) Austausch- bzw. Poolmodelle
- c.) Anonyme Altruistische Lebendspende (AALS)
- d.) Zulassung der Lebendspende Minderjähriger und erwachsener Betreuter
- (1.) Minderjährige
- (2.) Stellvertretung für erwachsene Betreute
- 2.) Subsidiarität der Lebendspende
- 3.) Zusammenfassung zur den Voraussetzungen zur Lebendspende
- II. Anreize zur Lebendspende
- 1.) Anreize bei der Allokation und „rewarded gifting“
- 2.) Finanzielle Anreize - insbesondere „regulierter Organhandel“
- III. Kompetenzen der Lebendspendekommission
- E. Alternativen
- F. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Ausweitung der Lebendtransplantation in Deutschland. Dabei werden die medizinischen Voraussetzungen, Risiken und die aktuelle Rechtslage im In- und Ausland betrachtet.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Lebendorganspende in Deutschland
- Die verfassungsrechtliche Einordnung der Lebendspende
- Die Diskussion um die Ausweitung der Lebendspende
- Die Problematik von Anreizen zur Lebendspende
- Alternative Lösungsansätze zur Organknappheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Sachstand in Deutschland, die medizinischen Voraussetzungen und die Risiken der Lebendtransplantation beleuchtet. Anschließend wird die Rechtslage in Europa und Deutschland im Detail analysiert, wobei die gesetzlichen Voraussetzungen der Lebendorganspende, das Handelsverbot und die strafrechtlichen Aspekte im Vordergrund stehen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der verfassungsrechtlichen Einordnung der Lebendspende. Hier werden die Vereinbarkeiten mit grundrechtlichen Prinzipien und der Subsidiaritätsklausel im Transplantationsgesetz diskutiert. Des Weiteren werden Problemfälle der Voraussetzungen zur Lebendspende, wie zum Beispiel der Spenderkreis, die Subsidiarität und die Zulässigkeit der Lebendspende bei Minderjährigen und erwachsenen Betreuten, beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch die Anreize zur Lebendspende, sowohl im Hinblick auf die Allokation als auch auf finanzielle Anreize, einschließlich des „regulierten Organhandels“. Schließlich werden alternative Lösungsansätze zur Organknappheit und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse präsentiert.
Schlüsselwörter
Lebendtransplantation, Organspende, Transplantationsgesetz, Verfassungsrecht, Grundrechte, Subsidiarität, Spenderkreis, Anreize, Organhandel, Organknappheit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Voraussetzungen für eine Lebendorganspende in Deutschland?
Der Spender muss volljährig und einwilligungsfähig sein, die Spende muss freiwillig erfolgen, und es muss eine besondere persönliche Verbundenheit zwischen Spender und Empfänger bestehen.
Was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip im Transplantationsgesetz?
Es besagt, dass eine Lebendspende nur zulässig ist, wenn zum Zeitpunkt der Transplantation kein geeignetes Organ eines verstorbenen Spenders zur Verfügung steht.
Was ist eine Cross-Over-Spende?
Dabei spendet eine Person einem fremden Empfänger ein Organ, weil dessen eigentlicher Spender (z. B. ein Verwandter) im Gegenzug dem Angehörigen des ersten Spenders ein Organ gibt (Über-Kreuz-Spende).
Ist Organhandel in Deutschland erlaubt?
Nein, Organhandel ist streng verboten. Die Arbeit diskutiert jedoch theoretisch die moralischen Aspekte eines „regulierten Organhandels“ zur Behebung des Organmangels.
Welche Rolle spielt die Gutachterkommission?
Jede Lebendspende muss vorab von einer Kommission geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig ist und kein kommerzieller Hintergrund vorliegt.
- Citation du texte
- Carsten Dochow (Auteur), 2005, Medizinrecht und Medizinethik. Die Ausweitung der Lebendtransplantation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45477