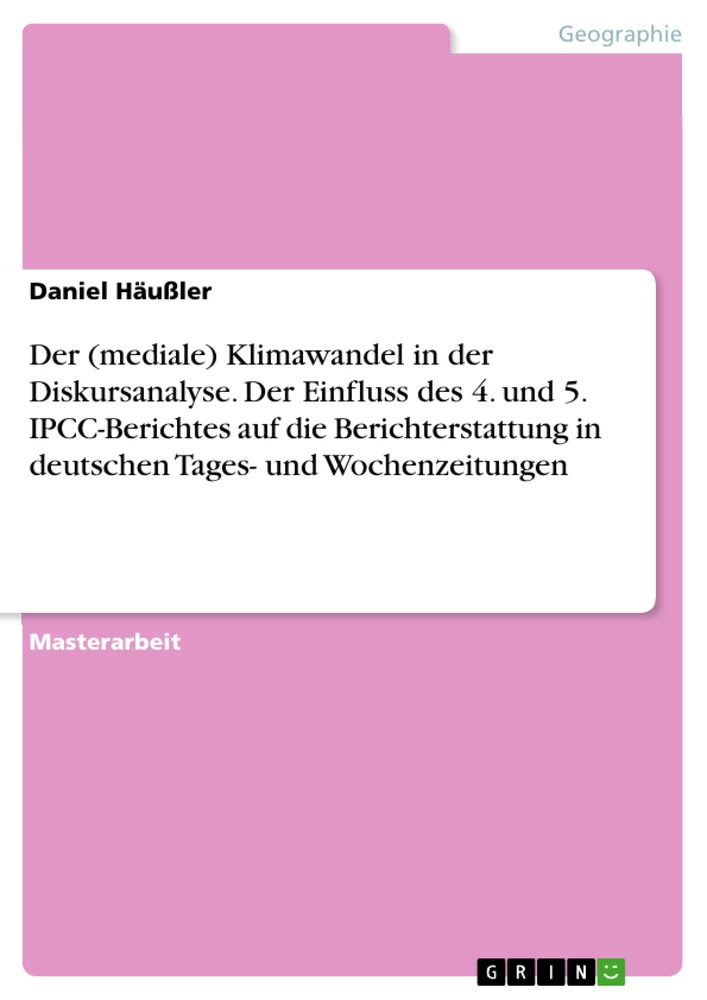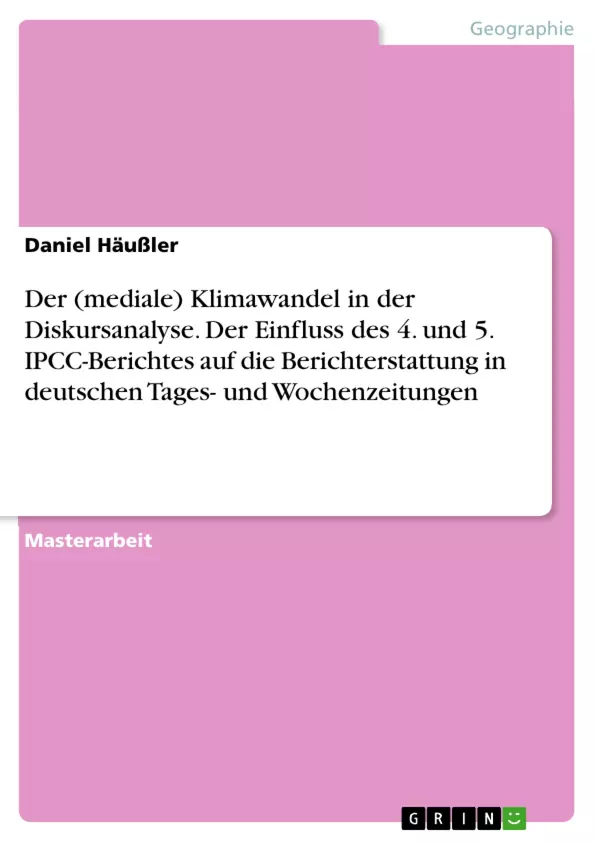Ob der schier unüberblickbaren Anzahl an naturwissenschaftlichen Publikationen zum Klimawandel zeichnet sich diese empirische Auseinandersetzung durch den Mehrwert der diskursanalytischen Auswertung der printmedialen Berichterstattung über den Klimawandel aus, wobei der 4. und 5. IPCC-Bericht dabei als jeweilige wissenschaftliche Referenz gilt. Die Theorie-Kapitel 2 und 3 erörtern den wissenschaftlichen Hintergrund des Klimawandels, zum anderen behandeln sie das bestehende Vorwissen zur medialen Repräsentation dieser globalen Herausforderung. Vor allem die Demonstration des bestehenden Klimaskeptizismus‘, der vielfältigen Akteurslandschaft in der Klimawandeldebatte in Kombination mit den Phänomenen der individuellen Wahrnehmung im Sinne des Hermeneutischen Zirkels und der Nachrichtenwertlogik nach GALTUNG & RUGE führt zu einer wertvollen Grundlage für die durchgeführte Diskursanalyse.
Als Basis für die qualitative Empirie gilt dabei die quantitative Grundlage, die an Stelle der sonst häufig verwendeten aber auch scharf kritisierten Lexikometrie steht und primär die Intensität der Berichterstattung darstellen soll. In einem weiteren Auswertungsschritt dient diese Erhebung der Festlegung der Zeitabschnitte „vor“, „während“ und „nach“ dem jeweiligen IPCC-Bericht, wobei als inhaltliche Vergleichsbasis eine siebte vorgelagerte Periode ausgewählt wurde. Die Auswertung umfasst den Zeitraum von 2005 bis 2015 mit insgesamt 574 Datensätzen, liefert mit 70 Artikeln ein repräsentatives Abbild der Berichterstattung in deutschen Tages- und Wochenzeitungen und charakterisiert diese in einer Indikatorenmatrix mit 25 Spalten, was 1.750 Einordnungen zur Folge hat.
Als Resultat dieser empirischen Auswertung soll demonstriert werden, welcher quantitative Verlauf der Berichterstattung festzustellen ist und vor allem welchen Einfluss das Erscheinen des jeweiligen IPCC-Synthesis-Reports nach sich zieht. Das Beleuchten qualitativer Veränderungen in der Berichterstattung zeigt auf, welche Inhalte der Klimawandeldebatte und der IPCC-Berichte an den Rezipienten weitergegeben werden und ob eine Fehlinformation stattfindet. Denn, so lautet die Prämisse dieser Arbeit, der einzelne Bürger kann nur dann klimafreundlich handeln, wenn er eine entsprechend ausgewogene, stringente, logische und vor allem korrekte Wiedergabe der Klimawandeldebatte erfährt, sodass er dann in der Lage ist, sein individuelles Tun zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- HINFÜHRUNG
- PROBLEMSTELLUNG UND RELEVANZ DER THEMATIK
- HAUPTTHESEN
- AUFBAU, RAHMEN UND GRENZEN DER ARBEIT
- Der Klimawandel in der naturwissenschaftlichen und der politischen Debatte
- AUFKOMMEN UND VERBALE EntwickluNG DER BEGRIFFLICHKEIT
- NATÜRLICHE EINFLUSSFAKTOREN DES GLOBALEN KLIMAS
- DER ANTHROPOGENE KLIMAWANDEL: KONSENS UND SKEPTIZISMUS
- AKTEURE IN DER KLIMAWANDELDEBATTE
- Die UN-Klimakonferenzen
- IPCC Der Weltklimarat
- Der 4. IPCC-Sachstandsbericht aus dem Jahr 2007
- Der 5. IPCC-Sachstandsbericht aus dem Jahr 2013
- NGOs
- Wirtschaftliche Akteure
- EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE MEDIALE Repräsentation der DebatTE
- Der Klimawandel als medial projiziertes Phänomen
- PHÄNOMENE DER (PRINT-) MEDIALEN NACHRICHTENÜBERMITTLUNG IN DER KLIMAWANDELDEBATTE
- EXKURS: DER HERMENEUTISCHE ZIRKEL ALS WIDERSPRÜCHLICHE INTERPRETATIONSSITUATION ZWISCHEN AUTOR UND REZIPIENT
- AKTEURS- UND INTERESSENSGESTEUERTE MASSENMEDIEN
- EXKURS: NACHRICHTENWERTLOGIK NACH GALTUNG & RUGE
- TRANSFERLEISTUNG – WAS LERNEN WIR AUS DEM INTERDISZIPLINÄREN ANSATZ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss der beiden letzten IPCC-Sachstandsberichte auf die Berichterstattung über den Klimawandel in deutschen Tages- und Wochenzeitungen. Ziel ist es, zu analysieren, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse des IPCC in der öffentlichen Debatte vermittelt werden und welche Auswirkungen dies auf die Rezeption des Klimawandels durch die Bevölkerung hat.
- Der mediale Diskurs über den Klimawandel
- Die Rolle des IPCC in der Klimawandeldebatte
- Die Rezeption wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Öffentlichkeit
- Die Bedeutung der Nachrichtenwertlogik für die mediale Berichterstattung
- Der Einfluss der Berichterstattung auf das individuelle Klimaverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik sowie die Hauptthesen der Arbeit vorstellt. Anschließend werden die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels sowie die verschiedenen Akteure in der Klimawandeldebatte erläutert, wobei insbesondere der IPCC und seine Sachstandsberichte im Mittelpunkt stehen. Kapitel 3 befasst sich mit der medialen Repräsentation des Klimawandels und analysiert die Phänomene der Nachrichtenübermittlung sowie die Bedeutung des Hermeneutischen Zirkels und der Nachrichtenwertlogik für die Interpretation des Klimawandels durch die Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Klimawandel, IPCC, Medienberichterstattung, Diskursanalyse, Nachrichtenwertlogik, Hermeneutischer Zirkel, Akteurslandschaft, Klimaskeptizismus, Medienrezeption.
- Arbeit zitieren
- Daniel Häußler (Autor:in), 2016, Der (mediale) Klimawandel in der Diskursanalyse. Der Einfluss des 4. und 5. IPCC-Berichtes auf die Berichterstattung in deutschen Tages- und Wochenzeitungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454879