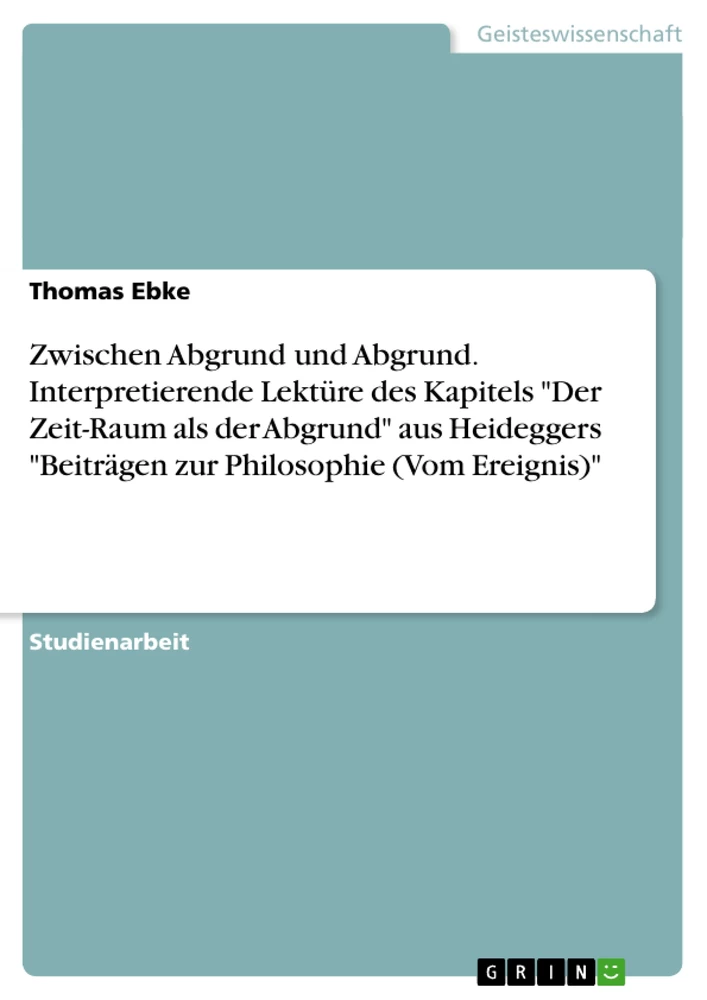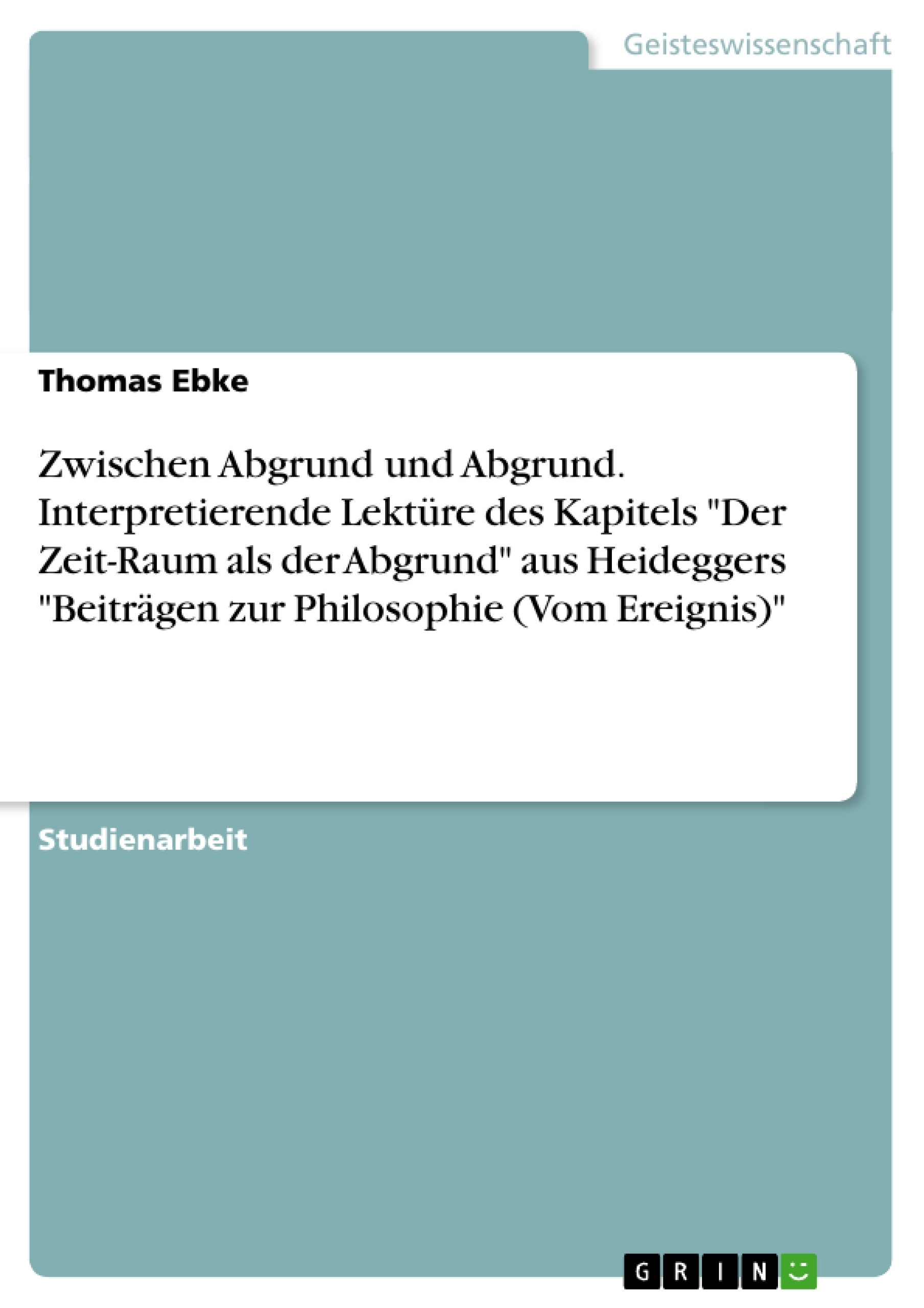Ausgangs des fünften Kapitels seiner Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) hat Heidegger einen Teilabschnitt unter dem Titel „Der Zeit-Raum als der Abgrund“ eingeschoben. Dieses fünfte Kapitel korreliert dem Anspruch der Beiträge nach der sogenannten fünften Fügung der Seinsfuge, deren Genese Heidegger seinsgeschichtlich auseinander zu legen trachtet, und es firmiert als Die Gründung. Um die Problematik des Zeit-Raums als Abgrund innerhalb der „Gründung“ als Fügung weiter einzukreisen, so lässt sich mit Seubert mutmaßen, dass die Frage nach dem Zeit-Raum ebenso wie die Frage nach dem Wesen der Wahrheit als „Entfaltungen“1 einer Initialfrage, nämlich „nach dem Dasein in seinem Verhältnis zum geschichtlichen Seinsgeschehen“2 anzugehen sei. In diesem Dreischritt des Fragens organisiert sich Heideggers emphatische Auffassung der Gründung als ein Doppelgeschehen im Ereignis: So sehr es dann einerseits das Seyn ist, das sich in eigendynamischer Bewegung dem Dasein zuwerfend ereignet und dieses Dasein als seinen Grund im Sinne etwa von „Heimstatt“ gründet, so sehr bleibt es dem Dasein aufgegeben, denkerisch- vorbereitend diese Gründungs-Stätte aller erst mitzugründen. Diese interne Doppelung der „Gründung“ hat Heidegger an früher Stelle des gleichnamigen Kapitels klar gestellt:
1. Der Grund gründet, west als Grund (vgl. Wesen der Wahrheit und Zeit-Raum).
2. Dieser gründende Grund wird als solcher erreicht und übernommen.“ 3
Im Zuge der Diskussion des Zeit-Raums als Ab-grund wird nachzuzeichnen sein, welche Figur der Einheit sich dieser doppelten Grundgebung verbindet.
Inhaltsverzeichnis
- O.) Hinführung zum Problem des „Zeit-Raums als Ab-grund“ in Heideggers Beiträgen zur Philosophie
- I.) Die Konzeption des „dreifach gestreuten Gründens“ in Vom Wesen des Grundes als Vorverständigung über den Begriff des Ab-grunds in den Beiträgen zur Philosophie
- II.) „Sicheröffnen des Sichverbergenden“. Rekonstruktion zentraler Gedankengänge aus Heideggers Bestimmung des Zeit-Raums als Ab-grund
- II. 1) „Wahrheit als Grund“. Die Verschränkung von Seins- und Wahrheitsfrage im Konzept des Zeit-Raums als Ab-grund
- II.2) Fügungen des „zögernden Sichversagens“. Über einige sprachliche und sachliche Paradoxien im Beiträge – Kapitel „Der Zeit Raum als der Ab-grund“
- II.3) Über den Zeit-Raum als Entrückungs-Genese der differenten Zeitigungweisen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich einer interpretativen Lektüre des Kapitels „Der Zeit-Raum als der Ab-grund“ aus Heideggers „Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis)“. Ziel ist es, zentrale Gedankengänge dieses Kapitels zu rekonstruieren und zu analysieren, wobei insbesondere die Beziehung zwischen Zeit-Raum, Wahrheit und dem Konzept der „Gründung“ im Vordergrund steht.
- Die „Gründung“ als Doppelgeschehen im Ereignis: Seyn und Dasein
- Die Konstruktion des Zeit-Raums als Ab-grund als Korrektur der traditionellen Raum- und Zeitkonzeption
- Die Rolle des Zeit-Raums für das Verständnis von Wahrheit
- Die „Geschiednis“ von Raum und Zeit und ihre Bedeutung für die Interpretation des Zeit-Raums
- Die Entrückungs- und Berückungsbewegungen als Ausdruck des Zeit-Raums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Problem des „Zeit-Raums als Ab-grund“ in Heideggers „Beiträgen zur Philosophie“. Sie beleuchtet die Rolle dieses Kapitels im Gesamtkontext der „Beiträge“ und stellt den Zusammenhang zwischen Zeit-Raum und der Frage nach dem Wesen der Wahrheit her. Anschließend wird die Konzeption des „dreifach gestreuten Gründens“ aus Heideggers Aufsatz „Vom Wesen des Grundes“ vorgestellt und in Bezug zum Ab-grund-Begriff in den „Beiträgen“ gesetzt.
Der dritte Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Rekonstruktion zentraler Gedankengänge aus Heideggers Bestimmung des Zeit-Raums als Ab-grund. Dabei wird insbesondere die Verschränkung von Seins- und Wahrheitsfrage im Konzept des Zeit-Raums sowie die Rolle der „zögernden Sichversagens“ als Paradoxie in der Zeit-Raum-Thematik analysiert. Abschließend wird die Entrückungs-Genese der differenten Zeitigungweisen in Verbindung mit dem Zeit-Raum-Begriff beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Philosophie Martin Heideggers, insbesondere mit der Frage nach dem Wesen des Grundes, dem Zeit-Raum, der Wahrheit, der Gründung und der „Geschiednis“ von Raum und Zeit. Sie untersucht die Verbindung zwischen diesen Begriffen im Kontext von Heideggers „Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis)“ und stellt die Herausforderungen und die Interpretationspotenziale dieser Konzepte dar.
Häufig gestellte Fragen
Was thematisiert Heidegger im Kapitel "Der Zeit-Raum als der Abgrund"?
Heidegger untersucht darin das Wesen des Zeit-Raums nicht als physikalische Dimension, sondern als seinsgeschichtliche "Gründung". Er versteht den Zeit-Raum als "Ab-grund", der sich der herkömmlichen Vorstellung von Grund entzieht.
Was bedeutet "Gründung" in Heideggers "Beiträgen zur Philosophie"?
Gründung wird als Doppelgeschehen verstanden: Einerseits gründet das Seyn das Dasein als seine "Heimstatt", andererseits muss das Dasein diese Gründung denkerisch mitvollziehen und übernehmen.
Wie hängen Zeit-Raum und Wahrheit bei Heidegger zusammen?
Der Zeit-Raum wird als Entfaltung der Frage nach dem Wesen der Wahrheit gesehen. Er ist die Stätte, an der sich die Wahrheit des Seyns ereignet und gründet.
Was ist mit dem Begriff "Ab-grund" gemeint?
Der Bindestrich in "Ab-grund" deutet darauf hin, dass der Grund sich "ab-wendet" oder versagt. Es ist ein Grund, der kein fester Boden im traditionellen Sinne ist, sondern ein Geschehen des Sichverbergens.
Was versteht Heidegger unter der "Geschiednis" von Raum und Zeit?
Die "Geschiednis" beschreibt die ursprüngliche Einheit von Raum und Zeit vor ihrer Trennung in separate Dimensionen. Der Zeit-Raum ist der Ursprung, aus dem Raum und Zeit in ihrer Differenz erst hervorgehen.
- Quote paper
- Thomas Ebke (Author), 2005, Zwischen Abgrund und Abgrund. Interpretierende Lektüre des Kapitels "Der Zeit-Raum als der Abgrund" aus Heideggers "Beiträgen zur Philosophie (Vom Ereignis)", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45496